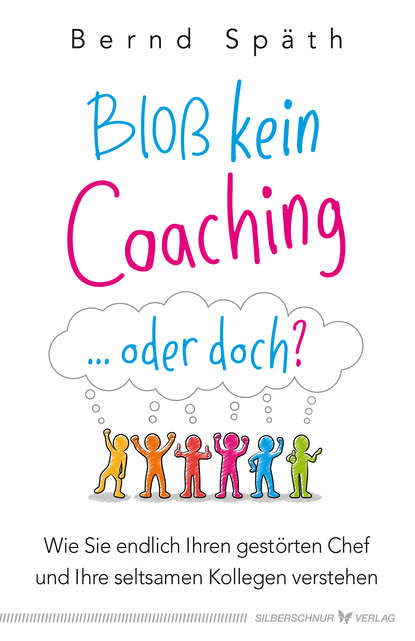- -
- 100%
- +
Ein Schuhspanner, so weiß es der Gebildete, besteht aus drei Teilen: dem sogenannten konkaven Vorderblatt, der Teleskop-feder und dem Fersenstück, das die sogenannte Hinterlappe ausfüllt. Deshalb ist es abgerundet und entwickelt am Ende einer hochschnellenden Teleskopfeder die Wirkung eines Totschlägers. Zumindest in der Erlebniswelt meines Kunden, der nicht nur einen heftigen Einschlag kassierte, sondern auch den jähen Kollaps seiner wohldurchdachten Ordnungsprinzipien erfuhr: Etwas, das sich a priori unterzuordnen hatte, hatte sich eigenmächtig zum Aufruhr entschlossen und in grausamer Weise gegen seinen Herrn gewütet.
»Ich habe geschrien! Es war ja schließlich dunkel!« Die Stimme bebt. Hier ist nicht nur ein meuchlerischer Mordanschlag zu beklagen, sondern die Weigerung der Welt, die von ihm erkannten Grundprinzipien zu achten. Wozu bitte hat man promoviert, wenn die Realität sich anschließend jedem Anspruch auf Überschaubarkeit entzieht?
»Jedenfalls, ich bin hochgeschnellt, um mich mit einem Faustschlag zu verteidigen! Aber da war natürlich niemand!«
»Mutig!«, presse ich zwischen den Lippen hervor, die ich fest aneinanderklebe, denn lange halte ich das hier nicht mehr aus.
»Und deshalb bin ich vom eigenen Schwung vornüber gestürzt. Auf die Kommode. Mit dem Gesicht auf die Kommode. Im Dunkeln.«
»Glmpf«, sage ich.
»Wie bitte?«
»Schon gumpf.« – Er merkt es nicht, so außer sich ist er. Es dürfte der bizarrste Überfall gewesen sein, den man mir jemals geschildert hat.
Als illusionäre Verkennung bezeichnet die Psychiatrie eine Sinnestäuschung, die auf einer Fehlinterpretation realer Sinneseindrücke beruht: Es wird etwas Vorhandenes wahrgenommen – aber nicht als das, was es ist. Meist ist sie das Resultat eines bestimmten, vorwiegend ängstlichen Gemütszustands. Nicht selten wird im Dunkeln eine Vogelscheuche als »Räuber« interpretiert, ein Baumstumpf als hingekauerte Gestalt, ein Busch als Tier, ein Haufen Blätter als liegender Körper, eine aufgehängte Hose als Erhängter. Eine unbewusste Angst, nicht selten kombiniert mit dem Gefühl von Schwäche, Unterlegenheit oder Angreifbarkeit, bildet die Voraussetzung hierfür. Ein Kraftpaket, das mit der Gewissheit über eine nächtliche Landstraße schreitet, jeden umzuhauen, der ihm etwas will, wird hierfür weit weniger anfällig sein. So ist es auch nicht erstaunlich, dass illusionäre Verkennungen im Bereich der Psychopathologie, nicht zuletzt der Schizophrenie, relativ häufig vorkommen. Abzugrenzen sind sie von den Wahnvorstellungen, wo etwas NICHT Existierendes wahrgenommen wird. – Bei der illusionären Verkennung also wird Realität falsch verarbeitet. Beim Wahn existiert sie erst gar nicht (weiße Mäuse, Stimmen, Strahlen etc.)
Im obigen bizarren Fall lag offensichtlich eine angsthafte Grundgestimmtheit vor, die sich im starken Bedürfnis manifestierte, allen Bereichen des Lebens feste Regeln aufzuzwingen, so dass nichts Unkontrollierbares mehr entschlüpfen konnte. (Und nicht zuletzt auch im Bedürfnis, sich im Dunkeln zu entkleiden.) Wie rigide dieses System war, erweist sich daran, dass es bis unmittelbar in die Schlafvorbereitungen hineinreichte. Der hochgradig zwanghafte Charakter des Betroffenen legt die Deutung nahe, dass alleine schon das Entkommen eines Schuhspanners einen so massiven Bruch des eigenen Zwangssystems verkörperte, dass es nicht mehr anders erlebt werden konnte denn als massiver, gewaltsamer Angriff. – Der Zwanghafte hat Angst vor der Welt. Wer aber so erstarrt lebt, den versetzen ihre Buntheit und Lebendigkeit stets nur in Panik.
Eine Stunde, nachdem der Gast sich verabschiedet hatte, kam meine Sekretärin in mein Büro, sah Tränen über meine Wangen rollen und wollte aufgeregt wissen, was mir zugestoßen sei. Sie habe mich noch niemals weinen sehen. Ich hatte mich lange beherrscht, doch je länger ich über diese schräge Geschichte nachgedacht hatte, desto heftiger hatte ich am Ende losgeprustet. – Die illusionäre Verkennung meiner Mitarbeiterin also war ebenfalls nicht realitätsgemäß. Ich erzählte ihr alles, und so teilte sie meine Heiterkeit. – Aus dem Auftrag wurde übrigens nichts.

Über das Alleinsein
»Es ist übrigens nach Lage der Dinge nicht auszuschließen, dass Gisela mich verlässt«, sagt der Klient. Ein sehr smarter junger Ingenieur namens Dirk, mit Audi-Cabriolet und einer sehr seltsam gemusterten Hose. »Und ich muss sagen, dass mich das sehr überrascht.«
In der Tat: Er ist ursprünglich zu mir gekommen wegen eines Problems mit seinem Firmenpartner, der seinen hochfliegenden Plänen nicht folgen wollte. Nun läuft ihm die Frau davon.
»Und warum?«
»Ich verstehe es nicht. Wir sind beide Akademiker, wir haben beide exquisite Jobs, und wir verfügen beide über erstklassige soziale Kontakte!«
»Wie sieht’s mit Liebe aus?«
Die Nase zieht sich hoch. »Wir wollen doch bitte sachlich bleiben!«
Gisela, eine hochintelligente und brennend ehrgeizige Anfangsdreißigerin, hat in der Presseabteilung eines Weltunternehmens so sehr reüssiert, dass sie jetzt beabsichtigt, mit einem Zeitungsredakteur zusammenzuziehen. Der Klient scheint dies in erster Linie als Kränkung seines sozialen Status zu erleben. »Erst letzten Samstag war noch der Regierungssprecher auf unserer Party, und jetzt das!« Sozial selbstoptimiert nennt man das vermutlich.
»Und wie geht es Ihnen damit, so als Mann und Partner?«
Als Antwort ein schwurbeliger Monolog, der sachlich begründet, was alles für das Fortbestehen der Beziehung spricht: arbeitstechnische, gesellschaftliche und finanzielle Gesichtspunkte. Irgendwie scheint Gisela anderer Meinung zu sein, denn sie ist nicht mehr umzustimmen.
Unter Akademikern regelt man so was ja kultiviert: Bis die Eigentumswohnung des neuen Partners bezugsfertig ist, dauert es noch acht Monate, die man selbstverständlich noch »als Freunde« zusammenlebt. Versuche, dieses Konstrukt auf seine Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, werden von Dirk eisern blockiert. Gisela ist nett zu ihm, wenn sie da ist, und sie begrüßt ihn mit herzlichen Wangenküssen, wenn sie vom Wochenende und später dann ganzen Wochen mit dem – übrigens ebenfalls noch verheirateten – Partner zurückkehrt. Die Firmenpartnerschaft leidet immer mehr, denn Dirk macht Fehler, versäumt Fristen und erledigt wichtige Dinge nicht. Er hat für alles seine Begründung: intellektuell brillant, sprachlich geschliffen, inhaltlich schlüssig – und ansonsten für den Müll.
»Wir waren gestern bei Joe Cocker! Ausgezeichneter Abend! Danach noch Essen beim Koreaner – superb!«
Und danach, wie er konzentriert berichtet, legten er und Gisela sich ins Ehebett und kuschelten. Sei ihnen ja gegönnt.
Weitere Versuche, diese seltsame Symbiose analytisch anzugehen, treten eine Lawine intellektueller Erklärungen los, warum es so und nur so richtig ist. – Abwehr pur. Man nennt es »Rationalisierung«: Ein eigener Gefühlsimpuls wird nicht zugelassen, stattdessen wird der Verdrängungsakt mit rein verstandesmäßigen Erklärungen überlagert und das ursprüngliche Gefühl scheint niemals aufgetreten zu sein.
»Sie wollen es nicht wahrhaben«, sage ich.
»Was?«
»Dass Gisela Sie bald verlassen wird. Sie tun so, als würde dieser Fall niemals eintreten, dann brauchen Sie sich nicht damit zu beschäftigen.« Immer deutlicher wird, dass Dirks Panik vor dem Unausweichlichen ins Unermessliche gestiegen ist. Dabei geht es ihm längst nicht mehr um Gisela, deren Ausstieg er »intellektuell voll verarbeitet« hat, während er hilflos dagegen anargumentiert. Er leugnet die Realität, verdrängt seine eigenen Ängste, die ihn immer heftiger steuern und nur ein einziges Thema haben: verlassen werden.
Man müsse so etwas »positiv gestalten« erklärt Dirk mir und meint damit, dass er mehrere Kontaktanzeigen geschaltet hat in Medien, auch im Internet ist er gut unterwegs. Er trifft Frauen reihenweise und geht nach einem durchdachten Ausschlussverfahren vor: gesellschaftlicher Status – Bildung – Beruf – Attraktivität – Qualität des Sex. Wenn so was nicht zu einer glücklichen Partnerschaft führt.
Doch, tut es. Nanni ist seinem Charme und seinem Drängen erlegen, und Dirk nutzt diesen »strategischen Erfolg«, um mir mitzuteilen, dass er meine Hilfe nicht länger benötige. Die dreißigjährige angestellte Steuerberaterin aus Olpe ist hin und weg von ihm, und tatsächlich ist Hochzeit: Exakt zwei Tage nach Dirk/Giselas Scheidung und exakt sieben Tage, bevor Gisela aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Nanni hat sich drei Tage Urlaub genommen, so ehelicht sie ihren Dirk in Olpe, bevor der zurückdüst in die eheliche – bzw. künftige eheliche – Wohnung, während Nanni noch ihre letzten Arbeitstage in Olpe ableisten muss. Als sie am nächsten Abend mit ihrem frischgebackenen Ehemann telefoniert, hört sie, wie im Hintergrund eine Wohnungstür aufgeht und eine Frauenstimme sagt: »Hallo, mein Schatz!« – Es gibt nichts, was es nicht gibt. Nanni legt heulend auf, Ehekrise Nummer eins. Drei Tage später zieht Gisela aus, passenderweise endet auch Nannis Arbeitsverhältnis und so zieht sie zu ihrem Mann und nimmt Giselas Platz im Ehebett ein. Wenigstens die Wäsche ist frisch bezogen.
Die Ehe hielt anderthalb Jahre, dann zog Nanni Hals über Kopf aus. Nur Monate später kollabierte Dirks Firma unter einem riesigen Schuldenberg. Dirk wurde letztmalig in einem hellen Anzug am Hamburger Flughafen gesehen. Alleine.

Am Geheimnis fast erstickt
Manchmal erwischt es einen kalt. Jedenfalls geht es mir so, als Roger an meiner Haustür steht, ein grundsympathischer Junge aus der Nachbarschaft, den ich seit Jahren kenne und schätze. Freundlich, hilfsbereit, kameradschaftlich, einer zum Gernhaben. Nur, diesmal sieht er verzweifelt aus. »Du bist doch Coach«, sagt er in der folgenden Minute, denn so lange braucht er für den Satz. »Ich brauch Hilfe.«
Der Neunzehnjährige wirkt völlig mutlos, als er mir gegenüber sitzt, ich sehe, wie heftig es in ihm arbeitet.
»Das ist so was von Scheiße«, sagt er, und auch dafür braucht er eine volle Minute. Denn Roger ist ein schwerer Stotterer. Einer der schwersten Fälle, die mir je begegnet sind. Wenn er anfängt zu sprechen, ist es, als würde eine Hand nach seiner Kehle greifen und ihn würgen. Der ganze Oberkörper verkrampft, zieht sich zusammen und schnellt spasmisch hin und her, während er einzelne Wortfetzen hervorstößt. Der Junge arbeitet wie in einem Geschirr, hebt sieben, acht Mal an für jeden Satz. Es tut weh, ihm zuzusehen. Eine junge Seele im Schraubstock. Der breitschultrige Roger, robuster Mittelfeldspieler im örtlichen Fußballverein, wirkt dann so verletzbar wie eine Muschel, die man aus ihrem Gehäuse geholt hat.
»Ich mag nicht mehr«, hackt er. »Ich mag einfach nicht mehr.«
Der Junge ist am Boden zerstört. Er würde so gerne Krankenpfleger werden, das hat er sich die ganze Schulzeit über erträumt. Nun aber hat er seine dritte Absage kassiert, unisono mit gleicher Begründung: »Wie stellen Sie sich das vor? Wenn ein Patient in eine kritische Situation gerät, sind Sie außerstande, das jemandem mitzuteilen.«
Das stimmt leider. Aber es zerstört auch, den Traum eines jungen Menschen. Ich blicke in tieftraurige Augen. »Hilfst du mir?«, hackt er hervor. »Das Geld treib ich irgendwie auf.«
Über Jahre hinweg habe ich Rogers Entwicklung aus der Nachbarschaft verfolgt. Ein fürsorglicher, sehr warmherziger Junge, der oft bei uns im Garten war und liebevoll mit meinem kleinen Sohn spielte. Er hat vier Geschwister und lebt in »geordneten Verhältnissen«. Allerdings fällt mir auf, dass die Eltern ein sehr rigides Regiment führen und zur frommen Bigotterie neigen. Die Mutter höre ich oft lange mit sich überschlagender Stimme brüllen. – Sie ist überfordert, fünf Kinder sind für jede Frau ein Knochenjob, der Mann ist viel unterwegs. Bisweilen habe ich auch den Verdacht, dass Probleme einfach weggebetet werden. Hilft nicht immer. Rogers Problem jedenfalls ist mit den Jahren immer schlimmer geworden.
Völlig klar ist, dass ein Coach hier nichts zu suchen hat, denn es liegt ein Krankheitsbild vor. Und es bedarf keines besonders geschulten Blicks, um zu erkennen, dass Rogers Symptomatik nur die Spitze eines bisher unbekannten Eisberges sein kann.
»Oder nimmst du nur Manager?«, fragt Roger.
Ich nehme mir fast zwei Stunden Zeit, höre geduldig zu, wenn Roger Sätze hervorwürgt, ohne ihm Druck zu machen. Viel Leid kommt zum Vorschein, viel direkte und indirekte Diskriminierung, die sich schon viel zu tief in die junge Seele gegraben hat. Er hat viel loszuwerden. Sukzessive, mit viel Behutsamkeit, mache ich ihm klar, dass wir nicht ein technisches Problem beheben müssen, sondern ein psychisches.
»Psychisch bin ich okay«, sagt er. »Ich hab doch kein’ an der Waffel!« – Freud hat mal geschrieben, dass die Neurose sich mit allen Mitteln verteidigt.
Am Ende kann ich ihn überzeugen, dass er in fachärztliche Behandlung gehört.
»Ich kenn da keinen«, hebt er hilflos die Hände.
Aber ich. Eine mit mir eng befreundete Fachärztin für Psychiatrie ist eine hervorragende Psychoanalytikerin, mit der ich mich oft fachlich austausche. Ich rufe sie tags darauf an.
»Stottern«, sagt sie, »bedeutet: Es gibt ein Geheimnis, über das nicht gesprochen werden darf.« Und sie sagt, Einzeltherapie sei zwecklos. Hier müsse die gesamte Familie therapiert werden, alle sieben. Regelmäßig einmal die Woche.
»Übernimmst du mir den Jungen?«, frage ich. »Mir liegt an dem.«
»Du, ich bin voll.«
»Einer, einer, einer geht noch rein!«, sage ich. Als Coach muss man auch mal den Widerstand einer Analytikerin bearbeiten. Eine Viertelstunde später habe ich es geschafft.
»Aber die müssen selber bei mir anrufen«, insistiert sie. »Nicht du.«
»Eh klar«, antworte ich zufrieden. »I love you.«
Jetzt, so vermute ich, beginnt der härteste Teil der Aufgabe. Schon am Abend klingelt Roger wieder.
Ich erkläre ihm die Situation und sehe einen riesigen, leuchtenden Hoffnungsstrahl in seinen Augen.
»Kann ich mal telefonieren?«, fragt er. Der Satz schnellt flüssig heraus, ohne die kleinste Unterbrechung. Ein paar Minuten später sitzt seine Mom bei mir im Büro.
Das ist regelmäßig die heikelste Situation: Teilt der Coach mit, dass das Kind in fachärztliche Behandlung gehört, wird erst mal der Coach zu Kleinholz gemacht. Ursache ist, dass fast alle Eltern angesichts der Symptome ihres Kindes mit einem unterschwelligen Gefühl herumlaufen, etwas stimme nicht, und dieses Gefühl hartnäckig verdrängen. Wird die Situation von außen angesprochen, schießt ein heißer Strahl von Schuldgefühl und Versagensängsten nach oben, der nur abgewehrt werden kann, indem man ihn auf den Coach lenkt. – Ich bin auf alles vorbereitet, schließlich kenne ich Renate und ihren Flammenstrahl.
Sie hört lange und schweigend zu, ich warte auf den Ausbruch. Dann ergreift sie Rogers Hand und streichelt sie unentwegt. Der Junge sieht sie ungläubig an.
»Ich tu alles für den Jungen«, sagt sie leise, und ihre Augen füllen sich. »Alles, alles, alles. Hauptsache ihm wird geholfen. Und wenn ich dafür jede Woche mit dem Fahrrad nach Rom fahren muss.«
»Den Papst brauchen wir hier nicht. Wenigstens diesmal nicht, okay?«
»Wie weit ist das von hier zu dieser Frau?«
»Gut zwanzig Kilometer.«
»Egal. Ich weiß doch schon die ganze Zeit, dass irgendwas nicht stimmt.«
»Toll, Renate!«, sage ich. »Alle Achtung.«
Sie streichelt das Gesicht ihres Sohns. »Ich red’ jetzt gleich mit Ernst und dann ruf ich die an. Das schaffen wir.«
Roger schnellt von seinem Sitz hoch. »Mama!«, schreit er gellend, dann fliegt er ihr um den Hals.
Ein paar Tage später sehe ich abends den vertrauten Kleinbus der Familie an unserem Haus vorbeifahren. Die Gesichter der Eltern sind ernst und gefasst, die Kinder albern untereinander. Nur Roger schickt mir einen so intensiven Blick, dass ich ihn lange mit mir nehme. Sie werden das anderthalb Jahre durchhalten, jeden Mittwochabend um die gleiche Zeit. Sie haben wirklich den Mut, die gesamte Familiendynamik zur Disposition zu stellen, um ihrem Roger zu helfen.
Als ich kurz nach unserem Gespräch selber auf der Intensivstation liege, werde ich wach, weil Roger an meinem Bett steht und meine Hand hält.
»Du schaffst das«, flüstert er beschwörend.
Noch oft klingelt er abends bei uns und isst mit. Seine Störung ist vollständig behoben, er spricht frei, flüssig und zusammenhängend. Und er labert fast unentwegt, gerade so, als hätte er alles mitzuteilen, was er die ersten zwanzig Jahre nicht sagen konnte. Man kommt einfach nicht mehr zu Wort bei ihm. Manchmal wird es anstrengend, doch das nimmt man ja gerne hin. Die Familie insgesamt wirkt befreiter, ihre Art des Umgangs miteinander weniger ritualhaft.
In seinem Job als Krankenpfleger arbeitet er längst. Ich frage mich, innerlich grinsend, ob er sie auch dort alle gegen die Wand redet.
Es waren Alexander und Margarete Mitscherlich, die einmal schrieben, die Psychoanalyse sei das wertvollste Instrument zur Erforschung der menschlichen Seele, das uns je gegeben wurde.

Der Coach und die zwei Seelen
»Wenn einer beim ersten Mal gleich zu spät kommt, wird es nix!«
»Und warum?«
»Gleich beim ersten Mal zu spät, heißt: Ambivalenz. Das funktioniert von vornherein nicht.«
»Und was machst du dann?«
»Ich sage ihnen, dass ich sie nicht behandeln kann. Mir ist das einfach zu anstrengend.«
Die Psychoanalytikerin, mit der ich mich gelegentlich austausche, ist nicht nur sehr kompetent, sondern auch stets sehr freundlich und zugewandt. Umso überraschender ihre beinharte Haltung – immerhin geht es ja um Patienten. Doch sie besteht auf ihrem Erfahrungssatz, dass Verspätungen gleich in der ersten Stunde kein unglücklicher Zufall sind, sondern Ausdruck eines inneren Konflikts des Patienten, der am Ende stets zu Lasten der Behandlung geht, – mehr noch, der sie regelrecht sabotiert.
Man staunt ja erst mal. Doch im Laufe der Jahre sollte ich erfahren, wie recht sie hatte: Klienten mit Ambivalenz sind die schwierigsten überhaupt. Denn weder bewusst noch unbewusst wissen sie, was sie eigentlich wollen. Mehr noch: Sie wollen immer das eine – und das Gegenteil gleich mit. Entscheidungen, die sie treffen, heben sie nahezu gleichzeitig wieder auf. Oft erinnern sie einen an Pubertierende, deren Sprunghaftigkeit jeden Elternteil täglich einmal an die Decke treibt. Nichts mehr ist verlässlich, nichts mehr ist planbar, alles ist vorläufig und zugleich auch das Gegenteil.
Da soll einer nicht wahnsinnig werden. Aber nun ja, aus der Behandlung von früher sogenannten »Wahnsinnigen« stammt der Begriff, den erstmals der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler verwandte bei der Behandlung Schizophrener. Liest sich also alles so, als wäre damit nicht zu spaßen. Und wenngleich »die Ambivalenten« in aller Regel über eine scheinbar (!) intakte soziale Funktionsfähigkeit verfügen, sind die Schädigungen in ihrem Leben oft so beträchtlich, dass sie leiden. Bis hin zur existenziellen Krise. Denn was sie aufbauen, reißen sie gleichzeitig wieder ein.
Ambivalenz also ist das gleichzeitige Bestehen eines Gefühls und seines Gegenteils. Ich liebe jemanden und hasse ihn zugleich (Pubertätskonflikte!). Ich will etwas ganz dringend und habe zugleich Angst davor. Ich will eine psychologische Behandlung, aber ich wehre mich auch verbissen dagegen und unternehme unbewusst alles, um sie zu verhindern. – Legion sind die Männer, deren Herz sich einer ambivalenten Frau ergeben hat: Sie werden innigst geliebt, mit Zärtlichkeit und Hingabe überhäuft, vor Leidenschaft förmlich aufgefressen, erleben die Nächte aller Nächte – und werden aus dem Nichts heraus fallen gelassen. Selbstverständlich auch umgekehrt, man ist als Autor ja genderkompetent. Die Frauen nennt man oft männermordend, die Männer meist Blender. Gemeinsam ist ihnen die Ambivalenz, die ihnen eine feste Beziehung unmöglich macht, obwohl sie sich mit nichts anderem mehr beschäftigen. Und die Zahl ihrer tief verletzten Opfer, die oft jahrelang daran tragen, »von einem Tag auf den anderen und ohne jeden Grund …!« – Ja, mei. Nicht selten, dass die flüchtigen Partner nach einiger Zeit wieder auftauchen, heftiges Interesse signalisieren, das Ganze nochmals von vorn – und kurz darauf sind sie wieder weg. So was schlaucht und hinterlässt tiefe Narben.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.