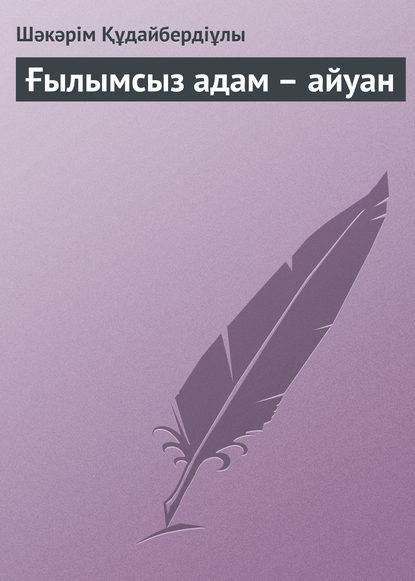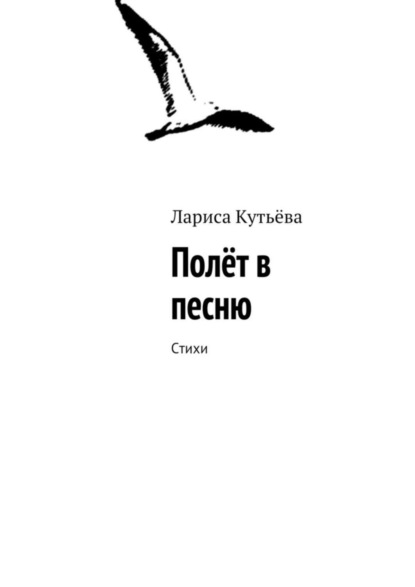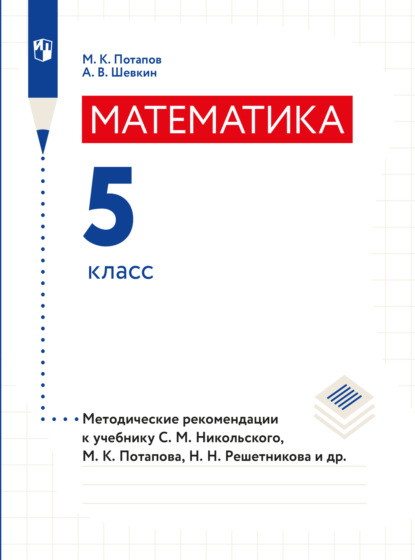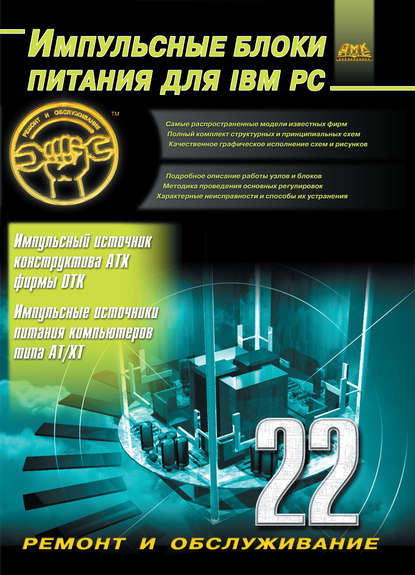Frühkindlicher Fremdsprachenerwerb in den " Elysée-Kitas "
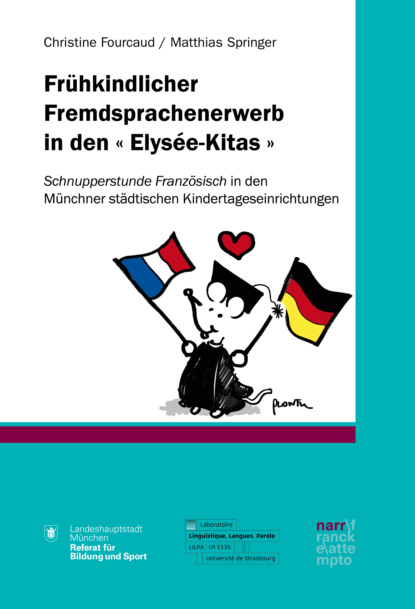
- -
- 100%
- +
Die Münchner Schnupperstunde Französisch im Netzwerk der Elysée-Kitas sieht sich diesem Ziel für alle Kinder verpflichtet, egal welcher sprachlichen, kulturellen oder staatsbürgerlichen Herkunft: Die Kinder haben nicht nur ein Recht auf Bildungschancengleichheit, sondern der Städtische Träger sieht sich auch in der Pflicht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Daher lautet die Zielsetzung der Schnupperstunde nicht ausschließlich, Kindern einen möglichst frühen Kontakt mit der Fremdsprache Französisch anzubieten oder, wenn sie aus dem frankophonen Raum stammen, ihre Muttersprache zu fördern, sondern auch, ihnen neben Deutsch mit Französisch noch wenigstens eine weitere Sprache zugänglich zu machen, um damit eine Grundlage für die weitere Entfaltung ihrer Mehrsprachigkeit zu legen. Europa beginnt im Kleinen.
An dieser Zielsetzung ist auch die vorliegende Studie orientiert, was sich in drei Fragestellungen niederschlägt. Es geht vordergründig nicht ausschließlich darum, den sprachlichen Fortschritt und Erfolg zu messen, die Qualität der Organisation und der Durchführung der Schnupperstunde in den Einrichtungen zu beurteilen oder die Kompetenzen der Fachlehrkräfte sowie des pädagogischen Personals zu evaluieren. Untersucht wurde der grundsätzliche bildungs- und gesellschaftspolitische Mehrwert von Mehrsprachigkeit und zwar in einer sehr frühen Phase kindlicher Entwicklung und Sozialisation. Das Ziel politischer, gesellschaftlicher wie auch kultureller Teilhabe durch Mehrsprachigkeit kann nur gelingen, wenn diese kompetent auf den Ebenen der Organisation und der didaktisch-pädagogischen Umsetzung sichergestellt wird. Die der vorliegenden Studie zugrunde liegenden Deskriptoren, die diese beiden Ebenen beschreiben, sind allenfalls als Indikatoren für die Beantwortung der drei Fragestellungen, jedoch nicht als absolute Kategorien zu verstehen.
1.1 Früher Fremdsprachenerwerb, Migration, Inklusion
Die Stadt München unternimmt große Anstrengungen, frühen Fremdsprachenerwerb als ein Instrument zur Förderung von Integration in Migrationskontexten zu unterstützen. Dazu wird als eine Maßnahme die Inklusion fremdsprachiger Kinder in den Kindertageseinrichtungen unter städtischer Trägerschaft angestrebt und beispielsweise mit dem Projekt der Elysée-Kitas umgesetzt. Zur Erfassung und Beurteilung des Zusammenhangs von Fremdsprachenerwerb, Migration und Inklusion, wurden bereits zahlreiche Forschungsergebnisse veröffentlicht, die viele populäre Vorurteile insbesondere in Bezug auf frühe Mehrsprachigkeit1 widerlegen. Pädagogen, politische Entscheidungsträger und Eltern werden in diesem Kontext hauptsächlich mit drei Fragen konfrontiert, die unter Hinzuziehung der aktuellen Forschungslage beleuchtet werden.
Frage 1
Hat Mehrsprachigkeit bei Kindergartenkindern2 möglicherweise einen negativen Einfluss auf deren kognitive, sprachliche und soziale Entwicklung?
Studien zur kognitiven, sprachlichen und sozialen Entwicklung von Kindern zeigen durchaus, dass bilinguale Kinder in jeder ihrer Sprachen einen geringeren Wortschatz erwerben als einsprachige. Bei Bildbenennungstests sind bilinguale Kinder langsamer und ihre Fehlerquote ist höher als bei monolingualen. Wiederholt man allerdings den Test, erreichen die bilingualen beim fünften Durchgang die Ergebnisse von monolingualen Kindern, während letztere ihre Leistung nicht verbessern können.3 „Dies ist, nach Ingrid Gogolin, dem Umstand geschuldet, dass bei der Aneignung von Wortschatz – anders als beim Erwerb von Strukturen – der konkrete Input maßgeblich ist, den ein Kind erfährt“.4
In diesem Punkt sind sich jedoch die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig: Den direkten Vergleich der lexikalischen Leistungen von bilingualen und monolingualen Kindern muss man methodologisch unter Vorbehalt wahrnehmen, wenn die bilingualen als Maßstab genommen werden. Sollen z. B. Eigennamen und cognates (transparente Wörter wie rose/rosa; Maman/Mama) einzeln oder doppelt gezählt werden? An diesem Beispiel sieht man, dass mono- und bilinguale Kinder bezüglich ihrer sprachlich-kognitiven Fähigkeiten nur bedingt vergleichbar sind, denn grundsätzlich sind beim praktischen Sprachhandeln Zwei- oder Mehrsprachiger in der Regel nicht alle Bereiche des Sprachgebrauchs doppelt vorhanden. Die Mehrsprachigkeit funktioniert nach dem Prinzip der Komplementarität, d.h., sie ergänzt sich. In einigen Domänen wird die eine Sprache bevorzugt, in anderen die andere(n) Sprache(n).5 Ein Kind, das mit dem deutschsprachigen Papa in den Zoo geht, kennt mehr Tiernamen auf Deutsch, die Musiknoten dafür nur auf Französisch, weil es diese mit der frankophonen Mutter übt. Hiermit ist eine ungleiche Verteilung von Wortschatz über die Domänen verbunden, je nach Funktionalität der jeweiligen Sprache(n) in einzelnen Lebensbereichen. Fest steht, dass die Menge des Wortschatzes, über die Bilinguale in jeder Einzelsprache verfügen, zwar geringer ist, die Gesamtmenge des verfügbaren Wortschatzes Zwei- oder Mehrsprachiger aber nicht hinter der Einsprachiger zurückbleibt, sondern in zahlreichen Fällen sogar höher ausfällt.6
Bereits seit 50 Jahren bestätigen sowohl Fallstudien als auch Gruppenstudien aus Europa und Nordamerika Zusammenhänge zwischen Mehrsprachigkeit und kognitiven Leistungen. Aus den Neurowissenschaften weiß man, dass neuronale Hirnstrukturen und Kompetenzen nicht stabil sind. Die Neuronen strukturieren sich ständig mit jeder neuen Erfahrung um. Diese Art der Anpassung nennt man Neuroplastizität. Sie ermöglicht es uns, in einer sich ständig verändernden Welt zu überleben.7 Mehrsprachigkeit ist für die Neuroplastizität ein herausragender Faktor, denn in einem Menschenleben gibt es kaum eine intensivere Aktivität als unsere Interaktionen mit Sprache. So kann man zwar mehrere Stunden täglich musizieren oder Sport machen, mit sprachlichen Zeichen beschäftigen wir uns jedoch jede Sekunde auf irgendeine Art und Weise, wenn wir sprechen, hören, denken, träumen, lesen etc. Alle sprachlichen Aktivitäten beanspruchen das gesamte Gehirn, sie sind nicht in einem isolierten Bereich lokalisierbar.8 Ellen Bialystok konnte empirisch nachweisen, dass Mehrsprachigkeit in hohem Maße Prozesse der Selbstregulation und Aufmerksamkeitssteuerung erfordert: „Antworte in der einen Sprache, unterdrücke die andere“9, so lautet die ständige kognitive Konfliktlösungssituation eines mehrsprachigen Kindes. Bei einem bilingualen Kind sind die zwei Sprachen zu einem gewissen Grad ständig aktiviert. Dennoch ist es in der Lage, in der Regel die richtige Sprache im zugehörigen Kontext zu benutzen. Die andere Sprache wird dabei durch einen sog. exekutiven Kontrollprozess unterdrückt. Das Kind entwickelt damit einen Mechanismus der Selbstregulation, der für die kognitive, soziale und motorische Entwicklung zentral ist. Davon ausgehend, dass Mehrsprachige eine besondere Übung in der Kontrolle der Aufmerksamkeit haben, wurden verschiedene kognitive Tests10 zur inhibitorischen Kontrolle durchgeführt.
Die Inhibition oder inhibitorische Kontrolle ist die Fähigkeit, impulsive (oder automatische) Reaktionen zu kontrollieren oder zu hemmen, um durch logisches Denken und Aufmerksamkeit Antworten zu finden. Diese kognitive Fähigkeit zählt zu den exekutiven Funktionen und ermöglicht Antizipation, Planung und Zielsetzung. Die Inhibition blockiert bestimmte Verhaltensweisen und stoppt unpassende automatische Reaktionen, indem eine Antwort durch eine andere ersetzt wird, die besser ausgeklügelt ist und sich besser an die Situation anpasst. 11
Die Ergebnisse zeigen Leistungsvorteile bei Bilingualen. Die entsprechenden Aufgaben lösen sie schneller und mit einer niedrigeren Fehlerquote als Monolinguale. Die Interferenzanfälligkeit von Bilingualen ist niedriger. In der Sprachwissenschaft spricht man von Interferenz, wenn Satzstruktur (Syntax), Wortwahl (Lexik) oder Wortlaute (Phonologie) der einen Sprache mit der anderen interferieren, z.B.: die schöne Mond (auf französisch la lune). Mehrsprachigkeit hat einen positiven Effekt auf die exekutiven Funktionen. Bei diesen Aufgaben sind bilinguale Kinder weniger anfällig für Ablenkung, können sich stärker auf bestimmte Aspekte fokussieren und diese Fähigkeit auf weitere kognitive Aufgaben übertragen.12
Für die allgemeine sprachliche Entwicklung steht fest, dass sich alle gelernten Sprachen auf die jeweils andere(n) auswirken: die L113 auf die L2 bzw. auf jede weitere Ln und umgekehrt, egal ob sie simultan oder konsekutiv gelernt werden. Hierzu ist es relevant, metasprachliche Kompetenzen zu überprüfen, d.h. die Fähigkeit, über die Sprache als System zu reflektieren. Wenn Kinder diese metasprachliche Bewusstheit aufbauen, können sie diese auf alle ihre Sprachen übertragen. Grammatikalitätstests, bei denen Kinder einen Konflikt zwischen Semantik und Grammatikalität zu lösen haben, zeigen, dass Bilinguale leistungsstärker sind.14 Vor allzu pauschaler Generalisierung dieser Ergebnisse ist jedoch Vorsicht geboten, denn neben kognitiven Faktoren spielen auch soziokulturelle und psychologische eine große Rolle, die die kognitiven wiederum relativieren können.
Diese gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen erworbenen Sprachen führt zu der weiterreichenden Frage, in welcher Beziehung Mehrsprachigkeit und soziale Entwicklung stehen. Auffällig ist, dass bilinguale Kinder gewohnt sind, im Alltag von bestimmten Strategien Gebrauch zu machen, um kommunikative Ziele zu erreichen: Bereits in der Phase der Einwortäußerungen15 (bis ca. drei Jahre) sind Kinder bezüglich der Adressatenorientierung in der Lage, L1 bzw. L2 bewusst getrennt und strategisch einzusetzen. Das bedeutet, sie können die sprachlichen Kompetenzen des Gegenübers einordnen und auf Hilfestellungsstrategien zurückgreifen, wie Paraphrasierung, Umschreibung, Erklärung, ansatzweise auch Übersetzung. Dieser postkonzeptuelle Spracheinsatz ist eine pragmatische Strategie, die eine soziale Kompetenz veranschaulicht.
Zu den sozial-kognitiven Fähigkeiten, die sich im Kita-Alter entwickeln, gehört als wichtiger Teil der Alltags- und Entwicklungspsychologie „das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Wissen und Überzeugungen zu berücksichtigen – auch wenn sie mit den eigenen mentalen Zuständen nicht übereinstimmen“.16 In der Mehrsprachigkeitsforschung hat sich bestätigt, dass „solche sozial-kognitiven Leistungen mit dem sich entwickelnden Sprachvermögen in Verbindung stehen.“17 Gudula List sieht das als einen Hinweis auf eine gegenüber Einsprachigen früher und wirkungsvoller herausgebildete Theory of Mind, denn
bilingual bzw. mehrsprachig aufwachsende Kinder pflegen einen selbstverständlichen Umgang mit der Arbitrarität von Sprachzeichen, sie schärfen […] ihre Kontrollprozesse für selektive Wahrnehmungen und sie stellen sich früh darauf ein, die Sprachgewohnheiten ihrer Interaktionspartner zu berücksichtigen. Sie könnten also eine besondere Disposition entwickeln, zu begreifen, dass in anderen Köpfen anderes vorgehen könnte als im eigenen.18
Diese Erkenntnis ist für die soziale Entwicklung von Kindergartenkindern insofern von Bedeutung, als sie einen Hinweis darauf gibt, dass Empathie, strategisches Sich-Hineinversetzen in den anderen und soziale Kompetenz mit dem sich elaborierenden mehrsprachigen Sprachvermögen in Zusammenhang stehen.
Ein letzter hervorzuhebender Punkt betrifft den Zusammenhang von Kreativität und Fantasie mit der kognitiven Entwicklung. Studienergebnisse, wie die des in Israel durchgeführten Experiments Draw a flower and a house that doesn’t exist19, welches in der europäischen Mehrsprachigkeitsforschung rezipiert wurde, weisen darauf hin, dass bilinguale Kinder häufiger Zeichnungen von Fantasiebildern produzieren, wie z. B. eine „Giraffenblume“ oder ein „Stuhlhaus“. Diese Kinder zeigen, dass sie mit übergreifenden Kategorien kreativer umgehen können als monolinguale.
Frage 2
Sind Vorschulkinder beim Erwerb einer dritten oder vierten Sprache überfordert?
Der Bayerische Erziehungs- und Bildungsplan sieht die ersten sechs Lebensjahre als
die lernintensivsten und entwicklungsreichsten Jahre [an]. In diesen Jahren sind die Lernprozesse des Kindes unlösbar verbunden mit der Plastizität des Gehirns, seiner Veränderbarkeit und Formbarkeit; es wird der Grundstein für lebenslanges Lernen gelegt. Je solider und breiter die Basis an Wissen und Können aus jener Zeit ist, desto leichter und erfolgreicher lernt das Kind danach.20
Was hier allgemein artikuliert wird, gilt insbesondere für das Erlernen von Sprachen. In diesem Sinne richten renommierte französische und deutsche Neurowissenschaftler wie Stanislas Dehaene am Collège de France, Boris Cyrulnik von der Université de Toulon-Sud, oder der Neurobiologe und Plastizitätsforscher Tobias Bonhoeffer vom Münchner Max-Planck-Institut für Neurobiologie eine dringende Empfehlung an die Bildungspolitik. Man nimmt an, dass beim Kleinkind pro Sekunde mehrere Millionen synaptische Verbindungen entstehen und auch wieder verschwinden. Die neuronale Plastizität, die zwar ein Leben lang besteht, aber in diesem Zeitfenster optimal erscheint, müsse unbedingt genutzt werden. Den Kindern müsse man in diesem Lebensabschnitt systematisch in den Kindergärten und in der école maternelle den Erwerb von mehreren Sprachen ermöglichen.21 Bereits seit mehreren Jahrzehnten ist bekannt, dass das Gehirn keine sog. ‚Sprachensperre‘ kennt; Kinder können beliebig viele Sprachen lernen.22
Goethes Plädoyer für Mehrsprachigkeit „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen”23 greift die neuere Forschung mit dem Begriff ‚Quersprachigkeit‘ auf. Viel zitiert ist auch der Satz „Eine Sprache ist viele Sprachen“24 des österreichischen Linguisten Mario Wandruszka. Damit meint er, dass jede Sprecherin und jeder Sprecher, auch innerhalb einer Sprache, mehrere Sprachen spreche beziehungsweise auf mehreren Ebenen sprachkompetent sei, was auch als „innere Mehrsprachigkeit“25 bezeichnet wird. Hier muss man verstehen, dass eine Sprache nie als perfektes homogenes Monosystem26 betrachtet werden kann. Sprachgebrauch ist vielfältig, schichten- und gruppenspezifisch, alters- und geschlechtsspezifisch. Jedes Kind, ob mono- oder bilingual, tritt in Kontakt mit Soziolekten und Ethnolekten und schärft seine soziolinguistische Analyse, indem es lernt, diese Varianten einzuordnen. Daher setzt sich die Bilingualismus-Forschung auch mit der Frage auseinander, „ob es sich nicht auch da um Mehrsprachigkeit handelt, wo nicht eigentliche Sprachen, sondern Varietäten ein und derselben Dachsprache involviert sind.“27 Diese innere Mehrsprachigkeit ist ein weiteres Indiz dafür, dass eine äußere Mehrsprachigkeit lediglich von den kommunikativen Kontexten bestimmt wird und Quersprachigkeit fördert. Darunter versteht Gudula List, dass in mehrsprachigen Umgebungen Kinder
eine metasprachliche Reflexion entwickeln, die Aufmerksamkeit auf sprachliche Differenzen richtet. Daraus ergib sich eine quersprachige Kompetenz: Ein fruchtbares Potential, die symbolischen Dienste unterschiedlicher sprachlicher Medien und Register zu erkennen, zwischen ihnen zu unterscheiden, sie womöglich selbst zu mischen oder wechselnd zu benutzen und quer durch sie hindurch zu handeln.28
Gudula List veranschaulicht die Erziehung zu Quersprachigkeit mit dem französischen Didenheim-Projekt.29 Im Feld der Sensibilisierung für Plurilingualität gibt es im Französischen für den Vor- und Grundschulbereich einen methodischen Ansatz, der sich éveil aux langues nennt.30 Dieser wurde von einem europäischen Forscherteam für den Europarat entwickelt. Francis Goulier, dem vorliegendes Buch postum gewidmet ist, hat daran mitgewirkt.31
Wenn innere Mehrsprachigkeit derart selbstverständlich ist, sollte es für Vorschulkinder ein Leichtes sein, diese kognitiven Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbestände auf äußere Mehrsprachigkeit zu übertragen.32 Vor diesem Hintergrund ist „Mehrsprachigkeit […] kein kognitiver Ausnahmezustand.“33 In Frankreich ist von „capacités transversales“ 34 die Rede.
Frage 3
Sollten sich Kinder mit fremdsprachlichem Hintergrund nicht erst die deutsche Sprache aneignen, bevor sie sich einer weiteren Fremdsprache zuwenden?
Diese dritte Frage betrifft die Befürchtung der sog. ‚Halbsprachigkeit‘ und stützt sich auf die Schwellenhypothese der 1980er-Jahre.35 Sie spielte damals in der Debatte über den frühen Fremdsprachenerwerb eine wichtige Rolle und besagt, „dass die Erstsprache über die Schwelle eines bestimmten Niveaus entwickelt sein muss, das für schulisches Lernen disponiert, ehe der Erwerb einer zweiten Sprache sich zu einem Vorteil in der Erwerbsbiographie auswirken kann.“36
Sie ist insofern problematisch, als sie auf einer idealisierten Auffassung von Zweisprachigkeit beruht, das bedeutet: die Entwicklung einer zweiten Sprache wird ausschließlich an eine überschätzte kommunikative Kompetenz in einer Sprecher-Hörer-Konstellation innerhalb einer Erstsprache geknüpft, die dort bereits als idealisiert gilt. Solche modellhaften wie idealisierten Konstrukte bilden aber weder im Fall von Einsprachigen noch von Mehrsprachigen die Realität der sprachlichen Interaktion ab.37 An dieser Stelle merkt Rosemarie Tracy an:
Ein- und Mehrsprachigkeit [sind] Idealisierungen und [stellen] kein absolutes Gegensatzpaar dar. Auch die Vorstellung, die Zeit, die man mit einer Sprache verbringt, ginge einer anderen verloren, geht an den Fähigkeiten des Menschen vorbei, in sprachlicher Hinsicht vieles gleichzeitig zu tun.38
Um diesen Idealvorstellungen entgegenzuwirken, prägte Peter Auer den Begriff der „kompetenten Bilingualität“.
Von kompetenten Bilingualen wird nicht erwartet, dass sie sich je nach Situation in beiden Sprachen wie ein Monolingualer [ausdrücken]. Kompetente Mehrsprachigkeit [stellt] eine eigenständige, primäre sprachliche und interaktionale Kompetenz dar.39
Wichtig hierbei ist die soziale Komponente:
[K]ompetente Bilingualität [ist] kein Privileg der gebildeten Schichten, die es sich sozusagen leisten können, ihre erste Sprache wie Monolinguale zu sprechen, trotzdem aber auch in einer zweiten oder dritten Sprache gut zu funktionieren.40
Die Schnupperstunde greift diese These zur sozialen Dimension kompetenter Bilingualität auf. Im Fall der vorliegenden Untersuchung zu frühem Fremdsprachenerwerb im Rahmen des Programms Elysée 2020 können derartige idealisierte Konstrukte einer quasi perfekten doppelten Einsprachigkeit, wie sie die Schwellenhypothese postuliert, nicht als Zielvorgaben zur Debatte stehen. Die Schnupperstunde Französisch zielt in ihrem Inneren auf soziale und politische Teilhabe, Bildungschancengleichheit, kognitive Stimulation, entwicklungspsychologischen, transkulturellen Mehrwert und nicht zuletzt die Lust am Sprachenlernen. Umso wichtiger ist es, dass sich vermeintlich wissenschaftlich basierte Konzepte wie die oben skizzierte Halbsprachigkeit nicht in den Einstellungen von politischen Akteuren, pädagogischen Kräften oder Eltern festsetzen und, ohne dass dies beabsichtigt sein mag, die Aufmerksamkeit eher auf Defizite als auf erfolgreiches sprachliches Handeln lenken. Als besondere Pointe ist mit Bezug auf die Schnupperstunde Französisch anzumerken, dass 58 Prozent der Kinder in den Elysée-Kitas bereits mehrsprachig sind, wenn sie in Kontakt mit diesem Programm treten. Die Mehrsprachigkeit ist schon da und im Sinne eines positiven Wagenheber-Effekts sattelt die Schnupperstunde noch eine weitere Sprache drauf.
Folgt man der Schwellenhypothese, ließe man kindliche Potenziale zur Mehrsprachigkeit ungenutzt. Ingrid Gogolin kritisiert die „Verschwendung der kindlichen Möglichkeiten zur Sprachaneignung“41 zurecht und betont:
Es gibt keinerlei empirisch untermauerte Zeugnisse dafür, dass Kinder mit der Aneignung von zwei (oder mehr) Sprachen, in denen sie alltäglich leben, überfordert sein könnten. Entscheidend ist, dass die heimische/n Familiensprache/n gepflegt wird/werden, weil eine adäquate frühe Förderung (egal in welcher Sprache) einen wichtigen Prädiktor für den späteren schulischen Erfolg in unserer Gesellschaft darstellt.42
Das führt zur Umkehrung der hier behandelten Frage, nämlich ob Kinder mit Migrationshintergrund in einer zusätzlichen Fremdsprache gefördert werden sollen, anstatt ausschließlich in der Familien- sowie Umgebungssprache, um optimal auf den weiteren schulischen Bildungsweg vorbereitet zu sein. Dazu gibt eine zentrale Erkenntnis aus dem EU-ELIAS-Projekt Early Language and Intercultural Acquisition Studies43 Aufschluss, die zeigt, dass die Variable Migrationshintergrund per se keinen Einfluss auf den Erwerb einer neuen Sprache in Kitas ausübt, wenn man sie isoliert betrachtet. Testergebnisse zur Entwicklung der rezeptiven Fähigkeiten im Bereich des englischen Wortschatzes und der englischen Grammatik zeigen exemplarisch, dass die Leistungsunterschiede primär auf den soziokulturellen und ökonomischen Hintergrund sowie auf das Interesse an Bildung zurückzuführen sind, nicht auf Migration. Das heißt mit anderen Worten, Migration ist kein Argument, das gegen die Teilnahme an der Schnupperstunde Französisch bei Kindern aus entsprechend disponierten Familien spricht. Als zweite Erkenntnis aus dem Projekt kann man festhalten, dass das Immersionsprinzip für Kinder mit Migrationshintergrund sogar vorteilhaft ist, weil sie die weitere Fremdsprache immersiv wie die Muttersprache erwerben. Auf die Schnupperstunde bezogen könnte dies bei entsprechender Immersion bedeuten, dass diejenigen, die neben dem Deutschen bereits eine Sprache beherrschen, der dritten Sprache – Französisch – offenbar unbekümmert begegnen.44
An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass der öffentliche Diskurs mit den Begriffen ‚fremdsprachlicher Hintergrund‘ und ‚Migrationshintergrund‘ oft einen etwas undifferenzierten Umgang pflegt. Nach der Definition des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat „eine Person […] einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde“.45 Dass Migration nicht unbedingt mit fremdsprachlichem Hintergrund und fremdsprachlicher Hintergrund nicht zwangsläufig mit Migration gleichzusetzen ist, zeigt die Migration aus dem frankophonen Raum nach Frankreich. Im Folgenden werden die Begriffe differenzierter verwendet, je nachdem, ob die soziologische oder die sprachliche Perspektive von Interesse ist, wenn auch ab und an Überlappungen an den Schnittstellen unumgänglich sind.
Eine weitere berechtigte Frage, die bei Kindern mit fremdsprachlichem Hintergrund öfter formuliert wird, und im weiteren Kontext der Schwellenhypothese steht, betrifft den Zugang zur Bildungssprache und seinen präsupponierten Beitrag zum Bildungserfolg. Die Forschungsgruppe Mehrsprachigkeit um Ingrid Gogolin ging im Rahmen des Hamburger Modellprogramms „Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund FörMig“46 dieser Fragestellung nach und stellte fest:
Gesprächspraktiken, die auf das Register Bildungssprache vorbereiten, [sind] in bildungsorientierten Familien anzutreffen, kaum aber in eher bildungsfernen Familien. Während die ersteren ihre Kinder eher mit sprachlicher Varianz vertraut machen und entscheidungsoffene Kommunikationsstile pflegen, wird den Kindern in bildungsärmeren Familien durch starke Rahmung und Einengung des Sprechens wenig Raum für den experimentellen Umgang mit Sprachvarianz gelassen.47
Die Fokussierung auf den rein fremdsprachlichen Hintergrund scheint daher ziemlich irreführend. Wenn befürchtet wird, dass Kindern die adäquaten Kommunikationsmittel fehlen, liegt das möglicherweise nicht nur am Defizit in der L2 Deutsch, sondern daran, dass der gesamte bildungsrelevante Kanon einschließlich der allgemeinen Sprachfertigkeiten defizitär ist, weshalb soziokulturelle Faktoren berücksichtigt werden müssen:
Die bloße Teilnahme an zielsprachlichem (deutschsprachigem) Unterricht bei Kindern mit Migrationshintergrund genügt [nicht, um] substanzielle bildungssprachliche Kompetenzen aufzubauen. Vielmehr bedarf es dafür eines kognitiv aktivierenden, unterstützenden und die Divergenz alltäglicher und bildungssprachlicher Redemittel explizit thematisierenden Unterrichts.48