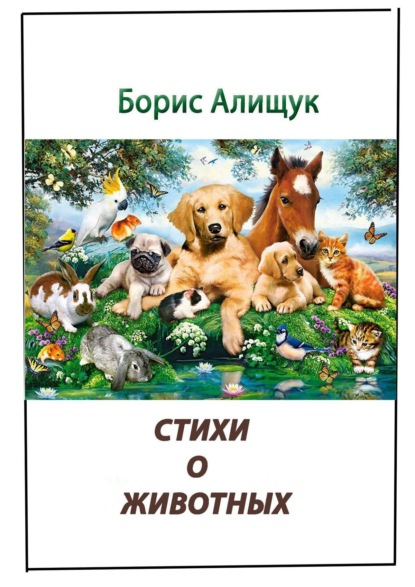Frühkindlicher Fremdsprachenerwerb in den " Elysée-Kitas "
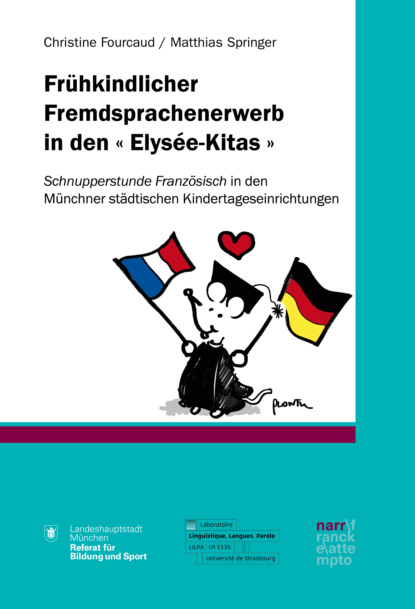
- -
- 100%
- +
Inwiefern schließlich früher Fremdsprachenerwerb zu sozialer wie kultureller Inklusion beitragen kann, lässt sich aus Studien zu Bildungschancengleichheit und Partizipation herleiten. Die empirische Forschung warnt vor sogenannten „additiven Effekten“, d.h., „weist ein Kind einen Migrationshintergrund auf und besitzt zugleich einen niedrigen Sozialstatus, bedeutet dies auch ein zusätzliches Risiko, nicht an frühkindlicher Bildung zu partizipieren.“49
Die Landeshauptstadt München50 zeigt, wie wichtig ihr Anliegen ist, indem sie sich auf die UN-Kinderrechtskonvention (Art. 28) bezieht und „das Recht auf Bildung von Anfang an und das Recht auf umfassende Mitsprache und Mitgestaltung“51 betont. Mit Blick auf Inklusion sind laut WIFF52 Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland aktuell tatsächlich stärker gefährdet, Barrieren für einen Zugang zur Bildung zu erfahren, als Kinder ohne Migrationshintergrund. Aber auch Auswirkungen sozialer Segregation beeinflussen die Lebenslagen von Kindern. Jens Kratzmann spricht in diesem Fall von „sozialer und migrationsgekoppelter Ungleichheit“53.
Der Versuch, diese Barrieren mithilfe der Inklusionspädagogik zu überwinden, löst konfliktreiche Widersprüche aus. Diese befindet sich in mehreren Dilemmata zwischen dem Wunsch nach Individualisierung einerseits, Standardisierung und Verbindlichkeit andererseits; zwischen Offenheit für kindliche Heterogenität einerseits, Vermittlung elementarer Werte und standardisierter Kulturtechniken andererseits; zwischen dem Wunsch nach Hervorheben der Einzigartigkeit einerseits und der Integration in soziale Systeme andererseits.54 Die städtischen Kindertageseinrichtungen stellen sich diesen Widersprüchen, indem sie sich intensiv mit der inklusiven Pädagogik auseinandersetzen. Sieht man die Schwellenhypothese in Wechselwirkung zu sozialen Faktoren, steht sie den Zielen der Inklusion und Teilhabe sowie der angestrebten Bildungschancengleichheit entgegen.
1.2 Elitäre und inklusionsfördernde Modelle für Schlüsselkompetenzen im europäischen Bildungsraum
Die fremdsprachliche Kompetenz wird von der Europäischen Kommission im „Europäischen Referenzrahmen für lebenslanges Lernen“ als eine der acht Schlüsselkompetenzen definiert1. Dieser Grundsatz geht auch als Leitgedanke aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan hervor2, der bereits seit mehreren Jahren die Kindertageseinrichtungen zu einer frühpädagogischen Sprachförderung ermutigt, welche die „Neugierde auf fremde Sprachen […] entwickelt und Mehrsprachigkeit als Bereicherung und Lebensform“ 3 ansieht. Heutzutage gelte als konsensfähiges Bildungsziel, dass „die Entwicklung von Zwei- und Mehrsprachigkeit wesentlich zur sprachlichen Bildung [gehört], dass Wertschätzung und Förderung von Mehrsprachigkeit und ‚Deutsch lernen‘ kein Widerspruch [sind], sondern Zielsetzungen, die sich gegenseitig ergänzen.“4
In München wie bundesweit muss den immer vielfältigeren Bildungs- wie Sprachbiografien der Familien Rechnung getragen werden, was die Entwicklung von innovativen mehrsprachigen Sprachbildungskonzepten erfordert. Wer in dieser anspruchsvollen Herausforderung eine potenzielle Bereicherung sieht, kann den Kindern faire Startbedingungen ermöglichen und eine Chance geben, sich die mehrsprachige Gesellschaft zu erobern. Wie dringend in dieser Hinsicht der Aspekt der Bildungschancengleichheit erscheint, erkennt man mit einem Blick auf die Ergebnisse der letzten PISA-Studie. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnt davor, dass „die Schule zur Sozialfalle“5 wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier meinte dazu:
In Deutschland entscheidet noch immer häufig die soziale Herkunft über die Bildungschancen von Kindern […]. Bessere Bildung braucht entschiedeneres Handeln […]. Wir müssen diese Ungleichheiten abbauen, und das ist eine Aufgabe, die die Schulen nicht allein leisten können.6
Eine explizite Integration von Mehrsprachigkeit, die sowohl Migrations- als auch Familiensprachen berücksichtigt, existiert im Konzept des Städtischen Trägers in Bayern zwar noch nicht. Zu erwähnen wäre jedoch das IMKi-Projekt „Effekte einer aktiven Integration von Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen“7, eine Interventionsstudie des BMBF in 19 Kindertageseinrichtungen in Bayern und Baden-Württemberg. Untersucht wird, welche Faktoren für eine gelingende (mehr)sprachliche Entwicklung von Kindern im Kindergartenalter bedeutsam sind. Das BMBF will erfahren, welche Veränderungen sich in der erst- und zweitsprachlichen Kompetenzentwicklung der Kinder ergeben, wenn Mehrsprachigkeit explizit in die Einrichtungen integriert wird.8 Die Migrationssprachen Türkisch, Russisch und Polnisch werden exemplarisch untersucht. Die weiteren Forschungsfragen lauten: Wie verändert sich die sozio-emotionale Entwicklung der Kinder bei Einbezug von Mehrsprachigkeit? Welche Veränderungen auf Einrichtungsebene sind auf die pädagogische Intervention zurückzuführen? Lässt sich durch die Integration von Mehrsprachigkeit eine Erhöhung der Zufriedenheit der Eltern mit der Integration in die Einrichtung erreichen?9 Es bleibt zu wünschen, dass diese explizite Integration von Mehrsprachigkeit nicht nur im Rahmen von wissenschaftlichen Studien erfolgt, sondern allgemein und flächendeckend etabliert wird.
Im Fokus der Politik stehen dem gegenüber zahlreiche Sprachförderprogramme in DaF/DaZ für Kinder mit Migrationshintergrund,10 die die Kinder jedoch zu einer Quasi-Monolingualität führen.11 Das aktuelle Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“12 – um nur eines zu nennen – erkennt, dass
sprachliche Kompetenzen einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben haben. Dies gilt besonders für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund.13
Wie bereits unter 1.1 diskutiert, ist grundsätzlich anerkannt, dass die L1 unter dem frühen Erwerb einer weiteren (Fremd-)Sprache nicht leidet. Im Gegenteil: Wie Studien gezeigt haben,14 profitieren beide Sprachen der Kinder von dem erhöhten Sprachbewusstsein. „Kinder mit Migrationshintergrund stehen dabei nicht so sehr im Hintertreffen wie oft befürchtet“, lautet auch ein Ergebnis des ELIAS-Projektes der Europäischen Kommission.15
In vielen Bundesländern – auch im Freistaat Bayern – verlangen nun die Bildungspläne, dass die zwei und mehrsprachigen Kompetenzen der Kinder aktiv entwickelt werden: „Es gilt, die spezifischen Entwicklungsprofile und Bedürfnisse von mehrsprachig aufwachsenden Kindern wahrzunehmen und zu nutzen.“16 Dies kann z.B. durch die Einbindung bilingualer Konzepte geschehen.17 In Sachsen-Anhalt geht es etwa laut Bildungsplan insbesondere darum, „jedem Kind erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Sprachen zu ermöglichen“.18
Dem bilateralen Förderprogramm für frühen Fremdsprachenerwerb Elysée-Kitas soll genau dieser Spagat zwischen Abbau von Barrieren zur Bildungschancengleichheit und Vermittlung von Schlüsselkompetenzen gelingen. Der Zugang zur französischen Sprache wird als bildungsfördernd und chancenreich angesehen. Mit der finanziellen Unterstützung der LH München und des grundsätzlich uneingeschränkten Zugangs für alle Kinder zu diesem Angebot soll soziale und kulturelle Diskriminierung in dem Sinne vermieden werden, dass bereits in Kindertageseinrichtungen geringere Erwartungen an sozial benachteiligte Kinder mit Migrationshintergrund gerichtet werden, die sich schließlich im weiteren Bildungsverlauf verfestigen und somit die Bildungslaufbahnen von Kindern beeinträchtigen.19
Die meisten der über 100 Kindertageseinrichtungen20 in Bayern mit Mehrsprachigkeitsmodellen im Vorschulbereich stehen unter freier Trägerschaft. Dabei handelt es sich mehrheitlich um privatwirtschaftliche Angebote, d.h. Angebote von Anbietern, die mit entsprechend hohen Gebühren verbunden sind und eine ökonomisch wie sozial eher privilegierte Bevölkerungsschicht ansprechen. Oft arbeiten sie immersiv, meistens für ein bereits bilinguales Publikum, das seine Familiensprache fördern möchte. Eine immer breitere Kundschaft finden bilinguale Einrichtungen mit einem englischen oder chinesischen Zweig,21 die darin allerdings mehr einen ökonomischen Wettbewerbsvorteil für ihre Kinder sieht, als ein rein kulturelles, soziales oder familiäres Anliegen damit verbindet.22
Bei den Sprachen nimmt bundesweit – auch in Bayern – Französisch den zweiten Rang ein.23 Unter Berücksichtigung des deutsch-französischen Netzwerks der Elysée-Kitas – dürften sich die Sprachangebote für Englisch und Französisch nun aber nahezu angeglichen haben.
2 Das bilaterale Programm Elysée-Kitas 2020 / écoles maternelles Elysée 2020: Verortung im europäischen Bildungsraum
Will man verstehen, wie sich einerseits das Pilotprojekt Deutsch-Französische Elysée-Kitas 2020 in diesem Zusammenhang darstellt und warum andererseits nicht alle Kindertageseinrichtungen mit Französischangeboten im Netzwerk der Elysée-Kitas aufgenommen wurden, muss man der Genese dieses bilateralen Pilotprojektes nachgehen. Zum 50. Jubiläum des Elysée-Vertrags1 unterschrieben der französische Bildungsminister (Ministre de l’Education Nationale) Vincent Peillon und die Bevollmächtigte der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten, Annegret Kramp-Karrenbauer, im Jahr 2013 die bilaterale Vereinbarung Deutsch-Französische Elysée-Kitas 2020.2 Die bildungspolitischen Zielsetzungen der Elysée-Kitas sind in einer sogenannten Qualitätscharta festgelegt: Deutschland und Frankreich sehen sich als „Vorreiter und Motor beim Aufbau eines gemeinsamen europäischen Bildungsraums“, wollen mit dem „frühkindlichen Erlernen der Partnersprache […] die gegenseitige Verständigung“ weiter vertiefen und ein „dauerhaftes Freundschafts- und Vertrauensverhältnis“ vom jüngsten Kindesalter an aufbauen. Die Deutsch-Französische Agenda 2020 ist insofern konsequent, als sie auf dem „Strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung“ basiert. Bereits im März 2002 formulierte der Europäische Rat diese Forderung als Instrument der Chancengleichheit und der europäischen Integration:
Angesichts der Bedeutung des Erwerbs von zwei Fremdsprachen ab einem frühen Alter, auf die in den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates von Barcelona hingewiesen wird, wird die Kommission ersucht, dem Rat bis Ende 2012 einen Vorschlag für eine mögliche Benchmark in diesem Bereich, die auf den laufenden Arbeiten zur Sprachenkompetenz aufbaut, vorzulegen.3
Von der Grundannahme geleitet, dass im Bereich ‚Sprachbildung‘ auch die Frühpädagogik einen eigenen Beitrag zu leisten habe, stellte sich für die LH München die Frage, wie das Konzept Elysée-Kitas für ein breites Publikum umgesetzt werden könnte. Im Oktober 2014 führte die LH München im Sinne der Bildungschancengleichheit und Inklusion dieses Pilotprojekt in die städtischen Kindertageseinrichtungen ein. Ausgangspunkt des Städtischen Trägers war, das Angebot für Kinder ohne Französischkenntnisse kostenfrei in den Einrichtungen zu implementieren. Damit trug er auch der Erkenntnis der Sprachpsychologin Gudula List, „das Gehirn hat Platz für viele Sprachen“, Rechnung.4 Die zweite Zielsetzung dieses Pilotprojektes war darüber hinaus, einen Beitrag zur Integration von Migrationskindern mit Familiensprache Französisch zu leisten, da man hier 2014 einen Bedarf vermutete. Tatsächlich zeigen die Zahlen rückblickend, dass über ein Drittel der in München angemeldeten afrikanischen Migrantinnen und Migranten aus dem frankophonen Afrika stammten.5
2.1 Schwerpunkte der französischen Analyse
Auf der französischen Seite des Netzwerks der Écoles maternelles Elysée 2020 erfolgte eine Evaluation im Auftrag des französischen Bildungsministeriums. Sie wurde intern durch die Generalinspektion des Bildungsministeriums durchgeführt und im Dezember 2018 veröffentlicht.1 Die kleine Stichprobe aus acht freiwilligen französischen Vorschulen (écoles maternelles) bildete die Basis für eine Bestandsaufnahme des gesamten französischen Netzwerks, welches damals aus 73 Vorschulen bestand. Die Schwerpunkte der Analyse ergaben sich aus einem institutionellen Interesse des französischen Bildungsministeriums. Die Studie ist keine sprachwissenschaftliche Analyse, eher eine deskriptiv-präskriptive institutionelle Berichterstattung.
Obwohl die Münchner Untersuchung andere Schwerpunkte setzt, zeigen sich in der Durchführung thematische Schnittstellen, die im Sinne des bilateralen Projektes zukünftig gemeinsam und komplementär bearbeitet werden können. Sie werden im Folgenden knapp vorgestellt.
2.1.1 Lernfortschritt im Spracherwerb
Zur Messung des Lernfortschritts werden aus den Kompetenzbereichen Sprechen und Hörverstehen didaktische Zielsetzungen definiert. In der Anlage zur französischen Analyse werden die Sprachstanderhebungsbögen aus der Grenzregion Elsass-Lothringen1 exemplarisch präsentiert. Sie sind nicht für ganz Frankreich repräsentativ. Gerade weil sie nur in der Grenzregion angewendet werden, ist es interessant, sie mit denjenigen zu vergleichen, die für die Münchner Untersuchung entwickelt wurden. In der Anlage findet man auch ein Zeugnisheft für die bilinguale Vorschule. Innovativ dabei ist die vollständige Integration des Deutschunterrichts im Schulzeugnis des französischen Bildungsministeriums. Lern- und Arbeitsverhalten sowie die Sprachkenntnisse und kommunikativen Kompetenzen werden beurteilt und benotet. Das französische Schulzeugnis für die Vorschule weist mit dem KOMPIK-Beobachtungsbogen2 Gemeinsamkeiten auf. Bei Ersterem liegt der Schwerpunkt stärker auf Bildung und Kompetenzen, denn auf Entwicklung und Interessen. Grundsätzlich war seitens des Bildungsministeriums eine Evaluation der Kompetenzen anhand des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) erwünscht. In ihrer Bestandsaufnahme der besten Praktiken zur Evaluation von Spracherwerb und Progression registrierten die Autorinnen der Studie punktuelle Initiativen der Schulleitungen oder Schulinspektionen mit dieser Zielsetzung entweder in der dritten Klasse der Vorschule (grande section de maternelle) oder in der ersten bis vierten Klasse der Grundschule. Dies weist eine Kontinuität des Angebots nach.
2.1.2 Kontinuität des Angebots
Die Kontinuität des Angebots ist für das französische Bildungsministerium Dreh- und Angelpunkt des Modells. Die Kinder sollen in der Grundschule und den weiterführenden Schulen die Möglichkeit haben, schulischen Deutschunterricht zu besuchen und im Idealfall deutsch-französische Curricula in bilingualen oder europäischen Zweigen zu absolvieren. In den Grenzregionen ist die Möglichkeit bereits gegeben, das Bildungsministerium legt jedoch für ganz Frankreich Wert darauf.
Wir möchten die von beiden Ländern eingeleiteten Maßnahmen zur Förderung des Erlernens der Partnersprache vertiefen, insbesondere durch die Schaffung bilingualer Klassen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in der Schullaufbahn der Kinder und Jugendlichen, ebenso wie durch den Ausbau von Abibac-Zweigen1im Gymnasium, die gleichzeitig zum französischen Baccalauréat und zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur) führen.2
Deutschland und Frankreich verfügen über ein Netzwerk von 194 Hochschuleinrichtungen, die aktuell 180 integrierte binationale und trinationale Studiengänge unter dem Dach der Deutsch-Französischen Hochschule anbieten. Allein in Bayern werden 64 deutsch-französische Studiengänge angeboten3. Aus französischer Perspektive ist der Anspruch auf deutsch-französische bilinguale Kontinuität von der Vor- bis in die Hochschule hinein eine Priorität der deutsch-französischen Bildungskooperation.
2.1.3 Fort- und Weiterbildung des Personals
In den französischen Vorschulen wird der Deutschunterricht von französischen Grundschul- oder Gymnasiallehrkräften, punktuell auch von Sprachassistentinnen und -assistenten oder Austauschlehrkräften aus Deutschland verwirklicht. Wenn Nichtmuttersprachlerinnen und Nichtmuttersprachler diese Aufgabe übernehmen, stellt sich die Frage der Aus- bzw. Fortbildung. Aus didaktischer Perspektive wurde ein Fortbildungsbedarf identifiziert, u. a. zur Pädagogik des frühen Fremdsprachenerwerbs, zu Mehrsprachigkeit sowie zum Umgang von Kindern mit Fremdsprachen. Auch Deutschkurse für die Lehrkräfte würden benötigt.
An dieser Stelle fördert das Ministerium Personalmobilität und den Austausch von Lehrkräften, vom französischen Bildungsministerium ist auch die Konzeption eines Aufbaustudiengangs für frühen Fremdsprachenerwerb angedacht.1 Als Thinktank für didaktisches Material hat sich das grenzüberschreitende Zentrum Saint Avold2 etabliert. Qualifizierte Personalressourcen zu finden, stellt nicht nur auf der französischen Seite die größte Herausforderung dar. Da jedoch für die deutsch-französischen Abibac-Zweige das Problem der Personalausstattung erfolgreich gelöst wurde, sollte es ebenfalls möglich sein, für die Vor- und Grundschule diese nicht ganz neue Problematik bilateral aus der Welt zu schaffen. 3
2.1.4 Kontakte mit den Partnereinrichtungen
Dank dem Kontakt zu den Partnereinrichtungen soll den Kindern konkret und handlungsorientiert vorgeführt werden, wozu sie Deutsch lernen, damit das sprachliche und kulturelle Projekt mit Authentizität gefüllt wird. Angesichts des Alters der Kinder lassen sich außerhalb der Grenzregionen die Kontakte zu den Partnereinrichtungen nicht in situ organisieren. Sowohl klassische als auch moderne Medien werden zu Hilfe genommen: Zeichnungen, Bastelarbeiten, O-Ton- bzw. Videoaufnahmen, Skype, eTwinning-Projekte usw.
2.2 Europa beginnt im Kleinen: Elysée-Kitas in München
2.2.1 Implementierung beim Städtischen Träger
In Absprache mit den jeweiligen Einrichtungen wurden im Oktober 2014 in zunächst fünf Kindertageseinrichtungen (Kitas) unter städtischer Trägerschaft für 3- bis 6-Jährige ohne Vorkenntnisse altersgerechte Aktivitäten auf Französisch angeboten. Hierfür wurde nach qualifizierten muttersprachlichen Lehrkräften mit Erfahrung in der Frühpädagogik gesucht. Auf der Basis einer öffentlichen Ausschreibung wird das Angebot seither durch den externen Dienstleister Institut Français in Form einer wöchentlichen sog. Schnupperstunde Französisch durchgeführt. Grundsätzlich für alle Kinder offen, beruht das Angebot auf Freiwilligkeit und ist dem Konzept der jeweiligen Häuser angepasst.
Die hier gewählte Terminologie „Schnupperstunde“ bedarf einer Erklärung. In diesem Begriff kristallisiert sich das konzeptuelle Grundverständnis der Umsetzung beim städtischen Träger deutlich heraus. Entgegen der französischen Herangehensweise der école maternelle, die Regelmäßigkeit, Verbindlichkeit und Kontinuität als Leitlinie favorisiert, sollte die Schnupperstunde zunächst freiwillig besucht werden können, die freie Selbstbestimmung der Kinder trat in den Vordergrund. Bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung hat sich das Konzept in den städtischen Kindertageseinrichtungen weiterentwickelt1, was die Autoren der vorliegenden Studie dazu führt, in den Handlungsempfehlungen dazu Stellung zu nehmen2.
Ursprünglich sollten die Leistungen in folgenden fünf Einrichtungen im Stadtgebiet München erbracht werden:
Sandstr. 22
Corneliusstr. 17
Himbselstr. 1
Müllerstr. 5
Stielerstr. 63
Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Studie blieb die Konstellation der teilnehmenden Einrichtungen weitgehend stabil. Aufgrund der positiven Resonanz des Pilotprojektes sind die wöchentlichen Module inzwischen in acht Kindertageseinrichtungen implementiert: Sandstr. 22, Corneliusstr. 17, Reitmorstr. 41, Müllerstr. 5, Lanzenstielweg 14, Dietzfellbingerplatz 7, Fallmerayerstr. 2 und Hort4 Nimrodstr. 2.
Mit dem Institut Français wurde vertraglich festgelegt, wie viele 45-minütige Einheiten von Oktober 2018 bis Juli 2019 (d.h. für etwa ein Kindergartenjahr) für Kindergruppen mit max. zehn Kindern anzubieten waren. Die LH München subventionierte die Module, da dieses freiwillige fremdsprachliche Bildungsangebot für die Teilnehmenden frei von zusätzlichen Gebühren bleiben sollte. Je nach Kapazität und Resonanz in den jeweiligen Einrichtungen wurde der Umfang der Einheiten angepasst und auf verschiedene Kindergruppen aufgeteilt.
Die Besonderheit der Kurse lag darin, auch Eltern zu beteiligen.5 Hiermit wird an die erwünschte Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern unter dem Aspekt angeknüpft, dass „sozial benachteiligte Familien und Migrantenfamilien in die Kindertageseinrichtung durch gezielte Ansprache und besondere Angebote“6 explizit eingebunden werden sollen. Wenn „ungünstigere Startchancen nicht genuin migrationsbedingt sind, sondern auf eine ungünstige sozialstrukturelle Position der Eltern zurückzuführen [sind]“,7 ist tatsächlich zu erwarten, dass bildungsnahe Familien rasch den Mehrwert eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebots wie dem der Schnupperstunde Französisch erkennen und ihre Kinder davon überzeugen, daran teilzunehmen. Eltern, die das deutsche Bildungssystem durchliefen, wissen außerdem, dass in Deutschland Französisch nach Englisch die am häufigsten gelernte Sprache ist und in der EU als bildungsrelevante Fremdsprache gilt.8
Fallen Migration und Bildungsferne zusammen, spricht man in der Forschung von „soziale[r] und migrationsgekoppelte[r] Ungleichheit“.9 Werden von Erzieherinnen höhere Erwartungen an Kinder gestellt, potenziert das ihre Leistungsmotivation. Damit kann der sog. „institutionellen Diskriminierung“10 entgegengetreten werden. An dieser Stelle ist es Aufgabe der Einrichtung, Eltern, die sich der Stellung und des Bildungspotenzials der französischen Sprache nicht bewusst sind, von diesem Angebot zu überzeugen. Vom pädagogischen Personal wird erwartet, dass es an alle Kinder mit und ohne Migrationshintergrund unabhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern die gleichen Erwartungen hat. Alle Eltern sollten dezidiert miteinbezogen werden, um einer Verstärkung von Ungleichheiten entgegenzusteuern. Kindertageseinrichtungen sind zwar, anders als Grundschulen oder französische Vorschulen, keine primär leistungsorientierten Institutionen. Nichtdestotrotz „kann der Kindergarten als Bildungsort verstanden werden, der zwar nicht leistungsorientiert ist, aber für die Grundlegung des späteren Schulerfolgs mehr oder weniger förderlich sein kann.“11
Vor diesem Hintergrund wurde in der von der LH München ausgeschriebenen Leistungsbeschreibung ein großes Augenmerk sowohl auf die Qualität als auch auf die Originalität des von den Bewerbern vorgeschlagenen Konzepts gelegt. Das Institut Français bietet zusätzlich zum Konzept für die Schnupperstunde monatliche partizipative Eltern-Kind-Workshops am Institut Français an, welche für die am Pilotprojekt Teilnehmenden vorgesehen sind.12 Für die LH München ist dies ein interessantes Angebot. Aufgrund früherer guter Zusammenarbeit und seines Status als kulturelle Einrichtung des französischen Auswärtigen Amtes erhielt das Institut Français den Auftrag für das Pilotprojekt und führt diesen bis heute aus. Gesucht war ein Kooperationspartner, der nicht kommerziell handelt und befugt ist, den Städtischen Träger im Austausch mit den französischen écoles maternelles, also mit dem französischen Bildungsministerium, direkt zu unterstützen. Bildungskooperation gehört zum Auftrag des Institut Français.
Die Aufnahme der städtischen Münchner Einrichtungen ins bundesweite Netzwerk Elysée-Kitas und deren Zertifizierung auf der Grundlage der Deutsch-Französischen Qualitätscharta für bilinguale Kindertageseinrichtungen konnte nach der ersten erfolgreichen Antragsstellung der Regierung von Oberbayern ab dem Jahr 2016 erfolgen. Damit sind inzwischen sieben Münchner Einrichtungen Teil des bilateralen Netzwerks „Elysée-Kitas – écoles maternelles 2020“, welches bis dato 164 deutsche Kindertageseinrichtungen und 98 französische écoles maternelles zertifiziert hat.13 Der achte Antrag für eine Münchner Einrichtung liegt vor.