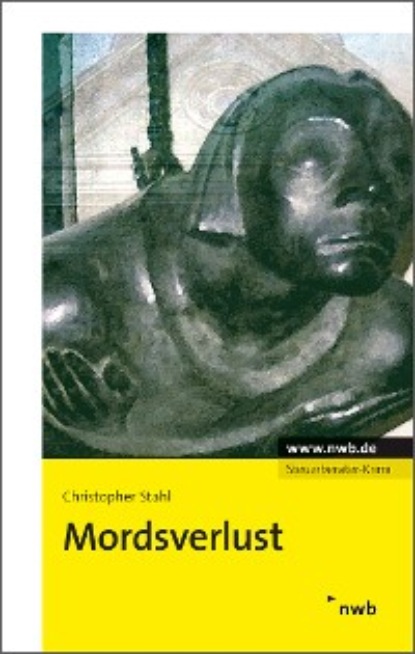- -
- 100%
- +
Er war aufgestanden, um den Tisch gegangen und hatte sich neben mich gestellt. „Steh einmal auf, Darius!”
Verdutzt über diese unerwartete Reaktion kam ich seiner ungewöhnlichen Aufforderung, ohne sie zu hinterfragen, nach. Er machte einen Schritt auf mich zu und umarmte mich. Dann schob er mich ein Stück von sich weg und sagte: „Bravo! Das ist genau die richtige Entscheidung, die war schon lange überfällig. Ich gratuliere dir.”
Ich musste ihn äußerst perplex angesehen haben.
„Heh, versteh mich nicht falsch. Ich freue mich nicht, dass du aufhörst. Ich freue mich für dich und Sonja. Ich habe dir viel zu verdanken und viel von dir gelernt Ich werde damit klarkommen müssen und auch klarkommen.”
„Na ja, wenn du dann einmal meine Hilfe benötigst …”
„Nein, mein Lieber. Das würde dir so passen. Kneifen gilt nicht!”, lachte er. „Wie hast du eben noch so schön gesagt? Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Oder wie wir hier sagen: Wasch mich, abber mach mer de Pelz nedd nass – dess geht hald nedd.”
Erleichtert ging ich zurück in mein Büro, um Gertrud Faber anzurufen. Wir waren im gleichen Alter. Ihr Mann war vor fast30 Jahren bei einem Unfall auf dem Weingut Preuß, hier in Bernheim, umgekommen. Er war mit der Ehefrau des Winzers wegen einer Inventaraufstellung im Weinkeller, als irgendeine Maschine explodierte und beide dabei tödlich verletzt wurden. Seitdem führte Gertrud die Kanzlei alleine. Ihre Tochter Renate hatte vor 15 Jahren ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei mir absolviert und war später zur Polizei gegangen – Kommissariat für Wirtschaftskriminalität. Sie war ein liebenswertes, hübsches und intelligentes Mädchen und Gertruds Ein und Alles. Vor fünf Jahren hatte sie den Enkel der Frau, die mit ihrem Vater umgekommen war, geheiratet; jetzt hieß sie Renate Dohne. Nicht nur das Mandat, sondern vor allem das gemeinsame Schicksal hatte die Familien enger zusammengeführt.
Gertrud hatte mir irgendwann einmal erzählt, dass Renate inzwischen ihren Dienst bei der Polizei quittiert hatte, da sie auf dem florierenden Weingut jede Hand benötigten. Sie kümmerte sich um die Buchhaltung.
Ich wählte Gertrud Fabers Privatnummer. Das Gefühl, dass mir plötzlich ein Stein vom Herzen gefallen war, drückte sich in Heiterkeit aus, die ich gerne teilen wollte: „Na, Gertrud, meine Gute, was kann ich für dich tun?”
„Schön, dass du zurückrufst. Ich habe ein ganz besonderes Problem, mit dem ich nicht klarkomme.” Ihre Stimme klang bedrückt. Ich kannte das. Man wälzte berufliche Fragestellungen, verrannte sich und sah vor lauter rechtstheoretischen Bäumen den Wald der praktischen Umsetzung nicht mehr.
„Um was geht es? Umsatzsteuer? Einkommensteuer? Vorweggenommene Erbfolge? Betriebsübergabe? Abschreibungen? Gesellschaftsrecht? Sprich dich aus! Manches Mal löst sich alles in Luft auf, in frische Luft.”
„Das aber nicht, Darius. Ich benötige keinen fachlichen Rat. Ich habe ein ganz anderes Problem. Es ist etwas passiert und ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll, weil du sie doch auch kennst.”
„Wen meinst du mit sie?”
„Renate. Sie ist verschwunden, seit einer Woche … spurlos.”
24 Wochen später, Samstag, 24. September 2005
Sonja war über das Wochenende zu einer Weiterbildungsveranstaltung rheinland-pfälzischer Gymnasiallehrer gefahren. Der Termin hatte zwar schon zu Beginn der Sommerferien festgestanden, aber entweder hatte ich ihn verdrängt oder tatsächlich vergessen. Ich hasste die leeren Wochenenden ohne Sonja. Daher reagierte ich auch entsprechend verdrießlich, als sie mich kurzfristig damit konfrontierte und mit spitzem Zeigefinger auf unseren überdimensionalen Terminplaner deutete, den sie an der Seitenwand unseres Kühlschrankes befestigt hatte und sorgfältig aktualisierte.
„Ab und zu einen Blick auf den Kalender erspart so manche Überraschung”, philosophierte sie. „Wenn du unsere eigenen Termine genau so beachten würdest, wie die in deiner Kanzlei …”, den Rest ließ sie in der Luft schweben. Ich wusste auch so, was sie meinte. Meine erste Ehe mit Beatrice war schließlich vor acht Jahren genau wegen derartiger „Störungen im privaten Betriebsablauf” gescheitert.
Seit zwei Jahren lebten Sonja und ich in meinem kleinen, ehemaligen Winzerhof in Bernheim zusammen und ich gab mir redlich Mühe, die Fehler der Vergangenheit in unserer Beziehung nicht zu wiederholen, auch wenn genetisch verankerte Verhaltensmechanismen, die Männern, und so auch mir, nun einmal zu eigen waren, immer einmal wieder durchschlugen.
Andererseits waren es an diesem Wochenende Sonjas berufliche Termine, die unsere Privatheit störten, und darauf wies ich sie auch maulig hin.
„Der PISA-Studie muss Tribut gezollt werden”, erklärte sie mir tadelnd. „Unser überirdischer Kopulationskult am Sonntagmorgen wird also bis nächste Woche warten müssen”, hatte sie mir schließlich am Freitagnachmittag zum Abschied aus dem offenen Wagen noch zugerufen, wobei sie diese intime Ansage in der Phonzahl eines durchstartenden Düsenjägers von sich gegeben hatte.
Eine Nachbarin, die das freizügige Abschiedsgeplänkel von ihrem Fenster aus beobachtete, winkte mir fröhlich zu. Ich entgegnete ihren Gruß mit dem nichtsagendsten Gesichtsausdruck, dessen ich fähig war. Dabei hoffte ich inständig, dass die Verwunderung darüber, was eine Mathematiklehrerin und ein Steuerberater wohl mit der Veredelung von Reben zu tun haben könnten, noch dazu am heiligen Sonntagmorgen, zu keinen weiteren Gedankenspielen anregen würde.
Aber Sonja wäre nicht meine Sonja, wie sie leibte und lebte, wenn sie nicht noch einen Nachschlag gehabt hätte. „Übrigens”, tönte sie mit schlecht gespieltem Bedauern, „ich komme am Sonntag erst sehr spät zurück”. Damit war auch der klägliche Rest hormonell basierter Hoffnung, den ich mir hatte bewahren wollen, zerstört.
Was tat ein seriöser Strohwitwer um sich in seiner unbeweibten Askese die Zeit zu vertreiben? Er atmete tief durch und tat sich einen 20-Kilometer-Lauf an. Wenn denn schon das Wochenende mit Sonja ausfallen sollte, so freute ich mich wenigstens auf den jährlichen Volkslauf im Gonsenheimer Wald, der an diesem Samstag stattfinden sollte. Und zur psychischen Vorbereitung, quasi als Hors d‘œuvre, wollte ich ein Häppchen Kultur kosten.
Da ich wegen der sportlichen Aktivitäten ohnehin in Mainz war, nahm ich die Gelegenheit wahr, mir vorher die Ernst-Barlach-Ausstellung mit dem verheißungsvollen Motto „Mystiker der Moderne” in der Christuskirche anzusehen. Kurz nach zehn Uhr traf ich in der Christuskirche ein. Die erste Führung des Tages hatte bereits begonnen und so gesellte ich mich, ohne das Objekt, dessentwegen ich hauptsächlich gekommen war, zu beachten, zu einer Gruppe von etwa zehn Personen.
Ein grauhaarig-geknotetes weibliches Wesen, das mühelos selbst die plattesten Vorurteile über „späte Jungfern” im Einzelnen und Kunstführerinnen im Besonderen zu bedienen wusste, stand in geistiger Verzückung vor einer Skulpturengruppe. In einen übergroßen Poncho gehüllt, dessen schrilles Rot eine wahre Folter für jedes halbwegs sensible Auge war, wirkte sie wie ein überdimensionaler Pylon. Dazu trug ihre Körpergröße – ich schätzte sie auf einen Meter achtzig – das seine zu diesem Bild bei.
Ihre höchste Konzentration galt ihrer Aufgabe und … sich selbst. Mit keinem Blick würdigte sie die an ihren Lippen hängende Gruppe Kunstbeflissener, die wiederum auf ihre eigene Art einem Sketch von „loriotschem” Format entstiegen zu sein schien.
„Ernst Barlach besticht nicht zuletzt durch die Vielfältigkeit seiner Kunst”, dozierte Frau Dr. Arunde Kleine-Schmittbauer, wie ihr Namensschildchen preisgab, in professoraler, leiernder Modulation. „Er selbst hat immer darauf hingewiesen, dass der Weg des Bildhauers für ihn der schwerste der drei Wege gewesen sei, nämlich vom Grafiker über den Dichter bis zum Plastiker.”
Mit nach vorn ruckendem Kinn, das an einen gurrenden Täuberich erinnerte, stieß sie die jeweiligen Hauptwörter derart heftig hervor, dass sie durch den Nachhall der in Kirchen üblichen Akustik wie Folgeexplosionen von den Wänden und aus der Kuppel zurückgestoßen wurden. Dass sie dabei die Zähne kaum auseinander bekam, verlieh ihrer Darbietung zusätzlich etwas Groteskes.
„Der Plastiker endlich”, ruckte sie, „fand den Durchbruch zur Form, die der Vielfalt Einheit, dem Vergleitenden Dauer, dem Einmaligen das Verpflichtende des Gesetzes verlieh. Erst in der Plastik rundete sich das Werk, kam der Suchende in sich wie außer sich aus der Qual des verfließend Subjektiven in die Sicherheit des bleibend Objektiven, in dem sein Wesen wie sein Wollen, sein Warten wie sein Vorwärtsdrängen Sinn, Ruhe, Ziel und die erlösende Aufgabe fand, nach der er mehr als ein Menschenalter umhergetastet hatte.”
Unvermutet, aber erlösend kam eine Atempause. Außerdem musste sie ihrem vehementen Speichelfluss mit heftigem Schlucken huldigen, und endlich der erste Blickkontakt.
Während mich ihre verbalen Illustrationen an den Sprachgebrauch von Ministerialerlassen und steuerrechtlichen Gesetzestexten einschließlich ihrer noch mehr verwirrenden Erläuterungen erinnerte, honorierte die menschliche Mauer, die sich in dem Moment gebildet hatte, als ich nachträglich zu der Führung gestoßen war, diese rhetorische Rarität mit zustimmendem Kopfnicken. Begleitet von beifälligem Gemurmel tat man unisono so, als hätte man ihre Allegorien entschlüsselt und auch noch verstanden.
Sichtlich zufrieden mit der anerkennenden Reaktion lief Jungfer Arunde nun zur Höchstform auf.
„Die 58 Zentimeter hohe Bronzeplastik Lesende Mönche römisch drei, die Sie hier vor sich sehen, schuf Barlach 1932, zu der Zeit der beginnenden Isolation unter dem Nationalsozialismus …”
„Babba! Heh, Babba!!! Was hadden die Frau da ebe gesachd?”, verlangte ein krähendes Kinderstimmchen energisch nach Aufklärung. Und ohne eine Antwort abzuwarten, ließ der kleine Mann sofort die zweite, für ihn bestimmt wichtigere, Frage folgen: „Du, Babba, mohnste dann, die Nullfünfer gewinne heut gehsche Dortmund?”
„Johannes, sei still … psst … nachher … jetzt nicht!” Da erst entdeckte ich den genervten und sichtlich überforderten Vater, der vergeblich versuchte, einen quirligen Blondschopf an seiner Hand zu zügeln.
Ich beobachtete das Schauspiel, das mir immer noch allzu vertraut war, mit einem Hauch von Wehmut. (War es nicht erst gestern gewesen, dass meine Söhne Mark und Marius an meiner Hand zerrten, um mich an dem teilhaben zu lassen, was ihre kindliche Neugierde erregt hatte. Und wie selten hatte ich mir selbst die Chance gegönnt, mit den beiden wenigstens für ein paar Sekunden in ihrer Kinderwunderwelt eins zu sein. Heute gingen sie schon längst ihre eigenen Wege.)
Ein erzürnter Blick der Dozierenden und Unmutsäußerungen der Umstehenden waren dazu angetan, das störende Zweigestirn im Boden versinken zu lassen. Babba zuckte Verzeihung heischend mit den Schultern und ich erwiderte seinen gequälten Blick mit einem verständnisvollen Grinsen.
„Sie sehen zwei in ein Buch vertiefte Mönche dicht beisammen auf einer Bank sitzen. Ihre gemeinsame Lektüre drückt sich in den zu einer Form verschmolzenen Körpern aus. Feine Unterschiede”, nahm Frau Doktor mit scharfer Betonung den Faden wieder auf und wiederholte sich, da einige der Barlachfreunde nach wie vor Giftpfeile in Richtung Vater und Sohn abschossen. „Ich sagte soeben … hmm, … feine Unterschiede, also, zwischen den Mönchen, offenbaren sich erst auf den zweiten Blick.”
Während sie weitersprach, spähte sie stirnrunzelnd über unsere Köpfe hinweg. Ich folgte ihrem Blick und sah, dass sich der kleine Johannes von der Hand seines Vaters befreit hatte und zielstrebig auf eine Skulptur in der Rotunde der Vorkirche zueilte. Etwa zwei Meter über dem Boden, an zwei kettenähnlichen Stahlstangen aufgehängt, schien sie über einem darunter stehenden, ringförmigen Gitter zu schweben. Es war die Kopie des Güstrower Ehrenmals, besser bekannt als Der Schwebende – der hauptsächliche Grund, weshalb ich die Ausstellung besuchte.
Babba schien beruhigt und war offensichtlich zufrieden, dass der Kleine seinen aktiven Störradius um einige Meter verlegt hatte und er selbst nun endlich unbehelligt Frau Dr. Kleine-Schmittbauers weiteren Ausführungen folgen konnte.
„… fällt das Gewand am Oberkörper straffer, der Saum tanzt lebhafter über den Schuh hinab, um an der Seite in fast gotischer Manier sich aufzuwerfen und einzurollen”, fabulierte sie zur allgemeinen Beseligung. „Die bronzene Oberfläche der Figuren fängt das Licht vor allem in dieser Kreisform. Abgeschlossen …” – weiter kam sie nicht mehr. Jetzt nicht und auch nicht mehr für den Rest des Tages.
Als sei es ein vereinbartes Stichwort, beendete das Wort abgeschlossen, mit dem sie ihren letzten Satz begonnen hatte, tatsächlich ihre Führung. Die Ereignisse verselbständigten sich und katapultierten sie aus der vergeistigten und metapherngeschwängerten Welt ihres Barlachs in die profanen Abgründe der Wirklichkeit. Aber zunächst wehrte sich nicht nur ihr Geist, sondern der allerAnwesenden, das zu realisieren und anzunehmen, was sich ihnen in den nächsten Sekunden aus einem unschuldigen Kindermund offenbaren sollte.
„Babba, kuck mal, die Frau dahinten, die is ja ganz nackich!” verkündete der kleine Mann, der inzwischen wieder zurückgekehrt war, und deutete auf die Skulptur Der Schwebende.
„Johannes!”, der Vater sah hilflos um sich in die stummen Gesichter, in denen nur die eine Frage zu lesen war: Wann hast du endlich diesen Quälgeist im Griff! „Johannes”, flüsterte er für alle vernehmbar und folgte mit dem Blick dem Zeigefinger seines Sohnes, „das ist ein Engel. Und der hängt an zwei Ketten und das sieht nur so aus, als wäre der nackt.”
„Babba, des ist ‘ne Frau!” Der Junge unterstrich mit einem heftigen Aufstampfen seine flammende Entrüstung über das mangelnde Vertrauen in seine Beobachtungsgabe. „Und die hängt auch nicht an Ketten, die liegt auf‘m Boden … unter dem Engel, in dem Kreis. Da war e Kolter drüber gelegt, und die hab ich weggezoge und da hab ich se dann gesehe”, triumphierte er, „kuck doch selber”, erklärte Johannes ungeduldig seinem Vater und zog den sich nur leicht Sträubenden in Richtung Vorkirche.
An eine Fortsetzung der Führung war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. Frau Doktor schwieg beleidigt. Kopfschüttelnd zeigte sie ihr Unverständnis für die schlagartige Abkehr des allgemeinen Interesses von Barlachs „Lesenden Mönchen römisch drei”. Ihr Missfallen entlud sich in einem stimmlosen aber nicht weniger verächtlichen „Kulturbanausen”, wie ich meinte, von ihren Lippen abzulesen. Mit einem Seitenblick konnte ich den lautlosen Ausbruch ihrer Verärgerung wahrnehmen, während der Rest der Gruppe der Vorstellung folgte, die sich unter der Skulptur abspielte, von der uns etwa 25 Meter trennten.
Aus der Distanz erst konnte ich sehen, dass Vater und Sohn im Partnerlook gekleidet waren: dreiviertellange, gelbfarbene Freizeithosen, die von breiten, rot-weißen Trägern gehalten wurden, dazu Trikots, die sie als Fans des 1. FSV Mainz 05 auswiesen. Selbstbei den Frisuren hatte man keine Unterschiede zugelassen und die Haare mit dem Viermillimeteraufsatz der Schneidemaschine kurz geschoren. Lediglich ihre Blickrichtung und natürlich die Körpermaße, unterschieden sie voneinander. Während Johannes nach unten blickte, schaute sein Vater nach oben. Die Dramaturgie ihres Aussehens und ihrer Gebärden erinnerte an die eines Stummfilmes – Pat und Patachon, schmunzelte ich innerlich. In diesem Stadium des Geschehens hatte die ganze Sache immer noch einen gewissen Unterhaltungswert für mich.
Johannes deutete jetzt aufgeregt auf eine Stelle innerhalb des ringförmigen Füntengitters. Es war ursprünglich dafür gedacht, ein kostbares Taufbecken zu schützen. Aber jetzt, was verbarg oder schützte es heute?
Beim Betreten der Kirche hatte ich mich auf die bereits im Kreis stehende Gruppe konzentriert und daher nur einen flüchtigen Blick auf die schwebende Skulptur geworfen. Jetzt im Nachhinein erinnerte ich mich, dass mir dabei auch aufgefallen war, dass darunter etwas Dunkelgraues drapiert lag, das wie ein wellenförmiger Bergrücken aussah.
Was also hatte Johannes enthüllt, indem er die Wolldecke, die jetzt als Knäuel außerhalb des Ringgitters lag, zwischen zwei Stäben hindurchgezogen hatte?
Durch die schmiedeeisernen Stäbe konnte man nun selbst aus der Entfernung etwas erkennen, was in mir blitzartig ein Déjà vu auslöste. Niemals würde ich das Ereignis und das Datum vergessen: Es war der 16. Juli 2002, als ich aus ähnlicher Entfernung ein ebenso unidentifizierbares Bündel auf einem Acker ausgemacht hatte, das sich dann als der zerschmetterte und leblose Körper meines besten Freundes Horst Scheurer herausstellen sollte.
Und obwohl meine Gedanken in dem dramatischen Sog der Erinnerung strudelten, konnte ich doch gleichzeitig beobachten, wie Johannes seinen Vater am Ärmel zog, um dessen Blick, der fasziniert an der über ihm schwebenden Skulptur haftete, auf das Objekt am Boden zu lenken.
Widerwillig folgte er der stummen Aufforderung, stutzte, schüttelte ungläubig den Kopf, wischte sich über die Augen, so, als wollte er einen Albtraum auslöschen, blickte wieder nach oben, dann nach unten, erbleichte auf einen Schlag und trat schließlich einen Schritt zurück. Seine rechte Hand fuhr mit einer fahrigen Bewegung zum Mund, die linke packte Johannes an der Schulter. Er zog den Kleinen, rückwärts taumelnd, in unsere Richtung.
Ich hatte mich aus der erstarrten Gruppe gelöst und war auf ihn zugegangen. Mit irrem Blick starrte er mich an, drehte sich dann aber weiter zu der immer noch sprachlosen und entsetzten Gruppe, deutete auf das Gitter und stammelte „da … da … die ist tatsächlich tot … mausetot” und fügte fast entschuldigend, mit leiser Stimme hinzu, „ich habe so etwas ja noch nie erlebt.”
Wieder einmal, schoss es mir durch den Kopf, wieder einmal war ich früher an einem Tatort, als die Polizei. Ich hoffte nur, dass das nicht zu einer notorischen Bestimmung wurde.
Die Tote lag auf dem Rücken, genau unter Der Schwebende. So stirbt man nicht freiwillig und auch nicht durch einen Unfall, fuhr es mir sofort durch den Sinn. Vor allen Dingen diese Frau nicht, nicht SIE!
24 Wochen vorher, Donnerstag, 7. April 2005
Das Wetter hatte sich endlich gebessert und ich fuhr kurz vor elf Uhr bei strahlendem Sonnenschein, der so gar nicht zu dem Anlass meiner Fahrt passte, zu Gertrud Faber. Am Tag zuvor hatte sie mich in der Kanzlei angerufen und mir von Renates Verschwinden erzählt. Sie hatte sich für mehrere Tage aus ihrer Kanzlei abgemeldet und so besuchte ich sie in ihrem Haus in Neu-Bamberg. Das idyllische Dörfchen lag in einem der schönsten Gebiete der Rheinhessischen Schweiz, etwa zehn Autominuten entfernt von Bernheim Richtung Bad Kreuznach. Mein Weg führte mich vorbei am Galgenberg und dem literarisch vielfach beschriebenen Ajaxturm. Während der Fahrt musste ich an das gestrige Telefonat mit Gertrud denken und hatte daher keinen Blick für die pittoreske Landschaft und die Burgruine, die oberhalb auf einem Hügel das Bild der Ortschaft prägte.
Gertrud Faber hatte mir erzählt, dass ihr Schwiegersohn Benjamin am Ostersonntag, also am 27. März, gegen zehn Uhr bei ihr angerufen und sie gefragt hatte, ob sie eine Ahnung hätte, wo Renate sei. Er war aufgewühlt gewesen und hatte ihr erzählt, dass Renate nach einem kleinen Streit, wie er es nannte, mitten in der Nacht die gemeinsame Wohnung auf dem Weingut verlassen hätte, mit der Mitteilung, nie mehr zurückkommen zu wollen. Gertrud war ratlos.
„Ich habe schon seit einiger Zeit gespürt, dass mit ihr etwas nicht stimmt, aber ich kam gar nicht mehr an sie heran. Sie hat seit einigen Wochen so ein merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt und den Kontakt mit mir auf das wirklich Notwendigste reduziert. Dabei war unser Beziehung doch früher immer so eng! Naja, wenigstens hat Renate sich zwei Tage später gegen fünfzehn Uhr dann doch bei mir gemeldet und mir mitgeteilt, dass sie bei Marga Preuß, Benjamins Tante, untergekommen sei. Sie sagte, ich solle mir keine Sorgen machen und dass sie einfach ein paar Tage benötige, um sich zu sortieren, wie sie es ausdrückte. Sie würde sichwieder melden. Sie wäre auch mit allem versorgt, was sie brauche – Auto, Kreditkarte und ausreichend Kleidung. Aber als ich dann am nächsten Tag noch einmal versucht habe, sie über ihre Handynummer zu erreichen, nahm sie nicht ab. Ich habe dann bei Marga angerufen, die mir aber auch nicht viel mehr sagen konnte, als dass Renate noch während der Nacht oder am frühen Morgen ohne vorherige Ankündigung das Haus verlassen hätte.”
Seitdem hatte Gertrud nichts mehr von Renate gehört, obwohl sie immer wieder ihre Handynummer wählte. Ihre unbestimmte Befürchtung, dass ihrer Tochter etwas zugestoßen sein könnte, verstärkte sich von Tag zu Tag.
„Erst zieht sie sich Stück für Stück von mir zurück, dann verlässt sie ihren Lebenskreis und nun lässt sie schon seit zehn Tagen nichts mehr von sich hören! Sie hätte doch wenigstens anrufen oder auf meine Anrufversuche auf ihrem Handy reagieren können. Das passt alles nicht zu ihr. Da stimmt etwas nicht, das spüre ich.” Für einen Moment herrschte Stille, ich hörte sie nur noch atmen.
„Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Was soll ich nur tun, Darius?”
Ich versprach Gertrud, sie am nächsten Tag zu besuchen und meinen Freund, Heribert Koman, Kriminalhauptkommissar bei der Polizeiinspektion Alzey, hinzuzuziehen. Er konnte die Angelegenheit als Kriminalbeamter bedeutend effektiver beleuchten als ich und ihr bestimmt das Richtige raten.
Ich bog in eine Spielstraße im Neubaugebiet von Neu-Bamberg ein, an deren Ende Gertrud seit etwa 12 Jahren in einem Einfamilienhaus wohnte. Heribert war bereits da. Von Weitem sah ich ihn neben seinem Dienstwagen stehen, wo er auf mich wartete. Er reckte das Gesicht der Sonne entgegen und tankte offensichtlich Glückshormone nach dem wochenlangen Regenwetter.
Während ich im vorschriftsmäßigen Schritttempo auf ihn zu fuhr, fiel mir unsere erste Begegnung ein. Es war im Juli 2002 an dem Acker, an dem meine Hunde die Leiche meines Freundes Horst aufgespürt hatten. Ein freundlich aussehender Mann in Zivil, ichschätzte ihn damals auf Ende 40 – heute ist er 51, sechs Jahre jünger als ich – war auf mich zugekommen. Seinerzeit war er noch etwas schlanker gewesen, aber bei seiner Größe von 1,95 Meter fiel das kaum auf. Allerdings hatten sich seine Haare inzwischen meiner Frisur angeglichen. Sie waren weniger, zum Ausgleich jedoch auch grauer geworden.
Der freundliche Eindruck hatte sich sehr schnell verwischt, als er mich ohne eine erklärende Vorbemerkung gefragt hatte, ob ich Horst umgebracht hätte, was nicht gerade dazu hatte beitragen können, die erste Wahrnehmung des Hauptkommissars Heribert Koman wenigstens neutral zu gestalten. Und als er mich auch noch über Horst ausfragen wollte, der nicht nur mein Freund, sondern auch einer meiner Mandanten gewesen war, konterte ich mit einer hochgestochenen Reaktion: Ich verwies auf meine Verpflichtung zur Verschwiegenheit und zitierte aus meiner Berufsordnung. Ich erinnerte mich noch gut an unsere ebenso kurze, wie lächerliche Auseinandersetzung, die sich daran anschloss. Heribert beendete sie mit der Erklärung: „Wollen wir uns hier Paragrafen um die Ohren schlagen oder möglichst schnell den Tod Ihres Freundes klären!? Ihre Schweigepflicht, verehrter Herr Schäfer, interessiert mich dabei nämlich, verzeihen Sie bitte den Ausdruck, einen Scheiß.” Seitdem war er mir sympathisch. Allerdings bedurfte es noch mehrerer verbaler Scharmützel bei einem weiteren Fall bis wir, mit der Unterstützung einiger Flaschen Rheinhessenwein, den Beginn einer wunderbaren Freundschaft à la Rick Blaine und Victor László einläuteten.
Gertrud hatte uns bereits durch das Küchenfenster gesehen und öffnete die Haustür, bevor wir klingeln konnten. Sie sah müde und angespannt aus und ihre sonst stets frische Gesichtsfarbe war einer kränklichen Blässe gewichen. Sie musste meinem Blick entnommen haben, dass mich ihr Anblick erschreckt hatte. Als sie uns in das zum rückwärtigen Garten gelegene Wohnzimmer geführt und gebeten hatte, Platz zu nehmen, erklärte sie, dass sie schrecklich aussehen müsse, seit Tagen habe sie kaum geschlafen.