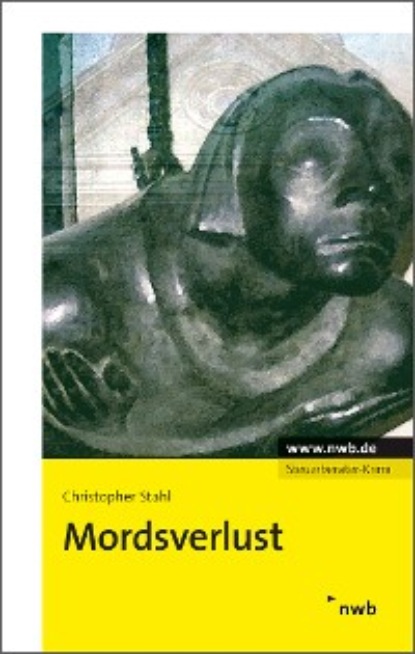- -
- 100%
- +
„Schauen Sie sich nur um, Herr Schäfer”, sagte sie und begleitete ihre Aufforderung mit einer sanften, raumgreifenden Geste, „das ist mein Lebensraum. Hier fühle ich mich wohl, seit über 20 Jahren, wie Sie ja auch an meiner Aufmachung erkennen.” Sie grinste und strich mit der Rechten über ihre Arbeitshose. „Ursprünglich war das einmal ein bäuerliches Anwesen, kein großes, eher ein ärmliches. Das sieht man an der Konstruktion. Ständerbauweise, ausgefüllt mit Sandsteinen, aber nicht von den Steinmetzen aus den Bernheimer oder Flonheimer Steinbrüchen, sondern Bruchsteine vom Feld. Doch es steht sicher, seit über 200 Jahren. Dieses Haus hat die napoleonische Herrschaft und mehrere Kriege überstanden.” Stolz klang aus ihrer Stimme. Man spürte, dass das Haus für sie ein Eigenleben hatte und dass sie sich über seine Standhaftigkeit definierte. Es schien ihr Sicherheit zu geben.
„Ich habe im Laufe der Zeit alles authentisch saniert, allerdings technisch auf den neuesten Stand gebracht und so eingerichtet, wie es mir gefällt. Auch wenn der Vorbesitzer schon vieles gemacht hatte, er war Handwerker, ein verrückter Kerl. Was der nicht alles eingebaut und umgebaut hat. Aber auch ohne aberwitzige Ideen ist so ein altes Gebäude wie ein Fass ohne Boden.” Wem sagte sie das, fragte ich mich. „Aber mir kann das egal sein. Don Johann Preuß zahlt schließlich alles, nur damit ich mich von der Familie fern halte.”
Ihre Stimme verhärtete sich, als sie den Namen ihres Vaters aussprach. Und ich war irritiert. Nicht, weil sie über ihn sprach, als sei er eine fremde Person, sondern weil sie sich mir so schnell öffnete. Gut, Gertrud hatte mich avisiert und ihr erzählt, weshalb ich sie aufsuchte, und sie wusste mich als Dorfbewohner einzuordnen. Aber weshalb sie mir ohne Not derart persönliche Dinge so schnell offenbarte, war mir unerklärlich.
„Ich kenne inzwischen jede Ecke und jeden Winkel hier. Diese alten Häuser stehen oft auf den Grundmauern noch älterer Häuser, die irgendwann abgetragen wurden, um an der gleichen Stelle ein neues zu errichten. Da stößt man auf allerhand außergewöhnliche und merkwürdige Dinge.”
Auf ihren Vorschlag hin blieben wir im Freien. Die Sonne hatte schneller, als es die letzten Tage hatten vermuten lassen, die Temperaturen nach oben getrieben und es war auch jetzt, kurz nach 19 Uhr, noch angenehm warm.
„Bitte nehmen Sie Platz”, sie deutete auf eine wetterfeste Sitzgruppe, die von einem überdimensionalen blauen Sonnenschirm und mehreren in Holztrögen eingepflanzten Ligusterhecken geschützt wurde. „Ich hole uns ein Glas Wein. Rot oder weiß?”
Ich entschied mich für einen Weißwein und sie ging über die drei Terrazzostufen in ihr Wohnhaus.
„1786” verkündete stolz die Zahl, die man in den steinernen Türsturz gemeißelt hatte, das Baujahr. Es war die Zeit der französischen Revolution, die Zeit, als George Washington der erste Präsident der USA war und Goethe seine berühmte Italienreise machte. Die Jahreszahl war noch ergänzt worden um den Namen des ehemaligen Bauherrn: August Hehl.
Annähernd zwanzig Familien in der 735-Seelengemeinde Bernheim trugen diesen Namen. Irgendwie waren sie alle miteinander verwandt. Inzwischen waren sie natürlich weiträumiger und stärker gemischt als noch im 18. Jahrhundert. Selbst denen, die hier geboren und miteinander aufgewachsen waren, erschlossen sich die tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse der Hehls, der Langs, der Lahrs, der Schöns und noch einiger weiterer – bewusst – nur mit Mühe.
Trat man allerdings einem von ihnen auf die Füße, bildlich gesprochen natürlich, im Gesangverein, im Gemeinderat, im Landfrauenverein oder auch nur beim Stammtischgespräch im Bernheimer Schafbock, wurde man innerhalb kürzester Zeit gewahr, wo die Blutsbande verknüpft waren. Mit offenbar genetisch gesteuertem Instinkt solidarisierten sich Namensgleiche und gleichnamig geborene Dorfbewohner in einhelligem Schulterschluss gegen den Frevler. Böse Blicke, ein nur noch knapper oder erst gar nicht gebotener Gruß, schroffe oder patzige Antworten auf freundlich gestellte Fragen waren die offen erkennbaren Signale kollektiver Abstrafung.
Marga Preuß hatte sich diesem dörflichen Kult durch ihre Abschottung ebenso entzogen wie ihre Familie, die mit ihr nichts mehr zu tun haben wollte.
Ich schaute hinüber zur Scheune, die den Hof parallel zur Langgasse begrenzte.
„Dahinter habe ich meinen Gemüsegarten, aus dem ich mich verpflege. Ich ernähere mich vegan und da ist es schwer, die Produkte zu bekommen, die man will. Man gelangt direkt durch die Scheune in den Garten. Das ist sehr praktisch für mich.”
Ich hatte überhaupt nicht bemerkt, dass sie wieder neben mir stand. Sie nahm zwei gefüllte Weingläser von einem Tablett und stellte eine Schale mit Käsegebäck dazu. Sie prostete mir zu, nahm einen Schluck und sah mich erwartungsvoll an.
„Ich sehe Sie oft in ihrem Garten arbeiten, wenn ich zur Dunzelquelle oder zum Bernheimer Wald gehe. Aber Sie sind stets so eifrig mit ihren Pflanzen beschäftigt, dass sich noch nie ein Wort über den Zaun ergeben hat.”
„Ja, ich weiß. Ich gehe dem aus dem Weg. Dorfgetratsche ist meist grässlich und böse. Ist nicht gegen Sie gerichtet, ich meine das allgemein. Aber ich habe Sie auch schon oft gesehen, mit Ihren Hunden. Schöne Tiere. Wissen Sie”, nun lächelte sie sogar, „ich kann natürlich alle beobachten, die hinter meinem Garten vorbeigehen, mit einem Seitenblick, wenn ich mich nach unten bücke.”
Ich nippte von dem Wein. „Riesling?”
Sie nickte.
„Von Preuß & Erben?”
Ihr „Nein” klang hart, beinahe schroff. Blödmann, schalt ich mich, musst du dir die Fettnäpfchen auch noch selbst aufstellen?
„Nicht von Preuß und nicht von Dohne, Herr Schäfer. Den beziehe ich von Heinz Gebhard, direkt nebenan. Der ist gut, nicht wahr?” Sie trank hastig und wartete meine Antwort nicht ab. „Geld ja, sonst aber nehme ich nichts. Ich muss schließlich physisch leben, auch wenn man mich psychisch vegetieren lässt.” Und kaum vernehmlich sagte sie, wohl mehr zu sich selbst, als zu mir: „Ich weiß nicht einmal weshalb, was ich getan haben soll. Man weigert sich einfach, mit mir zu reden. Ich habe es aufgegeben. Außer meinem Neffen Andreas und einem Mitarbeiter vom Weingut ist Renate die einzige, die sich mit mir befasst. Sie hat mir zugehört. Aber auch ihr hat man nicht den Grund verraten, weshalb man mich verstoßen hat wie eine Aussätzige.”
„Ich weiß, Frau Preuß, dass es mich nichts angeht. Aber Sie vertrauen mir freimütig einiges von Ihrem Leben an und das lässt mich natürlich nicht kalt. Ich frage mich allerdings, weshalb Sie noch hier sind, in Bernheim? Weshalb ziehen Sie nicht einfach fort?”
„So, wie Renate, meinen Sie? Ich beneide sie um ihre Entschlusskraft, um ihren Mut, ihr Rückgrat. Ich habe hier mein Haus, das kann ich aber nicht verkaufen. Ich bin zwar die Besitzerin, aber Eigentümer ist der Alte.”
Ich sah sie verdutzt an.
„Ich kann ihn einfach nicht mehr als meinen Vater bezeichnen, verstehen Sie?” Sie zuckte mit den Schultern, setzte dann aber ihre Erklärung wieder fort, ohne eine weitere Reaktion von mir abzuwarten. „Ich habe nichts gelernt und keinen finanziellen Rückhalt, nichts. Ich bin auf die Zuwendungen dieser Menschen angewiesen. Was also sollte ich tun?”
Es folgten einige Sekunden des Schweigens. Sie starrte in ihr Weinglas und brachte die zartgrüne Flüssigkeit darin wie in einem Cognacschwenker zum Kreisen.
„Sprechen wir jetzt über Renate, Frau Preuß?”
„Wir sprechen schon die ganze Zeit über sie.” Wieder huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. „Weshalb meinen Sie wohl, habe ich Ihnen schon so viel über mich erzählt?”
Ich sah sie fragend an.
„Kommen Sie mit, ich möchte Ihnen etwas zeigen.”
Ohne auf meine Zustimmung zu warten, erhob sie sich und ging voraus zur Scheune, die wir durchquerten, um durch eine schmale Tür an der Rückseite in den Garten hinauszutreten. Auf einem mit Rindenmulch bedeckten Pfad lotste sie mich zwischen zwei Beeten hindurch, bis wir kurz vor dem Gartenzaun an einem anscheinend wild wachsenden Strauch anlangten. Liebevoll griff sie mit gespreizten Fingern unter eine Knospe.
„Sie wird sich bald öffnen wie die vielen anderen auch. Wunderschöne, leuchtendgelbe Blüten werden sich bald öffnen, die abends einen betörenden Duft ausströmen. Ich weiß nicht, was fürein Gewächs das ist und wo es herkommt. Auf einmal war es da. So, wie Renate.”
Ich wusste nicht, worauf sie hinauswollte und musste sie wohl recht belämmert angesehen haben.
Sie lachte ein eigenartiges Lachen. „Irgendwann einmal dachte ich, der Strauch würde zu groß. Wie nennt man das bei Menschen? Zu selbständig werden? Einem über den Kopf wachsen? Also, was tat ich?”
„Frau Preuß, ich verstehe nicht.”
„Gleich werden Sie es, warten Sie nur ab. Ich nahm also eine Heckenschere und schnitt alles weg, was mir nicht gefiel. Ich stutzte ihn zurecht. Und im nächsten Jahr? Keine Knospen, keine Blüten. Ich habe ihn angefleht, mich entschuldigt, aber es dauerte fünf Jahre, bis er mir den Eingriff verziehen hatte. Und plötzlich, vor zwei Jahren hatte er sich erholt. Verstehen sie jetzt?”
„Nicht so ganz. Ich vermute, Sie vergleichen den Strauch mit Renate?”, fragte ich unsicher.
Sie drehte sich um und ging den Weg zurück zur Scheune voraus. „Richtig. Renate wäre auf dem Weingut zurechtgestutzt worden. Und ob sie dann irgendwann noch einmal aufgeblüht wäre, das möchte ich bezweifeln. Ich glaube, wenn der Strauch den Garten verlassen könnte, er wäre damals auf und davon. So wie Renate.”
Als gälte es, die Worte von Marga Preuß zu untermalen, drang, als wir gerade wieder die Scheune betraten, gedämpft, wie durch Watte, eine Melodie an mein Ohr, die nach wenigen Tönen abbrach. „War das nicht der Anfang des Titelsongs aus Titanic: My heart will go on?”
„Was meinen Sie?”
„Die Musik eben.”
Sie zuckte mit den Schultern. „Ich habe nichts gehört. Vielleicht von nebenan; das kommt schon mal vor, je nachdem, wie der Wind steht und wie laut die Gebhardkinder ihre Musikanlage aufdrehen.”
Inzwischen waren wir wieder an dem Freiplatz angelangt und hatten uns gesetzt.
„Nun, Renate stand am Karsamstag, spät abends bei mir vor der Tür. Sie war völlig aufgelöst, so hatte ich sie noch nie erlebt.”
„Hatten Sie vorher häufiger Kontakt mit ihr?”
„Sie wohnt, besser wohnte, ja seit fünf Jahren auf dem Weingut. Seitdem besuchte sie mich unregelmäßig. So etwa einmal im Monat. Die Familie versuchte, sie davon abzuhalten. Aber Renate hat erklärt, solange man ihr nicht sagen würde, was ich verbrochen hätte, würde sie den Kontakt mit mir pflegen. Ich glaube, sie musste ab und zu aus dem geschlossenen Clansystem des Weingutes ausbrechen. Sie kennen es?”
„Nein.”
„Es ist sehr großräumig. Die haben während der letzten Jahre erweitert. Dadurch, dass es am Ortsrand liegt, war das kein Problem. Der Alte wohnt weiterhin im Hauptgebäude, obwohl es viel zu groß ist – acht Zimmer. Für meine Neffen mit ihren Frauen und meine Schwester mit ihrem Mann gibt es drei große Wohnungen. Da bekommt jeder mit, was der andere tut. Und dann gibt es noch das 2-Zimmer-Appartement in dem Klaus Zerfass wohnt.”
„Klaus Zerfass?”, ich war überrascht, „der Name ist mir neu.”
„Er arbeitet schon seit vielen Jahren auf dem Gut. Er ist Weinchemiker und -technologe. Gehört irgendwie zum lebenden Inventar. Er ist so ein Mädchen für alles, Faktotum nennt man das, glaube ich, obwohl sie ihn eher wie einen Domestiken behandeln, nur weil er … Er kommt auch ab und zu bei mir vorbei und lässt den neuesten Hoftratsch hier. Es interessiert mich zwar nicht, aber bevor er gar nicht mehr kommt, höre ich ihm zu. Er hat sich übrigens auch mit Renate angefreundet, zum Ärger ihres Mannes.”
„Läuft da etwas zwischen den beiden? Das könnte doch auch ein Grund dafür sein, dass sie durcheinander ist.”
„Das kann ich mit absoluter Sicherheit ausschließen.” Wieder einmal huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. „Klaus hat nichts übrig für Frauen, er ist schwul. Der Alte war ganz schön sauer, alsKlaus sich vor vier Jahren mit den Worten: Ich bin schwul, und das ist gut so, öffentlich geoutet hat. Das Beispiel seines Namensvetters aus Berlin hatte ihm Mut dazu gemacht. Am liebsten hätte der Alte ihn hochkant rausgeworfen, der scheinheilige Moralapostel. Aber er braucht ihn.”
„Lassen Sie uns wieder zurückkommen zum Karsamstag. Was hat Renate erzählt?”
„Nicht viel mehr, als ich bereits wusste. Renate hat ja Ende 2003 ihren Dienst bei der Polizei quittiert und arbeitet seitdem hauptberuflich in der Verwaltung des Gutes mit. Sie ist zuständig für die Buchhaltung.”
„Hauptberuflich?”
„Ja, sie hatte die Buchhaltung schon lange zuvor über die Kanzlei ihrer Mutter betreut. Mit dem Unterschied, dass sie direkt vor Ort einiges an Mängeln entdeckt hat, die sie abgestellt hat. Eigenmächtig, wie man ihr vorwirft. Sie hat mir nur ganz kurz erzählt, dass es sich unter anderem um Steuerhinterziehung bei der Perlweinproduktion handeln würde.”
Ich musste unwillkürlich grinsen, da mir die verlockende Möglichkeit, der sich einige Winzer nicht entziehen konnten, hinlänglich bekannt war.
„Und natürlich wollte Renate diese Mängel auch rückwirkend beseitigen, was den nächsten Stein ins Rollen brachte.”
Ich schüttelte ungläubig den Kopf. „Die hätten doch froh sein müssen. Wieso soll man riskieren, dass bei einer Betriebsprüfung Dinge hochkommen, die man rechtzeitig hätte abstellen können. Wenn die einmal den Anfang eines Garnknäuels gefunden haben, wickeln sie den bis zu seinem Ende auf.”
„Sie musste dazu in alte Vorgänge einsteigen, Ordner der letzten Jahre durchforsten und … Fragen stellen. Man hat ihr schließlich vorgeworfen, sie würde nur rumschnüffeln, statt ihre Arbeit zu machen.”
Ich entsann mich, dass Gertrud Faber mir von einigen Äußerungen Renates erzählt hatte, die sich nun konkretisierten. Von Arbeitsbelastung hatte sie gesprochen, von langwierigen Diskussionen wegen Bagatellen.
„Wer warf ihr das vor? Ihr Mann, ihre Schwiegermutter? Oder auch Ihr Vater?”
„Der Alte schien sich da rausgehalten zu haben, obwohl er die Begabung besitzt, andere so zu manipulieren, dass sie gar nicht merken, dass sie sich geistig wie Marionetten verhalten. Nein, meine Schwester stänkerte und Benjamin spielte mit.”
„Und die anderen?”
„Die hielten sich ebenfalls zurück. Da will es sich doch keiner mit ihm verderben. Ich funktioniere hervorragend als abschreckendes Beispiel dafür, wozu der Alte in der Lage ist, wenn man bei ihm in Ungnade fällt. Noch einen Wein?”
Ich hatte gar nicht registriert, dass ich bereits das zweite Glas geleert hatte, lehnte nun aber dankend ab.
„An dem Abend nun bestand Renate auf einer Aussprache mit ihrem Mann. Er muss sich so geäußert haben, dass er gar nicht wisse, was sie wolle und hat ihr Hysterie vorgeworfen und gefragt, ob sie wohl endlich schwanger sei.”
„Ist sie es denn?”
„Nein. Sie verhütet, seitdem sie sich ihrer Liebe und ihrer Ehe nicht mehr sicher ist.”
„Und weshalb fragt er dann so etwas?”
„Weil Renate ihm verheimlicht hat, dass sie die Pille nimmt. Bis zu diesem Abend. Benjamin rastete aus, ein Wort ergab das andere und … das Resultat kennen Sie ja.”
„Was geschah dann weiter?”
„Benjamin rief etwa eine Stunde später an und fragte, ob Renate bei mir sei. Sie hatte mich aber vorher schon gebeten, ihren Aufenthaltsort nicht zu verraten. Er glaubte mir wohl nicht so ganz, denn er hängte wütend ein. Na ja, inzwischen weiß er, dass Renate bei mir war. Gertrud hat es ihm gesagt.”
Sie zuckte mit der Schulter, als wollte sie sagen, dass ihr das jetzt egal war.
„Renate ging dann zu Bett. Sie schlief lange, auch die nächsten Tage. Es war Ostern, ein Wetter wie in den letzten Tagen. Wir haben gelesen, ferngesehen und gequatscht. Aber nicht über ihre Situation. Sie wollte das nicht mehr. Am Dienstag hat sie dann ihre Mutter angerufen. Aber das wird Ihnen Frau Faber alles schon erzählt haben, nehme ich an.”
Ich nickte. „Und dann war sie am Morgen des 30. März spurlos verschwunden?”
„Ich habe nicht gehört, wann sie das Haus verlassen hat. Ich habe Durchschlafstörungen und nehme Schlaftabletten. Da habe ich noch nicht einmal mitbekommen, wie sie den Wagen aus der Scheune und auf die Straße gefahren hat. Als ich dann am nächsten Morgen, so gegen acht Uhr aufgestanden war, war nichts mehr da von ihr. Kein Kleidungsstück, kein Buch, keine Toilettenutensilien. Es war, als ob sie nie bei mir gewesen sei.”
„Hat sie nicht erwähnt, wo sie hingehen wollte?”
„Nein, obwohl ich sie gefragt hatte. Sie meinte, es wäre besser so, dann könnte ich mich auch nicht verplappern.”
„Und Sie haben keine Idee, keinen noch so vagen Hinweis? Hat sie etwas von Bekannten erzählt, von Kollegen, die sie von der Polizeischule kennt oder von Lehrgängen, Urlaubsbekanntschaften, Schulfreunden?”
„Nein, kein Wort.”
„Hat sie außer mit ihrer Mutter mit anderen telefoniert?”
„Wenn, dann höchstens über ihr Handy. Die ausgehenden Gespräche habe ich schon im Speicher meiner Telefonanlage überprüft. Da ist keines dabei, das sie geführt hat, außer dem mit ihrer Mutter.”
„Was für ein Auto hat sie?”
„Einen dunkelroten Nissan 350 Z, so einen Sportwagen. Das Kennzeichen ist AZ-RF-3636.”
„Haben Sie ihre Handynummer?”
„Natürlich. Ich durfte sie ja nie auf dem Festnetz anrufen. Das wäre aufgefallen.”
„Und haben Sie versucht, Renate zu erreichen, nachdem sie Ihr Haus verlassen hatte?”
„Daran gedacht habe ich schon, aber ich respektiere ihren Wunsch, dass man sie in Ruhe lässt. Wenn sie mich sprechen will, wird sie schon anrufen.”
Ich hatte von Marga Preuß alles erfahren, was sie zu dem Bild, das ich mir machen musste, beitragen konnte. Ich stand auf und bedankte mich für ihre Gastfreundschaft und das offene Gespräch. Sie wollte noch wissen, ob ich jetzt auch zu ihrem Neffen gehen würde. Aber der hatte über Gertrud einen Termin für den nächsten Morgen ausgemacht.
„Wenn Sie wieder einmal durch die Langgasse kommen, Herr Schäfer … Sie wissen ja jetzt wo die Klingel ist. Sie sind immer willkommen, jederzeit. Bringen Sie dann auch einmal Ihre Frau mit, ich würde mich sehr freuen.” Fast flehentlich signalisierte sie, dass sie in dem gewonnenen Kontakt mit mir einen Weg sah, ihrer Einsamkeit zu entfliehen.
Sie begleitete mich zum Tor, wo ich ihr noch versprechen musste, sie umgehend zu informieren, wenn ich etwas von Renate erfahren sollte.
Sonja war im Hof und spielte mit Kira und Siwa. Die 200-Watt-Lampe, die in fünf Metern Höhe an einem Drahtseil leicht im Wind schwankte, spendete das notwendige Licht dazu.
„Na, ist dein Tête-à-tête mit der mysteriösen Marga vorbei?” Sie empfing mich mit einem vielsagenden Blick, gefolgt von einem herzhaften Kuss, den sie allerdings sehr schnell unterbrach. „Puh, du riechst nach Alkohol. Du hattest mir doch gesagt, es ginge nur um ein kurzes Gespräch, und nun rieche ich, dass es sich um ein ausschweifendes Bacchanal gehandelt haben muss. Ich bitte um eine nachvollziehbare und ehrenhafte Erklärung, mein Liebster!”
Während wir ins Haus gingen, erinnerte ich mich an eine ähnliche Szene, als ich ihr zum ersten Mal begegnet war. Und heute, wie damals, hatte ich Schmetterlinge im Bauch. Nur mit dem Unterschied, dass ich vor drei Jahren dieses Gefühl noch nicht – oder besser gesagt nicht mehr – hatte einordnen können.
Ich war gerade auf dem Hoffest eines Weingutes in Flonheim eingetroffen, als eine Dixieband eines meiner Lieblingsstücke – Petit Fleur, von Sidney Bechet – spielte. Ohne genau hinzusehen hatte ich gedankenverloren am Ende eines der langen Tische Platz genommen, als sich neben mir eine angenehme Frauenstimme bemerkbar machte: „Aber gerne”, immer noch hatte ich den Klang ihrer Stimme und ihre fast schon provokative Ironie im Ohr, „nehmen Sie ruhig Platz.” Als ich mich, eine Entschuldigung stammelnd, umdrehte, strahlte mich eine attraktive Rothaarige, Mitte vierzig, frech aus ihren grünen Augen an. Mit einer leichten Neigung ihres Kopfes, einer Geste, die charakteristisch war für sie, vermutete sie, dass ich ohne elterlichen Beistand bestimmt Probleme mit den elementarsten Anstandsregeln hätte. Vor lauter Verzweiflung leerte ich die Weinschorle, die man mir inzwischen gebracht hatte, auf einen Zug, was sie mit der Bemerkung, das sei ja wohl eindeutig Überschreitung der gesetzlich zulässigen Trinkgeschwindigkeit kommentierte. Ja, so lernte ich Sonja kennen, so lernte ich sie nach ein paar Wirrungen einige Monate später lieben und so, genau so, liebte ich sie immer noch, jeden Tag ein bisschen mehr.
Jetzt berichtete ich ihr von dem Besuch bei Gertrud und bat sie gleichzeitig, Dagmar nichts davon zu erzählen. „Überlass das bitte Heribert.”
„Ich weiß zwar nicht weshalb, aber wenn du das willst, werde ich kein Sterbenswörtchen davon verlauten lassen”, versprach sie.
Anschließend erzählte ich ihr von dem Gespräch mit Marga Preuß. „Sie hat eigentlich ein recht sympathisches Wesen. Natürlich ist sie in Bezug auf ihre Familie ziemlich verbittert, aber mir gegenüber war sie sehr offen und freundlich. Sie hat mich, uns sogar eingeladen, einmal vorbeizukommen.”
„Soll das heißen, dass wir mit ihr nun einen auf Freundschaft machen?”, war Sonjas erster Kommentar, nachdem sie mir schweigend zugehört hatte. „Ich möchte nicht in das gleiche Horn tuten wie einige aus meiner Gesangsgruppe, die sich auf alles stürzen, was nicht in ihre kleine Welt passt. Die bezeichnen sie als … durchgeknallt.”
„Wie bitte?! Durchgeknallt? Was soll das denn jetzt?”
„Entschuldige, Darius, das ist ja nicht mein Sprachgebrauch. Frau Preuß ist Opfer vieler Umstände. Ich glaube ja, dass sich alles, was mit Renate zusammenhängt, so abgespielt hat. Erstens ist es identisch mit dem, was Gertrud euch erzählt hat, und zweitens, weshalb sollte sie die Unwahrheit sagen. Dazu ist das, was sie in dieser Sache erlebt hat, einfach zu banal.”
„Na also, weshalb bezeichnen dann so ein paar deiner Singschwalbentussis sie als durchgeknallt?”
„Darius, nimm einfach nur das, was du in der kurzen Zeit mitgekriegt hast. Sie ist zutiefst eigenbrötlerisch, geradezu asozial im pathologischen Sinn, sie spricht mit niemandem im Dorf – außer mit Pflanzen.”
„Da kenne ich aber noch ganz andere Typen. Denk nur mal an deinen Kollegen, der mit bajuwarischem Akzent Französisch unterrichtet, was der sich für hanebüchene Dinger erlaubt. Damit könnte man eine ganze Abteilung in der Nervenheilanstalt füllen.”
Sonja schaute mich skeptisch von der Seite an, ohne weiter auf meine Bemerkung einzugehen. „Sie nimmt seit Jahren Tabletten, weil sie nicht durchschlafen kann. Und das werden nicht die einzigen pharmazeutischen Teufelsdinger sein. Mensch, Darius, hast du dir denn nicht überlegt, mit wem du es zu tun hast?”
„Mit wem denn?”
„Mit einer Frau, der man die Jugend gestohlen hat, die gedemütigt und verstoßen wurde und ohne Liebe aufwachsen musste, ohne zu wissen, weshalb. Kannst du dir vorstellen, wie es in ihr aussehen muss, zerrissen zwischen Selbstzweifeln, unergründlichen Schuldgefühlen und Hass?”
„Du hast sie ja nicht gesehen, sie wirkte ganz normal auf mich”, setzte ich zu einer Rechtfertigung an.
„Klar, weil sie sich jeden Tag mit Psychopharmaka vollstopft. Sie war bereits mehrmals in Alzey in der Rheinhessenklinik, von der du meinst, dass die Verrücktheiten meines Kollegen sie alleine füllen würden.”
„Woher weißt du das?”, fragte ich kleinlaut.
„Ich kenne die Gerüchte, die über Marga Preuß kursieren, und während du bei ihr warst, habe ich ein wenig recherchiert, weil ich Gerüchte ebenso verabscheue wie du. Der Vater eines meiner Schüler ist …”, sie unterbrach sich, „besser nicht. Du weißt ja: Schweigepflicht. Ich habe einer Person mit Insiderwissen einige Fragen gestellt, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden mussten. Nicht ganz sauber, aber vertretbar.”
„Aber das heißt doch nicht, dass das, was sie mir über Renate erzählt hat, nicht stimmt.”
„Nein, das habe ich ja schon gesagt. Ich will nur keinen persönlichen Kontakt mit ihr. Mein soziales Engagement erschöpft sich im Übermaß in der Schule. Und auch ich habe nur ein begrenztes Kontingent zur freien Verfügung. Ich brauche auch noch etwas für dich.”