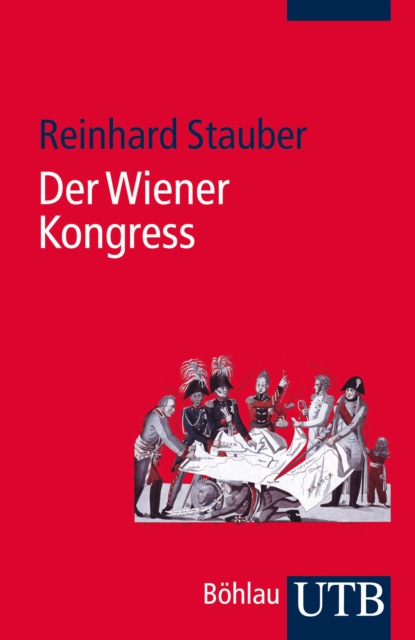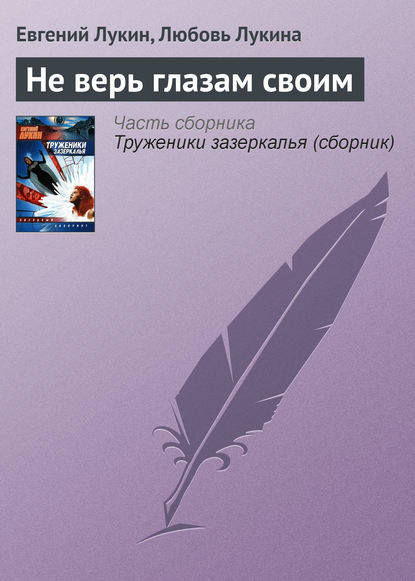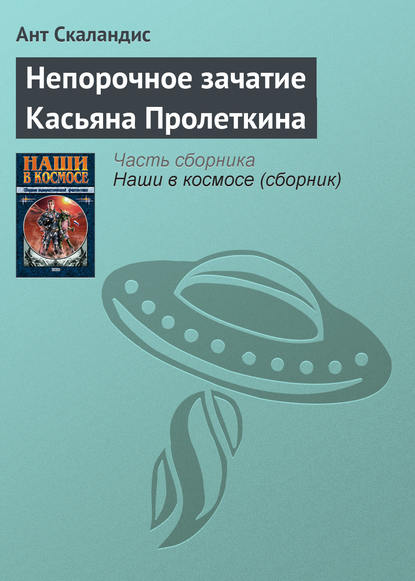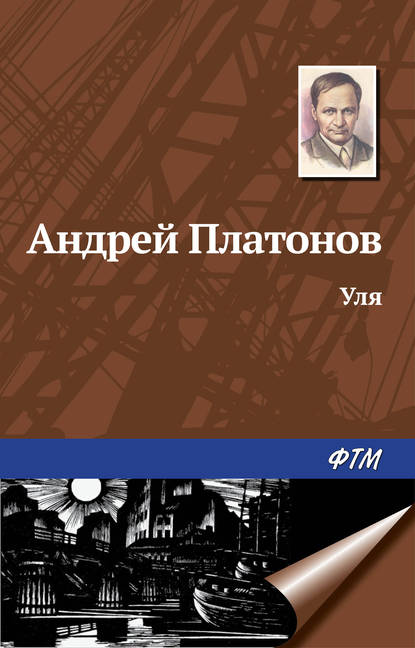- -
- 100%
- +
Am 18. Januar 1814 kam Castlereagh im alliierten Hauptquartier an, das sich damals in Basel befand. Allein dieses Reiseziel zeigt, wie dramatisch sich die politisch-militärische Lage in Europa in den letzten Wochen des Jahres 1813 verändert hatte. In Spanien erhielt der Bourbonenkönig Ferdinand VII. seinen Thron zurück; in den Niederlanden war es zu Aufständen gegen die Franzosen gekommen, die das Land bis Weihnachten räumten; hier kehrte Prinz Wilhelm VI. von Oranien-Nassau, der Sohn des letzten Erbstatthalters, als „Souveräner Fürst der Niederlande“ aus dem britischen Exil zurück. Österreichische, später auch russische Truppen rückten ab dem 21. Dezember östlich von Basel in die Schweiz ein, um von dort Richtung Frankreich vorzustoßen, und in der Neujahrsnacht 1813/14 setzte Blücher bei Koblenz über den Rhein. Trotz mancher Bedenken trugen die alliierten Truppen den Krieg nun nach Frankreich hinein. In der Hoffnung, sich seine Herrschaft über Neapel sichern zu können, wandte sich dessen König, Joachim Murat, von seinem Schwager Napoleon ab und schloss am 11. Januar 1814 eine Bündnisabsprache mit Österreich, in der er versprach, in Italien 30.000 Mann an die Seite der Alliierten zu stellen.
Nach diesen Erfolgen und der Besetzung eines breiten Gebietsstreifens in Ostfrankreich brachten die Monate Februar/März 1814 politisch wie militärisch gefährliche Krisenmomente für die Koalition mit sich. Über die Fragen, ob nun ein rascher militärischer Vorstoß gegen Paris zu führen und der Sturz der Dynastie Bonaparte zu planen sei, ergaben sich gravierende Differenzen zwischen dem Zaren auf der einen und den leitenden Ministern Großbritanniens und Österreichs auf der anderen Seite. Castlereagh und Metternich hatten im Januar in Basel abgesprochen, die Alternative Bonaparte oder Bourbon vorerst in der Schwebe zu lassen, nochmals einen Friedensschluss mit Napoleon zu versuchen und dieses Ziel durch eine langfristige Defensivallianz gegen Frankreich formal abzusichern.
Mitte Januar 1814 hatte Napoleon ein Ersuchen um Waffenstillstand formuliert, das sein Außenminister Caulaincourt mit einiger Verzögerung an Metternich weiterleitete. Die Minister der Koalition beschlossen Ende Januar bei Besprechungen in Langres, diese Verhandlungen aufzunehmen, die militärischen Operationen aber gleichzeitig fortzuführen. Ihre [<<28] Bevollmächtigten sollten nur eine, gemeinsame Instruktion bekommen und alle Agenden des kontinentalen Europa gegenüber dem französischen Kaiser vertreten. Metternich formulierte sehr bezeichnend, die Neuordnung Europas sei für die alliierten Mächte quasi ein Gegenstand der Innenpolitik.13
Um Paris zu retten, hatte Napoleon seinem Außenminister nach den verlustreichen Schlachten gegen Blücher bei Brienne und La Rothière (29. Januar/1. Februar 1814) vorübergehend freie Hand für Verhandlungen gegeben. Im burgundischen Châtillon-sur-Seine traf Caulaincourt am 5. Februar auf die Bevollmächtigten Russlands, Österreichs, Preußens und Großbritanniens und legte ihnen das Ersuchen um einen raschen Waffenstillstand vor. Schon vier Tage später wurden die Verhandlungen auf Druck des Zaren unterbrochen, der an seinen Plänen für die Weiterführung des Kriegs festhielt. Die alliierten Diplomaten wichen daraufhin am 10. Februar für eine Woche nach Troyes aus, um dort erst einmal eine gemeinsame Linie der Vier Mächte festzulegen. Dieses Vorhaben erwies sich als durchaus kritisch; der Koalition drohte die Spaltung und dies gerade in einer Phase, in der Napoleon an Marne, Aube und Seine eine ganze Reihe kleinerer, aber psychologisch wichtiger Erfolge gegen die Truppen Blüchers errang (10.–17. Februar). Während der Zar weiter auf ein Vorgehen auf Paris drängte, zog der übervorsichtige Schwarzenberg seine Truppen zurück. Das gegenseitige Misstrauen ging so weit, dass Metternich und Hardenberg insgeheim verabredeten, im Falle einer erfolgreichen Eroberung der Kapitale Frankreichs sogleich mit Bonaparte Frieden zu schließen und Ansprüche der Bourbonen nicht zu berücksichtigen (14. Februar). Doch am gleichen Tag noch gab der Zar nach.14
So gingen die Verhandlungen in Châtillon ab dem 17. Februar weiter und die Alliierten übergaben Caulaincourt einen Vertragsentwurf für einen Vorfrieden. Von einer Grenze am Rhein war keine Rede mehr; Frankreich sollte jetzt auf die Grenzen von 1792 zurückgehen – eine [<<29] deutliche Konzession an das britische Interesse an einer breiten „Barriere“ an Rhein, Maas und Schelde, das auch von Preußen unterstützt wurde. Außerdem sollte das Land an den anstehenden Beratungen über die territoriale Neugestaltung Europas nicht beteiligt werden – für Gentz „unstreitig die härteste [Klausel], die je in einer Friedensunterhandlung zur Sprache gebracht ward.“15 Im gleichen Artikel des Vertragsentwurfs waren folgende Grundsatzdispositionen bezüglich der Nachbarländer Frankreichs vorgesehen: Deutschland solle aus unabhängigen Staaten bestehen, miteinander verbunden durch ein „föderatives Band“ („lien fédératif“). Italien werde ebenfalls wieder aus unabhängigen Staaten bestehen; Holland sei zu vergrößern und der Souveränität des Hauses Oranien zu unterstellen. Spanien solle unter der Herrschaft des von Napoleon bereits anerkannten Bourbonenkönigs Ferdinand VII. in seinen alten Grenzen wiederhergestellt werden, ebenso die Schweiz, deren Status als „unabhängiger Freistaat“ („État libre, indépendant“) von allen Großmächten garantiert würde. Eine Rückgabe der meisten Überseebesitzungen an Frankreich wurde in Aussicht gestellt; die Briten sicherten sich allerdings Mauritius, die Îles des Saintes (Teil der Kleinen Antillen südlich von Guadeloupe), Tobago und Malta.
Napoleon aber hatte nach seinen militärischen Erfolgen in der ersten Februarhälfte das Interesse an Verhandlungen verloren und Caulaincourt am 17. Februar alle Verhandlungsvollmachten entzogen. Die Alliierten warteten drei Wochen, ohne eine verbindliche Antwort aus Paris auf ihren Vorschlag zu erhalten. Nach Prag im Sommer 1813 verspielte Napoleon im Spätwinter 1814 ein zweites Mal bewusst den Frieden – dieses Mal trotz eines deutlich ausformulierten Verhandlungsangebots, trotz der mehrfachen Warnungen seines Außenministers und im Angesicht von Feindestruppen im eigenen Land.
Die Verhandlungen mit Caulaincourt waren eben wieder aufgenommen, als Außenminister Castlereagh konkrete Schritte einleitete, um sein [<<30] schon angesprochenes politisches Hauptziel zu realisieren: ein langfristiges Verteidigungsbündnis zwischen den Mächten Europas, das den Frieden mit Frankreich nicht nur erzwingen, sondern auch auf lange Sicht absichern sollte, „ein Vorgang ohne Beispiel in der europäischen Staatengeschichte.“ 16 Die unsichere Situation der ersten Märztage des Jahres 1814 im Warten auf eine Antwort des Empereur (für die eine Frist bis zum 10. März gesetzt worden war) kam der Verwirklichung dieses Plans entgegen.
Kurze Verhandlungen am neuen Ort des alliierten Hauptquartiers in Chaumont führten zu jenem wichtigen Vertrag, der am 9. März 1814 abgeschlossen und auf den 1. März rückdatiert wurde. Österreich (vertreten durch Metternich), Russland (Nesselrode), Großbritannien (Castlereagh) und Preußen (Hardenberg) verbanden sich darin auf die Dauer von 20 Jahren zur sog. „Quadrupelallianz“.17 Diese Allianz diente einem doppelten Zweck: der Absprache von Regelungen zur Fortsetzung des Feldzugs einerseits, der langfristigen Sicherung des mit Frankreich zu schließenden Friedens andererseits. Ihrer Intention nach war sie ein „Instrument zur Erzwingung der Vertragstreue Napoleons“ und spiegelte die Grunderfahrung Europas mit der Rücksichtslosigkeit wider, mit der der Empereur sich „über die Spielregeln der Staatengemeinschaft hinweggesetzt hatte.“18 Falls Napoleon den alliierten Friedensvorschlägen nicht zustimmen würde, solle der Krieg in enger Abstimmung unter den Alliierten („dans un parfait concert“) fortgesetzt werden. Jede der Mächte solle dafür mindestens 150.000 Mann unter Waffen halten; die Briten zahlten für ihren Anteil den anderen Mächten eine Ablöse von fünf Mio. Pfund für das Jahr 1814. Separate Verhandlungen oder Vertragsabsprachen mit dem Gegner wurden untersagt. Nach einem Friedensschluss sollte jede Macht weiterhin 60.000 Soldaten unter Waffen halten, um neuen Angriffen Frankreichs rasch und effektiv entgegen zu treten. Gleichzeitig behielten sich die Alliierten das Recht vor, gemeinsam [<<31] über die geeignetsten Maßnahmen zu beraten, um Europa und sich untereinander die Einhaltung dieses Friedens zu garantieren. Um den im Friedensangebot angesprochenen Territorialregelungen besonderen Nachdruck zu verleihen, sollten Spanien, Portugal, Schweden und der Fürst von Oranien als designierter Herrscher der Niederlande eingeladen werden, der Allianz beizutreten.
2.4 Die Abdankung Napoleons
Trotz wiederholter Warnungen Caulaincourts zeigte Napoleon keine Bereitschaft, in Châtillon ernsthaft zu unterhandeln. Am letzten Tag der Frist verlangte er eine Rückkehr der Alliierten zu den Vorschlägen von Frankfurt, und erst am 15. März konnte der französische Minister einen schriftlichen Gegenvorschlag vorlegen, in dem der Verzicht auf die Illyrischen Provinzen, auf das rechte Rheinufer und die Gebiete südlich der Alpen formuliert waren. Da der Kaiser gleichzeitig seine Truppen östlich von Paris in einer Weise umgruppierte, die einen Vorstoß gegen die alliierten Nachschublinien erwarten ließ, brachen die vier Mächte am 19. März die Verhandlungen ab und einigten sich einige Tage später darauf, den Vormarsch auf Paris fortzusetzen (Plancy 24. März).19 Dies entsprach den Planungen Talleyrands in der Hauptstadt, der nur in einem Sturz Napoleons die Chance sah, für Frankreich Stabilität zu erreichen. Von Vitry-le-François aus erließen die Mächte im Namen einer „Europäischen Liga“ („ligue Européenne“) eine Erklärung, in der sie die Rückführung Frankreichs auf die Grenzen von 1792 mit dem Hinweis auf das aggressive Ausgreifen Napoleons auf dem Kontinent und auf die Erhebung neuer Souveräne aus seiner Familie rechtfertigten.20
Der Durchbruch der beiden jetzt vereinigten Armeen Schwarzenbergs und Blüchers bei Fère-Champenoise am 25. März öffnete den Alliierten den Weg nach Paris, um das am 29./30. gekämpft wurde, [<<32] während die Regentin Kaiserin Marie Louise und der Regentschaftsrat unter Joseph Bonaparte die Stadt verließen. Am letzten Märztag 1814 kapitulierte Marschall Marmont und übergab die Hauptstadt gegen Zusicherung freien Abzugs, Napoleon wich nach Fontainebleau aus, und um 10 Uhr vormittags zogen Zar Alexander, König Friedrich Wilhelm III. und Feldmarschall Schwarzenberg durch die Stadt Richtung Place de la Concorde.
Die politische Initiative ergriff jetzt Talleyrand, der seit seinem persönlichen Bruch mit Napoleon Anfang 1809 auf dessen Sturz hingearbeitet hatte. Eine Konferenz, die noch am Nachmittag des 31. März in seinem Wohnhaus in der Rue Saint-Florentin stattfand und an der der Zar, der preußische König und Schwarzenberg teilnahmen, traf die Entscheidung, im Sinn des Prinzips der Legitimität den rechtmäßigen Thronfolger aus dem Haus Bourbon, Louis Stanislas Xavier von Frankreich, Graf von Provence, zurückzuholen, allerdings nicht als absoluten, sondern als konstitutionellen Herrscher. Der Zar machte diesen Grundsatzbeschluss in einer auf den 2. April datierten Proklamation bekannt, in der er – zur nicht geringen Bestürzung Castlereaghs und vor allem Metternichs, die erst am 10. April nach Paris kamen – über die bisherigen Beschlüsse der Alliierten weit hinausging und eine klare Alternative formulierte: Die Person Napoleons sei das entscheidende Hindernis für den Frieden; weder mit dem Kaiser noch mit einem Mitglied seiner Familie würden die Alliierten künftig mehr verhandeln. Die Franzosen hätten „die Wahl … zwischen ihrem Kaiser und dem Frieden.“ Die Rückkehr der bourbonischen Könige wurde noch nicht erwähnt.21
Der Senat setzte am 1. April eine provisorische Regierung ein, der Talleyrand vorstand. Sie erarbeitete innerhalb einer Woche eine neue, provisorische Verfassung, die ein erbliches, konstitutionelles Königtum der Bourbonen vorsah. Auf dieser Basis erklärte der Senat am 3. April 1814 Napoleon als Kaiser der Franzosen für abgesetzt. Eine Nachfolge aus dem Kreis der Familie Bonaparte wurde ausgeschlossen. Das zentrale [<<33] politische Argument für diesen Bruch lag in der Vorgabe, dass Frankreich nur auf diese Weise ein Ende des Krieges erreichen konnte.
In Fontainebleau reagierte Napoleon auf diese Entwicklungen mit neuen Kriegsplänen. Zum entscheidenden Faktor wurde jetzt die Loyalität der Armee, und sie ging dem Kaiser nun verloren: Am 4. April verweigerten die Marschälle unter Ney den Gehorsam und forderten ihn zur Abdankung auf. Napoleon wollte diese zunächst von Bedingungen (wie dem Nachfolgerecht seines Sohnes) abhängig machen, erklärte dann aber am 6. April seinen bedingungslosen Rücktritt unter Einschluss seiner Erben, der (nach dem Abschluss vertraglicher Regelungen über die Versorgung seiner Person und seiner Familie; 11. April) am 13. April in Kraft trat. Offiziell stilisierte der Empereur seinen Rücktritt, bevor er sich am 20. April zur Abreise Richtung Elba aufmachte, zu einem persönlichen Opfer, das er im Interesse Frankreichs darbringe. Er nahm dabei auf Alexanders Erklärung Bezug, seine (Napoleons) Person bilde „das einzige Hindernis auf dem Wege zur Wiederherstellung des Friedens in Europa.“22 Napoleon wurde wie ein herrschender Souverän behandelt und deswegen mit der Herrschaft über ein neues, freilich sehr kleines Territorium, das Fürstentum Elba, abgefunden. Metternich hielt die Übertragung dieser Insel, die ihm viel zu nahe an Frankreich und Italien zu liegen schien, für einen Fehler des Zaren – mit Recht, wie sich im Frühjahr 1815 zeigen sollte. Ansehnliche Pensionszahlungen in Höhe von viereinhalb Mio. (für das Kaiserpaar allein zwei Mio.) Francs jährlich sicherten der verzweigten Familie Bonaparte „ein komfortables Exil“.23
2.5 Der Friedensvertrag und der Weg zum Kongress
Am 12. April 1814, dem Tag vor Napoleons formeller Abdankung, war der jüngere Bruder des bourbonischen Thronprätendenten, Charles [<<34] Philippe de Bourbon, Graf von Artois (der spätere König Karl X.), in Paris angekommen. Auch in seinem Namen schloss Talleyrand nach Verhandlungen von wenigen Tagen Dauer am 23. April 1814 einen Waffenstillstand mit den vier alliierten Großmächten, dem auch noch Portugal beitrat. Darin wurde auch die Räumung jener etwa 50 befestigten Plätze vereinbart, die in Mitteleuropa noch in der Hand von französischen Truppen waren.24
Die freundliche Aufnahme seines Bruders in Paris brachte den Thronprätendenten Louis, Bruder des 1793 hingerichteten Königs Ludwig XVI., auf die Idee, entgegen den Empfehlungen Talleyrands und des Zaren die vom französischen Senat verabschiedete Verfassung nicht zu akzeptieren. Am 20. April verließ er sein Exil nahe Oxford, setzte auf einem britischen Schiff über den Kanal und erklärte, sich unter Berufung auf seine ererbte Machtstellung ohne weiteres als Ludwig XVIII., von Gottes Gnaden König von Frankreich und Navarra bezeichnend, am 2. Mai in St. Ouen, am Stadtrand von Paris, dass er die Verfassung nicht anerkennen werde. Er versprach die Wahrung gewisser Grundrechte und die Einrichtung einer Volksrepräsentation, machte aber deutlich, dass er nicht gewillt sei, sein Königtum zu Bedingungen zu übernehmen, die andere ihm diktiert hatten. Am 3. Mai hielt er seinen Einzug in Paris.
Der neue, aus eigener Machtvollkommenheit agierende König akzeptierte gleichwohl eine Verfassungsurkunde, die unter Wahrung seiner Prärogativrechte, also in einem von ihm als Souverän angestoßenen und kontrollierten Verfahren, entstand. Er beteiligte sich in der zweiten Maihälfte persönlich an der Ausarbeitung einer „Charte constitutionelle“ für Frankreich, die am 4. Juni 1814 feierlich proklamiert wurde. Sie wahrte, etwa bei der Entscheidung über Krieg und Frieden, die königlichen Rechte gegenüber dem Zwei-Kammer-Parlament und wurde mit der von Jacques Claude Beugnot ganz im Sinn des monarchischen Prinzips formulierten Präambel „eines der klassischen Dokumente der Restaurationsideologie.“25 [<<35]
In diese bewegten Tage der französischen Innenpolitik fiel die formelle Beendigung des Kriegszustandes zwischen Frankreich und seinen Gegnern. Talleyrand, den Ludwig XVIII. am 13. Mai im Amt des Außenministers bestätigte, verhandelte mit Razumovskij und Nesselrode als Bevollmächtigten des russischen Zaren, mit Metternich und Stadion in Vertretung des österreichischen Kaisers, Castlereagh, Aberdeen, Cathcart und Stewart für den britischen König bzw. Prinzregenten sowie Hardenberg und Humboldt für den König von Preußen. Ein österreichischer Entwurf hatte die wenigen bisher getroffenen territorialen Absprachen des Frühjahrs 1814 zusammengefasst: Rückkehr der Bourbonen auf den spanischen Thron; Unabhängigkeit und territoriale Vergrößerung der Niederlande; Umgestaltung der Schweizer Eidgenossenschaft unter Beteiligung und Garantie der Großmächte sowie Wiederherstellung der Staatenwelt Italiens, während für die deutschen Gebiete eine Ergänzung der souveränen Fürstenstaaten um ein föderales Band zur Garantie von Unabhängigkeit und Sicherheit vorgesehen war.
Für die Verhandlungen hatte es einen großangelegten Plan zur Neuverteilung der politischen Kräfte in Europa gegeben, den der preußische Staatskanzler Hardenberg nach eingehenden Besprechungen mit dem österreichischen Gesandten Stadion und mit Billigung Castlereaghs Ende April 1814 ausgearbeitet hatte. Er sah noch substantielle Abtretungen von polnischen Gebieten zugunsten von Preußen (bis zur Warthe; ca. 1,3 Mio. Menschen) und Österreich (um Krakau und Zamość; ca. 300.000 Menschen) vor. Preußen verlangte außerdem das ganze Königreich Sachsen, die Herzogtümer Berg, Westfalen und Nassau sowie Entschädigungsgebiete beiderseits des Rheins zwischen Mainz und Wesel. Für beträchtliche Unruhe sorgte Preußens Anspruch auf die bisher unter dem Dach des Rheinbundes souveränen Kleinfürstentümer Waldeck-Pyrmont, Lippe-Detmold, Reuß und Schwarzburg. Österreich sollte nicht nur Tirol, Salzburg und das Innviertel wieder erhalten, sondern durch einen breiten, über Vorarlberg und Breisgau bis an den Oberrhein reichenden Gebietsstreifen wieder im deutschen Südwesten verankert werden. Für die süddeutschen Mittelstaaten Bayern (mit geschlossenem Territorialbesitz zwischen Franken und der Pfalz), Württemberg, Baden (das weit nach Nordwesten an die Mosel verschoben wurde), Hessen-Darmstadt [<<36] und Hessen-Kassel erarbeitete Hardenberg detaillierte Entschädigungskonzepte, die auch das linke Rheinufer einbezogen. Für die Niederlande schlug er eine beträchtliche Vergrößerung um Belgien, eine Grenze an der Maas zwischen Venlo und Lüttich sowie südlich der Maas einen Gebietskorridor bis Luxemburg vor. In Übereinstimmung mit den Interessen der Briten begründete er: „Holland, dessen Bedeutung für die Abstützung des Systems, das man in Europa einzurichten beabsichtigt, und besonders für die Unabhängigkeit Norddeutschlands und Preußens allgemein anerkannt wird, muß stark gemacht werden und eine territoriale Kraft erhalten, die es befähigt, sich erfolgreich gegen jeden Angriff zu verteidigen.“ König Vittorio Emanuele I. von Sardinien-Piemont, der im Mai 1814 nach Turin zurückkehren konnte, sollte Genua, Nizza und einen Teil seiner savoyardischen Stammlande erhalten. Für die Westgrenze Frankreichs schlug Hardenberg einige Korrekturen vor, u. a. die Abtretung der Festung Landau in der Pfalz. Der schwedische König sollte, wie im Kieler Frieden von Anfang 1814 vereinbart, Norwegen übernehmen, die monarchischen Staaten in der Mitte und im Süden Italiens wiederhergestellt werden und „Deutschland … einen Bund souveräner, aber untereinander durch einen Bundesvertrag wohl geeinter Staaten bilden.“26
Am Rhein freilich wollte Metternich den Preußen eine begehrte Schlüsselposition, die Festung Mainz, nicht zugestehen und dort lieber Bayern verankert sehen, mit dessen Vertreter Wrede er in Paris eingehende Gespräche führte. Der Zar lehnte allerdings alle Abstriche an seinen Ansprüchen auf Polen Anfang Mai rundheraus ab. Und mit der Etablierung Ludwigs XVIII. war auch der Versuch der Siegermächte obsolet, Frankreichs Mitsprache bei der Neuordnung Europas zu verhindern. Graf Münster, der Vertreter Hannovers, schrieb dem englischen Prinzregenten am 5. Mai, ein wieder von den Bourbonen regiertes Frankreich könne auf keinen Fall als besiegte Macht behandelt werden.27
Der zwischen Frankreich und den vier genannten Mächten jeweils wortgleich abgeschlossene Vertragstext (geheime Zusatzabreden betrafen [<<37] je unterschiedliche bilaterale Punkte), datierend vom 30. Mai 1814, wird heute in der Regel als „Erster Pariser Friede“ bezeichnet, um ihn von jenem „Zweiten“, für Frankreich ungünstiger ausfallenden Friedensvertrag zu unterscheiden, den die Alliierten nach Napoleons Herrschaft der „Hundert Tage“ und seiner endgültigen militärischen Niederlage am 20. November 1815 mit Ludwig XVIII. abschlossen. Dem Vertrag vom 30. Mai traten auch die übrigen kriegführenden Parteien Schweden, Portugal (mit einem Vorbehalt wegen Grenzziehungen in Südamerika) und Spanien (erst am 20. Juli 1814) bei.28
Das Vertragswerk nannte neben der Wiederherstellung des Friedens in seiner Präambel eine gerechte Kräfteverteilung unter den Mächten, die Sicherheit und Stabilität Europas und die Fixierung möglichst dauerhafter Bestimmungen als politische Ziele. In einem Zusatzartikel wurden alle Friedensverträge der napoleonischen Zeit und ihre territorialen Regelungen nochmals ausdrücklich außer Kraft gesetzt.
• Frankreich bekam seinen Gebietsstand vom 1. Januar 1792 mit einigen geringfügigen Korrekturen garantiert. An der Saar und in Savoyen wurden sogar Gebietserweiterungen gegenüber dem Stichtag zugestanden, etwa der Besitz der rechtsrheinischen Festung Landau in der Pfalz, der Gebiete von Chambéry und Annecy in Savoyen, von Mühlhausen, Mömpelgard und der südfranzösischen Grafschaften Avignon und Venaissin. Für den Zugang zur Stadt Genf von der Schweiz her wurden Regelungen über die gemeinsame Nutzung von Straßen getroffen. In Art. 18 wurde auf die Zahlung einer Kriegsentschädigung, an der vor allem Preußen interessiert gewesen wäre, ausdrücklich verzichtet. Den Käufern von außerhalb der alten Grenzen gelegenen französischen Nationalgütern wurde die Rechtsgültigkeit ihrer Erwerbungen ausdrücklich zugesagt.
• Die nördlichen Niederlande (der Vertragstext spricht in Art. 6 von „La Hollande“) wurden unter die Herrschaft des Hauses Oranien-Nassau [<<38] in Person des Prinzen Wilhelm VI. von Oranien, der seit 1813 den Titel eines Souveränen Fürsten der Niederlande führte, gestellt; sie sollten eine substantielle Gebietsvergrößerung erhalten.
• Der Schweizerischen Eidgenossenschaft wurden Unabhängigkeit und Selbstregierung nach von den Großmächten garantierten Grundsätzen zugesagt.
• Frankreich anerkannte die Regelungen des Kieler Friedens zwischen Großbritannien, Dänemark und Schweden vom 14. Januar 1814, der u. a. den Übergang Norwegens von Dänemark an die Krone Schweden festlegte, um diese für den Verlust Finnlands zu entschädigen.
• Auch die koloniale Welt war in die Gebietsregelungen des Friedensvertrags einbezogen. Frankreich erhielt seine überseeischen Besitzungen zurück; ausdrücklich genannt wurden das südamerikanische Guayana und Guadeloupe, für das der König von Schweden, seit 1813 Besitzer dieser Antilleninsel, eine hohe Entschädigungszahlung kassierte. Den 1795 übernommenen Ostteil der Insel Hispaniola/Santo Domingo (das Gebiet der heutigen Dominikanischen Republik) sollte Frankreich an Spanien zurückgeben. Die Briten behielten allerdings Tobago, St. Lucia und die „Île de France“ (Mauritius samt den Seychellen) für sich und ließen sich auch die Verdrängung des Johanniterordens von der Insel Malta förmlich anerkennen.
• Die britische Regierung verpflichtete die Franzosen in einem Zusatzartikel zu unterstützenden Maßnahmen bei der Durchsetzung des Verbots des Sklavenhandels binnen einer Übergangsfrist von fünf Jahren.
• Für Rhein und Schelde wurde die Errichtung eines Regelwerks vereinbart, das eine grundsätzliche Freiheit der Schifffahrt und eine akkordierte Erhebung von Abgaben garantieren sollte. Solche Regularien sollten später auch für andere Flussläufe getroffen werden.
• Noch sehr unbestimmt fielen die territorialen Rahmenbedingungen für den mitteleuropäischen Raum nördlich und südlich der Alpen aus. Art. 6 schrieb eine staatenbündische Lösung für den deutschen Raum fest („Les Etats de l’Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif“). Auf der Apenninenhalbinsel wurde Österreich eine Einflusszone im Norden vorbehalten (ein geheimer Zusatzartikel nannte die Flüsse Po und Ticino sowie den Lago Maggiore als Grenzen der [<<39] künftigen österreichischen Besitzungen in Italien), südlich davon sollte es zur Wiederherstellung selbständig-souveräner Staatswesen kommen („L’Italie … sera composée d’Etats souverains“).