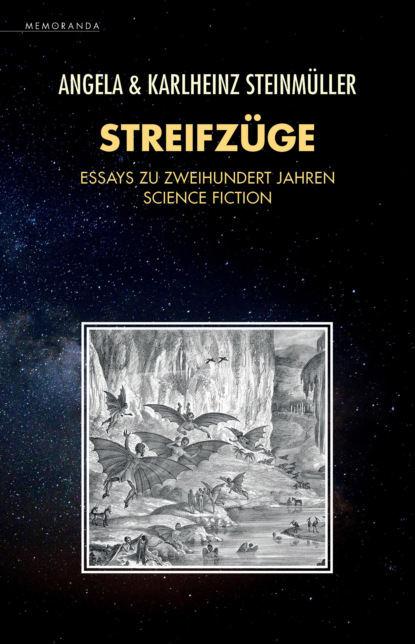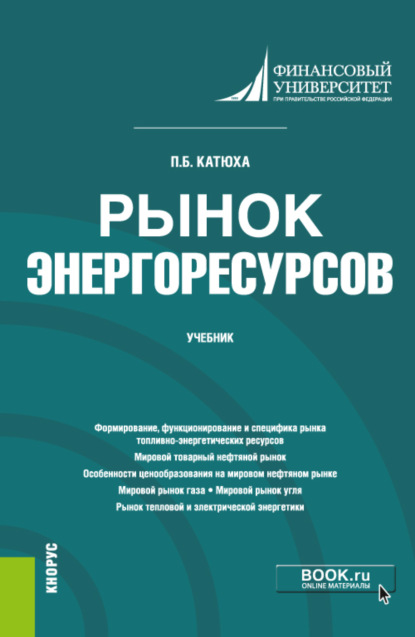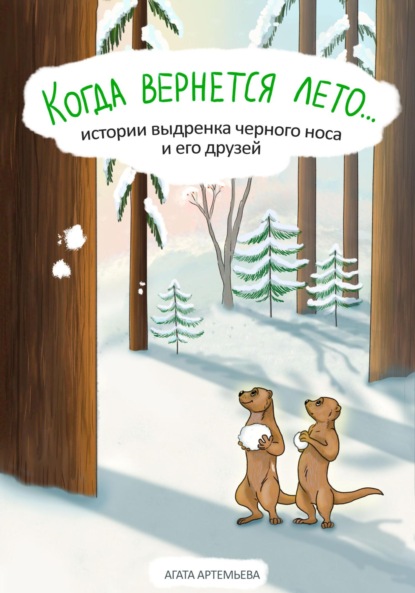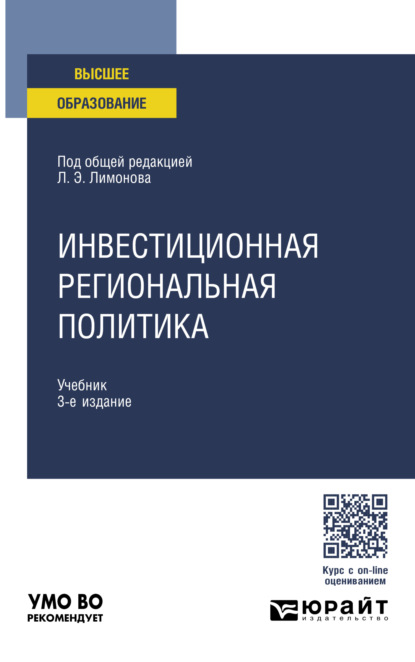- -
- 100%
- +

Angela und Karlheinz Steinmüller
Streifzüge
Essays zu zweihundert Jahren
Science Fiction
Angela und Karlheinz Steinmüller
Werke in Einzelausgaben. Essays Band 1
Herausgegeben von
Erik Simon
Impressum
Angela und Karlheinz Steinmüller: Streifzüge
Essays zu zweihundert Jahren Science Fiction
(Werke in Einzelausgaben. Essays Band 1)
Herausgegeben von Erik Simon
Titelbild: Ausschnitt aus der Lithographie »Lunar Animals and other Objects Discovered by Sir John Herschel in his Observatory at the Cape of Good Hope«, 1835
Originalausgabe
Erste Auflage 2021
© 1992, 2021 Angela Steinmüller (für »Rückblick auf das Atomzeitalter«)
© 1981–2021 Karlheinz Steinmüller (für die übrigen Essays und das Vorwort)
Die Daten der Erstpublikationen sind der »Publikationsgeschichte« am Ende des Bandes zu entnehmen.
© 2021 Erik Simon und Memoranda Verlag (für die Zusammenstellung dieser Ausgabe)
© dieser Ausgabe 2021 by Memoranda Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Erik Simon
Korrektur: Christian Winkelmann
Gestaltung: Hardy Kettlitz & s.BENeš [www.benswerk.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
ISBN: 978-3-948616-58-8 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-59-5 (E-Book)
Inhalt
Impressum
Inhalt
Streifzüge durch das Land der Fiktionen
Vorwort
Die Geburt der Science Fiction aus dem Geist des 19. Jahrhunderts
Von Megapatagonien nach Ikarien
Die französischen utopischen Voyages Imaginaires
Der erste letzte Mensch
Die italienische Mondexpedition von 1836
Der Moon Hoax und seine Folgen
Die dampfbetriebene Antiutopie
Émile Souvestre und die »littérature futuriste«
Mit dem Zug ins All
Jules Verne und der Einfluß der Eisenbahn auf die Science Fiction
Where Science Would Take the Place of Chance
Vom Scientific Detective zur Science Fiction
Nihilit und Neue Erde
Robert Kraft als Science-Fiction-Autor
Interplanetary Man
Olaf Stapledons visionäre Future History
Einmal Raketenantrieb und zurück
Raumfahrt und Science Fiction
Rückblick auf das Atomzeitalter
Science Fiction zwischen Paradies und Weltuntergang
Das Linebarger-Universum
Zum Werk von Cordwainer Smith
Über Lem und GOLEM
Eine Betrachtung aus dem Jahr 1981
USS Enterprise: Heimathafen DDR?
Star Trek – beinahe eine sozialistische Utopie
Arkadi und Boris Strugatzki als Experimentatoren
Und ewig grüßt der Generalsekretär
Die DDR in der Alternativgeschichte
Publikationsgeschichte
Abbildungsverzeichnis
Bücher bei MEMORANDA
Streifzüge durch das Land der Fiktionen
Vorwort
Die Geschichte der Science Fiction steckt voller Überraschungen, wie sollte es auch anders sein. Wer Streifzüge kreuz und quer durch die weniger bekannten Gefilde unternimmt, entdeckt, daß italienische Graphiker schon im Jahr 1836 auf dem Mond waren, mit Ballons versteht sich, daß SF und Detektivgeschichte gemeinsame Wurzeln haben, daß an Bord der USS Enterprise beinahe kommunistische Verhältnisse herrschen und daß erste Vorahnungen des Internets bei Tiphaigne de la Roche zu finden sind – im Jahr 1760.
Im Grunde genommen verdankt diese Essaysammlung ihren Ursprung dem chronischen Unterangebot an Science Fiction in der DDR. Als junger Mensch war ich ständig auf der Suche nach spannendem Lesefutter. Die Stadt- und Kreisbibliotheken boten kaum mehr, als ich selbst besaß. Also stöberte ich in den Antiquariaten von Karl-Marx-Stadt und Berlin, fand da tatsächlich manch Unerwartetes – wie etwa eine englische second impression der Erstausgabe von Huxleys Brave New World, allerdings mit häßlichen Kritzeleien eines überforderten Übersetzers. Später nutzten Angela und ich jede Urlaubsreise ins (sozialistische) Ausland für Pirschgänge durch Antiquariate und Buchläden mit fremdsprachigem Angebot. Auf dem Stadtplan von Budapest konnte ich fast ein Dutzend Stellen markieren: Hier lohnt es sich nachzusehen! Aber selbst in Städten wie Jihlava oder Irkutsk wurden wir fündig.
Seit 1990 hat sich der Radius unserer Pirschgänge zweimal erweitert. Zuerst kamen die Bouquinisten am Seineufer und auf dem Pariser Flohmarkt dazu, ebenso der Phantastik-Buchladen in der Brüsseler Innenstadt und die wundervollen Second Hand Bookshops im »Bücherdorf« Hay-on-Wye. Dann begannen große Bibliotheken, aber auch Google und Co., die alten Bestände einzuscannen. Heute kann man sich beispielsweise fast alle einschlägigen französischen Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundert dank www.gallica.fr herunterladen. Das ist die Art von Digitalisierung, die ich mir immer gewünscht habe!
Viele der hier abgedruckten Essays beruhen jedoch nicht auf Zufallsfunden, sondern auf Vorträgen, die ich bei vielfältigen Gelegenheiten gehalten habe. So wurde ich in den 1980er Jahren mehrmals von der Evangelischen Akademie Berlin eingeladen, über Themen wie »Beflügelnde Utopie oder gefürchteter Dämon: Technik als Inbegriff des Fortschritts« mit Beispielen aus alter und neuer Science Fiction vorzutragen. Mit den Jahren wuchs das Material, das ich für ähnliche Vorträge im Kulturbund oder auf Urania-Veranstaltungen sammelte, und als ich 1988 die Notizen auf unserem ersten PC erfaßte, hatte ich tagelang zu tippen. Angela erkundete bald eine eigene Strecke von SF-Geschichte: Nach der Wende befaßte sie sich mit dem Zukunftsbild in der utopischen Literatur der DDR, und sie stieß in dem Zusammenhang auch auf die zwiespältigen Visionen des Atomzeitalters in Ost und West. Die Geschichte der SF in der DDR lag uns naturgemäß besonders nahe. Wir haben darüber vor vielen Jahren einen Band veröffentlicht: Vorgriff auf das Lichte Morgen. Der bedarf allerdings dringend der Erweiterung und Aktualisierung …
Zu diesem »lichten Morgen« von damals gehört auch die »Eroberung des Weltraums«, ein Thema, das mich von Kindesbeinen an fasziniert hat. Gelegentlich trug ich auf raumfahrthistorischen Kolloquien über das Wechselspiel von Science Fiction und früher Astronautik vor und stellte dabei fest, wie eng doch diese Beziehungen waren und wie weit sie zurückreichen. Die Arbeit an unserer Darwin-Biographie hatte ohnehin mein Interesse für das 19. Jahrhundert entzündet, für das viktorianische Zeitalter mit seiner ungeheuren Dynamik, seinen rapiden technischen und gesellschaftlichen Umbrüchen, die sich in der frühen SF nicht nur widerspiegelten, sondern sie überhaupt erst hervorbrachten. Allerdings ist die Vor- und Frühgeschichte der englischsprachigen SF weithin bekannt; viel weniger kennt man dagegen die französische Traditionslinie. Hier lag für mich dann ein überaus spannendes Feld – meist noch in der Epoche vor Jules Verne. Welchen Anteil Phantasiereisen an der Entstehung der SF hatten, wurde mir erst im Laufe der Zeit klar. Als Zukunftsforscher bin ich es gewohnt, daß die Kollegen stets davon reden, daß wir heute in einem einzigartig dynamischen, extrem beschleunigten Zeitalter leben, sozusagen auf der Welle der Innovationen surfen und dabei kaum die Balance zu halten verstehen. Ja, das war auch schon vor zweihundert Jahren das vorherrschende Zeitgefühl. Und ebenso fürchtete man den bevorstehenden Weltuntergang.
Science Fiction, sagt man, sei ein Fenster zu fremden Welten. Sie ist aber auch ein Fenster zu unserer eigenen irdischen Vergangenheit – zu den Zukunftsvisionen früherer Generationen, zu ihren Ängsten, ihren Hoffnungen, ihren Obsessionen, ihren bald hellsichtigen, bald verqueren oder auch nur peinlichen Phantasien. Man kommt bei solchen Streifzügen den Menschen von damals – zumindest den schreibenden Phantasten! – recht nahe. Das relativiert die eigenen Überzeugungen: Was wird einmal von den heutigen angeblichen Wahrheiten übrigbleiben, was wird man künftig als verquer belächeln oder gar als Peinlichkeit beiseite schieben? Ist das, was heute als neu, progressiv, innovativ und zukunftsweisend gilt, vielleicht nur mäßig aufgewärmtes altes Ideengut, verpackt in modischem Zeitgeist? Oder gibt es in der Science Fiction genuine Fortentwicklung, nicht bloße Tradierung, sondern eine permanente Entfaltung von Konzepten, Erzählweisen, Begrifflichkeiten und Gedankengebäuden so wie in der Wissenschaft? Bisweilen ähnelt die Science Fiction tatsächlich in dieser Beziehung einer sehr spezifischen, rein imaginären Forschungsrichtung. Heutige Autoren bauen auf den Ideen älterer Autoren auf, entwickeln diese weiter, finden und erfinden neue Konsequenzen. Man denke nur an Zeitreisen und Alternativgeschichte, Spekulationen über nichtmenschliche – außerirdische und künstliche – Intelligenz. Aber vergessen wir nicht, daß Science Fiction zuallererst einmal kritische Kommentare zu gesellschaftlichen Verhältnissen abgibt. Auch unter diesem Gesichtspunkt lohnt sich ein Blick zurück in die Geschichte der SF.
Die hier abgedruckten Essays sind im Verlauf von fast vier Jahrzehnten – zwischen 1981 und 2019 – und aus sehr unterschiedlichen Anlässen heraus entstanden. Da lag es nahe, zumindest die älteren Texte redaktionell durchzusehen, gegebenenfalls kleinere inhaltliche Ergänzungen anzubringen und nicht zuletzt die Zitierweisen anzugleichen. So werden jetzt in deutscher Übersetzung vorliegende Werke mit deutschem Titel erwähnt, aber mit dem Jahr der Originalpublikation. Zitate und Verweise habe ich möglichst einfach gehalten. Bei der Überarbeitung und generell bei der Konzipierung und Vorbereitung des Bands hat mich Erik Simon maßgeblich unterstützt; mein Dank gilt ebenso dem Verleger unserer Werkausgabe Hardy Kettlitz, der uns zu diesem Band ermutigte.
Ohne die »Cons« aber, die Zusammenkünfte (conventions) von Science-Fiction-Freunden, wäre die Hälfte der Essays in diesem Band nicht entstanden. In jährlichem Wechsel werde ich nach Leipzig und nach Dresden zu derartigen Cons eingeladen, ab und zu auch in den Andymon-Club hier in Berlin, jedesmal für einen Vortrag, und jedesmal habe ich den Ehrgeiz, eine weniger bekannte Ecke der Science Fiction auszuleuchten oder auch einfach Ergebnisse unserer Streifzüge vorzustellen. Immer heißt es dann: Schreib doch etwas für unser Con-Buch. Und ständig prasseln dabei neue Anregungen auf mich ein. – Aus diesem Grund richtet sich mein abschließendes Dankeschön an all die Science-Fiction-Freunde, die unseren Weg begleiten.
Karlheinz Steinmüller
Die Geburt der Science Fiction aus dem Geist des 19. Jahrhunderts
Ein altes und immer junges Genre
Wer nach den Anfängen der Science Fiction sucht, steht vor denselben Schwierigkeiten wie ein Ahnenforscher: Zu jedem Großvater, jeder Großmutter existieren ein Urgroßvater und eine Urgroßmutter, die Reihe der Vorfahren scheint nie enden zu wollen, es sei denn bei Adam und Eva. So wundert es nicht, daß man sich bei der Science Fiction auf die klassischen Utopien von Morus bis Campanella als Großeltern mütterlicherseits und auf phantastische Reiseromane als Großeltern väterlicherseits beruft. Gern verweist man auf die Geschwister von Schauerroman bis Fantasy, auf die Robinsonaden als Vettern und die romantischen Zaubermärchen als Basen. Wer es besonders gut meint, spürt Verwandte überall auf, in Tausendundeiner Nacht, in Goethes Faust, in Shakespeares Sommernachtstraum, in Voltaires Micromegas. Manch einer beschwört wie etwa James Gunn zwar nicht Adam und Eva, aber doch mythische Urahnen, die Odyssee oder das Gilgamesch-Epos. Andere gehen mit Juli Kagarlizki auf die Weltraumreiseerzählungen von Lukian, Francis Godwin und Cyrano de Bergerac und die utopisch-satirischen Romane von Rabelais, Swift und Voltaire zurück. Es hängt eben davon ab, was man alles unter SF faßt. Bei so verschiedenen Autoren wie etwa Brian Aldiss oder Hans Esselborn scheint sich ein Konsens herauszustellen, daß die SF im 19. Jahrhundert entstand, je nach Gusto mit Mary Shelleys Frankenstein (1818) oder Felix Bodins Roman de l’Avenir (1834) oder mit Edgar A. Poe oder spätestens mit Jules Verne.
SF ist, die These sei vorangestellt, im Kern eine Literatur, die den wissenschaftlichen, technischen und teilweise auch den sozialen Fortschritt thematisiert, und als solche ein Reflex auf die industrielle Revolution. Sie verdankt ihre Entstehung dem Jahrhundert, in dem die auf Anwendung der Wissenschaft basierende Fortschrittsidee die Gesellschaft durchdrang. Tatsächlich sind die gern als Gründerväter der SF apostrophierten Autoren Jules Verne und Herbert G. Wells oder auch Kurd Laßwitz nicht nur im 19. Jahrhundert geboren; sie empfingen in diesem ihre wesentlichen Anregungen, und sie verfaßten ihre Hauptwerke entweder noch vor der Jahrhundertwende oder zumindest bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Nicht allein vom gedanklichen Gehalt her, auch aus Sicht der Marktbedingungen ist die SF ein Produkt des Fortschritts. Damals, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, weitete sich der traditionelle Kreis der Literaturkonsumenten extrem aus, denn die industrielle Revolution zog die Volksbildung nach sich, für die Fabrik wie für die Kaserne waren wenigstens elementare Kenntnisse nötig. Fabrikarbeiter und Dienstmädchen strebten in ihrer raren Freizeit nach Bildung und mehr noch nach Unterhaltung, um aus dem rußgrauen Alltag in die beneideten »besseren Kreise« oder die »heile«, halb vergangene Dorfheimat zu entfliehen. Aber auch Sensationslektüre jeglicher Art verschaffte Ablenkung und Kitzel: das Abenteuer unter wilden Rothäuten, die Gefahren der nächtlichen Großstadt oder des Spukhauses. Lieferungs- und Groschenromane fanden reißenden Absatz, und selbst wohlsituierte Bürger verschmähten auf einer Zugfahrt die billige Entspannung nicht, die die Bahnhofsbuchhandlungen und Eisenbahn-Leihbüchereien anboten.
Dieser plebejischen Familie der »Trivialliteratur« entstammt die SF. Sie sprach Dinge an, die man im Heimat- oder Adelsroman so wenig fand wie in Indianergeschichten. Sie stellte die Abenteuer, die sich aus dem alles verändernden wissenschaftlichen und technischen Fortschritt ergaben, in den Mittelpunkt, und sie verstand es von Anfang an, mit den Hoffnungen und Ängsten zu spielen, die sich daran knüpften: Hoffnungen auf eine Technik, die den Alltag erleichtert, und auf eine ausbeutungsfreie Gesellschaftsform, Angst vor einem die Zivilisation zerstörenden Zukunftskrieg oder vor der Versklavung des Menschen durch die Maschinen.
Man könnte nun Bücher und Autoren im einzelnen auflisten und die hellseherischen Leistungen der SF des 19. Jahrhunderts rühmen: Weltraumreisen, Navigationssatelliten, U-Boote, Fernsehen, Raumstationen[1] und als abschließende Rundumprognose Hugo Gernsbacks Roman Ralph 124C41+ (1911–12) ins Feld führen. Das wird oft getan, und doch ist es willkürlich und verkürzt die SF ungerechtfertigterweise auf Prognostik im literarischen Gewand. Erst dann sind wir berechtigt, von einem Ursprung der SF im 19. Jahrhundert zu sprechen, wenn es gelingt nachzuweisen, daß
die wesentlichen Traditionslinien im Themen- bzw. Motivkanon der SF dem 19. Jahrhundert entstammen,
die phantastischen Handlungsabläufe auf weltanschaulichen Ideen gründen, die im 19. Jahrhundert Allgemeingut wurden und die damals wie heute die Handlung dem Leser plausibel machten.
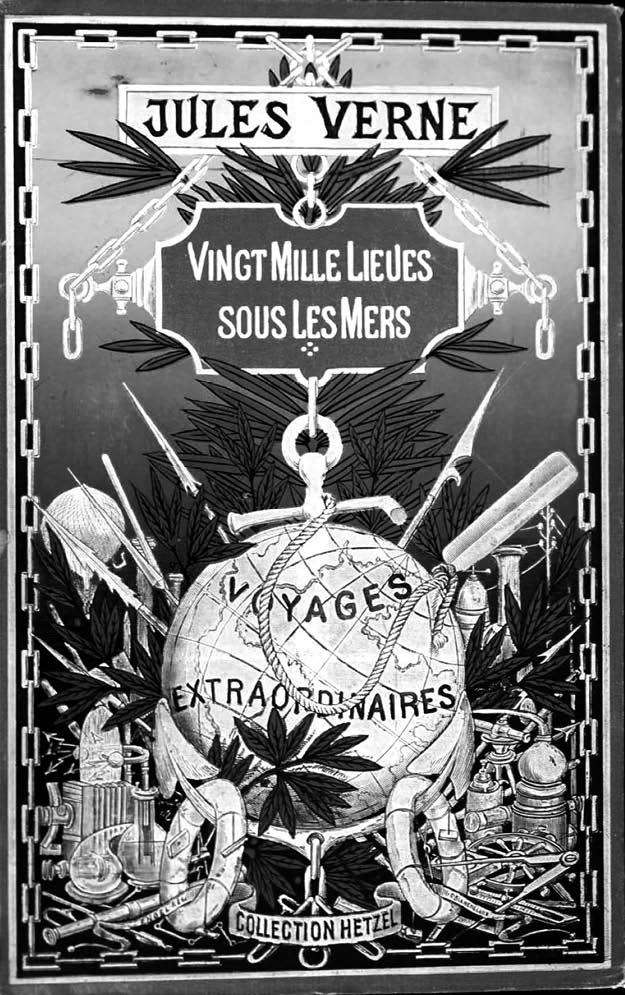
Die Legitimationsstränge der SF
Die neuen Leserschichten wünschten sich kurzweilige, spannende Unterhaltung, eine zeitgemäße Lektüre, die man abends im Schein des modernen Gaslichts oder der Petroleumlampe verschlingen konnte. Früher ließen die Autoren, wenn sie der geistigen und politischen Elite ihrer Zeit ideale Staatsmodelle anempfehlen wollten, noch fiktive Reisende von einer fernen Insel Utopia berichten. Jetzt aber überzeugte den abenteuerhungrigen Durchschnittsleser der Verweis auf eine unentdeckte Insel hinter Südamerika nicht mehr[2], denn die kolonialen Eroberer waren längst dabei, die letzten weißen Flecken auf der Landkarte englisch-rot oder in den Farben Frankreichs zu schraffieren. Die idealen Gemeinwesen der Literatur verfielen zu mythenhaften, untergegangenen Hochkulturen, der lost race eines H. R. Haggard, und lösten sich mit zunehmender Kenntnis des Erdballs schließlich völlig auf. Es ist durchaus aussagekräftig, wie Pierre Benoit in L’Atlantide (1920) das mythische Atlantis auf eine sandverwehte, halb entvölkerte Höhlenstadt mitten in der französisch kolonisierten Sahara – samt zeittypischer femme fatale – reduziert.
Dazu verlangten die Leser nach packender Darstellung, nach dem Anschein der Wirklichkeit, nach guten Vorwänden, sich auf die spekulativen Abenteuer der Autoren einzulassen. Wie aber sollte es gelingen, Phantastisches, Unmögliches oder Noch-nicht-Mögliches als wirklich und wahrheitsgemäß auszugeben? Gewiß bewirkt ein lebenspraller Stil mit Figuren aus Fleisch und Blut und flotten Dialogen hier Wunder, doch er allein genügte noch nicht. Die Leser erwarteten, daß die phantastische Handlung überzeugend eingeleitet und eingebettet wurde. Berichte von Reisenden in ferne Länder und aufgefundene Manuskripte bieten einen recht brauchbaren Rahmen. Viele Autoren nicht nur der SF, sondern auch Schriftsteller mit einem Hang zur Romantik wie Washington Irving ließen einer halbwegs plausiblen Einbettung wegen ihre Helden einige Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte verschlafen. Erwachten sie, durften sie mit verdutzten Augen die Wunder der Zukunft bestaunen. Edward Bellamy nutzte in seiner berühmten Sozialutopie Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 (1888) den Vorzug dieser Methode, zwei Zeiten aus der Sicht des Helden konfrontieren zu können; auf ähnliche Weise versetzte H. G. Wells einen Gegenwartsmenschen in eine hochtechnisierte und totalitäre Zukunftswelt (Wenn der Schläfer erwacht, 1899). Noch lange traf man in der SF vereinzelt auf Siebenschläfer, so in Laurence Mannings Der Jahrtausendschläfer (1933) oder in Juri und Swetlana Safronows Der Südpol schmilzt (1958). Heute genügen relativistische Effekte, kombiniert mit Kälteschlaf in einem Raumschiff, um die Helden in die Zukunft zu versetzen.
Doch Einbettungen gleich welcher Art verbrauchen sich schnell. Sind die Leser erst einmal an Zukunftsdarstellungen gewöhnt, kann auf das Vehikel, den vordergründigen Erzählanlaß, verzichtet werden.
Die SF ruhte bereits vor dem Ersten Weltkrieg genügend fest in ihren Traditionen, um äußerlicher Erläuterungen, wie der Roman oder die Erzählung entstanden sein könnte, woher der Autor sein Wissen habe, entbehren zu dürfen. Nicht verzichten jedoch kann die SF auf eine innere, inhaltliche Legitimation ihrer phantastischen Momente, auf hinreichend starke Anknüpfungspunkte an bekannte Bildungsgüter und weltanschauliche Grundideen, die die unwirkliche, ja unmögliche Handlung zumindest als denkmöglich (»in der Zukunft«, »auf einem anderen Stern«) erscheinen lassen und es dem Leser erlauben, sich auf den Text einzulassen. Bellamy etwa berief sich auf den Mesmerismus, der zu seiner Zeit mitunter noch für eine Wissenschaft gehalten wurde, um den überaus langen Schlaf seines Helden zu begründen – im Gegensatz zu den Romantikern, die ihre Helden in den Hörselberg oder an einen ähnlich zauberischen Ort schickten.
Vor dem neunzehnten Jahrhundert mochte die bloße Allegorie genügen oder die Tradition der Märchen und Sagen, um das Wuchern der Phantasie zu rechtfertigen und der Fiktion den Anschein der Wirklichkeit zu verleihen. Doch zu Poes und Bellamys Zeiten hatten Feenmärchen ihren Reiz verloren. Selbst Verfasser von Gespenstergeschichten beriefen sich plötzlich auf eine wie auch immer geartete Wissenschaft, sei es Spiritismus oder Spekulation über andere Dimensionen.[3]
Das »was wäre, wenn« der SF bezieht seine Kraft auch daraus, daß es sehr schnell in ein »es könnte ja sein, daß« umschlägt. Niemand wird erwarten, daß die gute Fee an seine Tür klopft; elektrisches Licht, Telefon, selbstfahrende Wagen und andere Zauberdinge hingegen wurden im neunzehnten Jahrhundert Realität, selbst drahtlose Telephonie mit dem Reich der Abgeschiedenen schien ein Thema für die experimentellen Wissenschaften zu sein.
Heute halten die Roboter Einzug in unser Alltagsleben, und wer glaubt nicht alles daran, daß draußen im All andere Intelligenzwesen existieren. Wissenschaft und Technik verändern die Welt in einem rasanten Tempo, und die Science Fiction ist ein Reflex darauf.
Der SF-Autor, Herausgeber und Theoretiker Sam Moskowitz hat diesen Umstand vor vielen Jahren in seiner Definition der Science Fiction auf den Punkt gebracht: »Science Fiction ist ein Zweig der phantastischen Literatur. Sie läßt sich anhand des Fakts identifizieren, daß sie seitens ihrer Leser den ›bewußten Verzicht auf Unglauben‹ dadurch erleichtert, daß sie eine Atmosphäre der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit für ihre phantasievollen Spekulationen in den Naturwissenschaften, Raum, Zeit, Sozialwissenschaften und Philosophie schafft.« [Moskowitz, S. 11] – Und diese Glaubwürdigkeit wird durch einige wenige Leitideen erzeugt, die im wissenschaftsoptimistischen Weltbild des 19. Jahrhunderts verankert sind und die den SF-Werken, der geschilderten Welt und/oder der Handlung, mehr oder weniger explizit zugrunde liegen:
der unaufhaltsame Fortschritt von Wissenschaft, Technik, Industrie,
die Evolution des Lebens auf der Erde und der menschlichen Gesellschaft,
die Vielzahl der bewohnten Welten.
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt – Hauptquell der SF
Im Jahre 1623 entwarf der englische Lordkanzler Francis Bacon die erste technische Utopie Nova Atlantis. Beobachtung und Experiment, Erkenntnis der Naturgesetze und ihre industrielle Nutzanwendung werden die Menschheit voranbringen, lautete sein Credo. Zwei Jahrhunderte später, 1837, fragte der englische Historiker Thomas Babington Macauley, was die Baconsche »neue Philosophie«, die Wissenschaft, für die Menschheit geleistet habe: »Sie hat das Leben verlängert; den Schmerz gelindert, Krankheiten ausgerottet; sie hat die Fruchtbarkeit des Bodens erhöht; dem Seemann neue Sicherheit gegeben und neue Waffen dem Krieger; sie hat breite Ströme und Buchten überbrückt … Denn sie ist eine Philosophie, die niemals rastet, die sich nie auf dem Erreichten ausruht, die nie vollendet ist. Ihr Gesetz ist der Fortschritt. Ein Punkt, der gestern noch unsichtbar war, ist heute ihr Ziel und wird morgen ihr neuer Ausgangspunkt sein.« [Macauley, S. 116 f.]
Macauleys Euphorie bildet keine Ausnahme. Mit der industriellen Revolution setzte sich die Vorstellung von einer geschichtlichen Höherentwicklung der Menschheit allgemein durch und erfaßte, von den philosophischen Vordenkern des aufstrebenden Bürgertums ausgehend, nahezu alle Schichten des Volkes. Wissenschaftliche, technische, industrielle Neuerungen und gesellschaftlicher Fortschritt wurden dabei als eine natürliche Einheit gesehen. Das Aufblühen der Industrie sollte das allgemeine Wohlergehen fördern, soziale Umwälzungen überflüssig machen und alle sozialen Gebrechen heilen.
In vereinzelten populären Darstellungen – nicht im Roman! – eilte die Phantasie der technischen Möglichkeit jedoch noch weiter voraus.
»Wir haben damit einen solchen Punkt erreicht«, schreibt fünfzig Jahre nach Macauley der amerikanische Ökonom Henry George in seinem Hauptwerk Fortschritt und Armut (1879), »daß der Fortschritt bei uns natürlich zu sein scheint, daß wir vertrauensvoll auf die größeren Errungenschaften kommender Geschlechter blicken, manche glauben sogar, daß der Fortschritt der Wissenschaft dem Menschen schließlich die Unsterblichkeit verleihen und ihm ermöglichen werde, körperlich nicht nur die Planeten, sondern auch die Fixsterne zu erreichen und schließlich sogar Sonnen und ihre Systeme zu schaffen.« [George, S. 488]