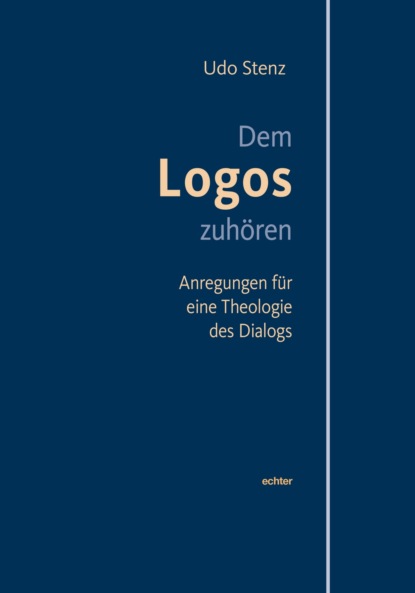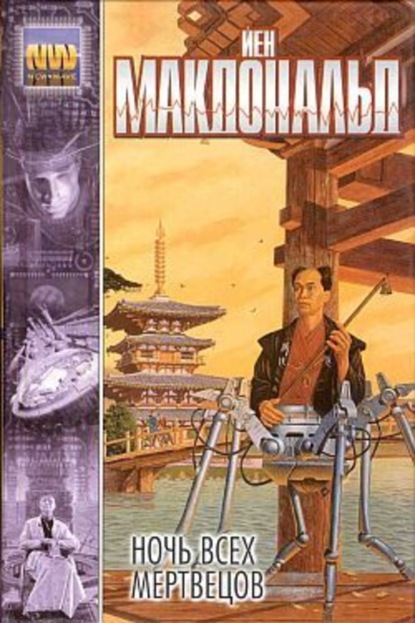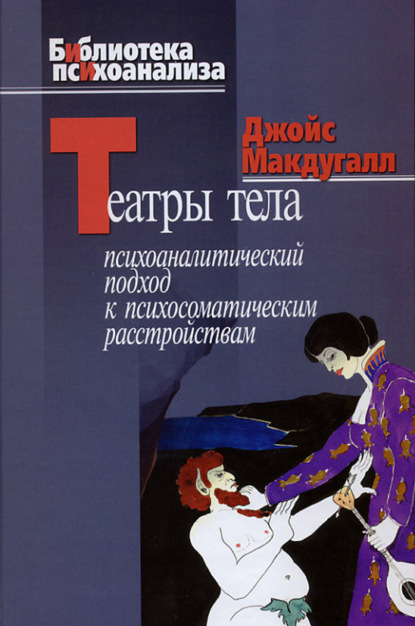- -
- 100%
- +
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freie Leben
Und in die freie Welt wird zurück begeben,[…]
Dann fliegt vor Einem [sic!] geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.“13
Wenn die Vernunft darauf angewiesen sein soll, von der Wahrheit ergriffen zu werden, so liegt sie in ihrer Schwachheit offen; sie zeigte, dass sie über die Naturwissenschaften hinaus aus sich nicht zur Wahrheit fähig ist. Diesen Schluss zieht in letzter Konsequenz das Schwache Denken bis hin zum postmodernen Nihilismus14.
Lévinas und mit ihm das Dialogische Denken (auch: Personalistisches oder Neues Denken), als dessen profilierteste Vertreter F. Ebner (1882 – 1931), F. Rosenzweig (1886 – 1929) und M. Buber (1878 – 1965) sowie in jüngerer Zeit B. Casper (geb. 1936) gelten können, nimmt dazu konsequent den anderen Menschen in den Blick. Lévinas spricht vom Antlitz, das in die Welt des Subjekts einbricht und diese Frage stellt. Über das Antlitz des Anderen erschließt sich das Unendliche, aber es läuft nicht in eine Totalität hinein, sondern geht über eine adäquate Idee hinaus und lässt sich nicht integrieren15. An dieser Stelle zeigt sich deutlich, dass der Umbruch des Denkens letztlich ethisch motiviert ist. Vom ethischen Ansatzpunkt aus wird die Lehre vom Sein völlig neu geordnet: Das Verhältnis zum Anderen, bisher in der Ontologie vergessen, wird als „Exteriorität“ bezeichnet und radikal metaphysisch verstanden16. Die Begegnung mit dem Antlitz ist der konkrete Punkt, an dem das Unendliche, die Beziehung zu Gott, dem Subjekt zukommt17 und es neu aus einem „Dialog der Liebe“18 hervortreten lässt.
Dadurch erhält die Frage nach der Wahrheit eine neue Antwort. Ihre herkömmliche Bezeichnung als Adaequatio intellectus et rei19 genügt nicht mehr; Wahrheit wird herausgenommen aus dem Leistungsfeld des Subjekts und seines Intellekts allein, vielmehr ethisch gewendet und mit der Gerechtigkeit und der Freiheit verknüpft20. Wahrheit verschafft sich Geltung in dem Einbrechen des Anderen, und die Erkenntnis ihrer geht aus der Selbstkritik hervor21. Aus der Exteriorität schickt sich eine Freiheit zu, die nach Lévinas eine universale Ordnung reflektiert22 und in der Begegnung mit einem anderen Menschen, mit dem Dritten, zum Durchbruch kommt. Dem Anderen kommt zu guter Letzt ein ontologischer Status für das Subjekt zu. Dieser realisiert sich im Dialog.
All das wirft einige Fragen auf. Die erste: Tritt in der Logik dieses Denkens also der Dia-Logos an die Stelle des Logos, oder wird er ihm übergeordnet? Der Logos bezeichnet philosophisch das Verhältnis, das Ineinandergehen von Wahrheit und Vernunft. Kann davon noch die Rede sein, wenn Vernunft und Wahrheit als philosophische Prozesse, als Bewegungen gesehen werden, die der Erfüllung und der Sinngebung aus dem Einbruch des Anderen, gar des Jenseitigen, bedürfen? Mit anderen Worten: Wird der Logos dann nicht mehr innerhalb der Philosophie gesucht, sondern ist er ihr fremd?
Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Natur. Ihre Ordnung war in Mittelalter und Scholastik das alles Bestimmende. Galilei hatte sich ausdrücklich auf sie bezogen. In der Neuzeit war man hingegen von der Idee einer objektiv geordneten Natur abgekommen: Der Subjektivismus Descartes’ unterwarf sie dem methodischen Zweifel, Kant entrückte sie gar der menschlichen Erkenntnismöglichkeit. Das Neue Denken erkennt sie an, weist ihr aber eine der Person untergeordnete Rolle zu. Lévinas kennt Natur jeweils in Abhängigkeit vom Einbrechen des Anderen in den eigenen Horizont. In jüngerer Zeit hat sich vor allem in den praktischen Disziplinen wie z. B. der Pädagogik immer mehr die Erkenntnis wieder Bahn gebrochen, das es um das Subjekt herum etwas gibt, das es nicht selbst gemacht hat23. Allein schon diese Feststellung provoziert zu einer Beschäftigung mit etwas Vorgegebenen, was nicht in Abhängigkeit vom Subjekt selbst gesehen werden kann. Die Natur rückt auf empirischem Wege wieder neu ins Gesichtsfeld und fordert den Philosophen neu heraus.
Zu dieser Herausforderung gehört es auch, die Felder von Naturwissenschaft und Philosophie kritisch auseinander zu halten. Beide können sich auf denselben Gegenstand beziehen: Beider Materialobjekt ist die Welt mit all dem, was in ihr wahrnehmbar ist, insbesondere dem Denken und Verhalten der Menschen. Die jeweilige Herangehensweise, das Formalobjekt hingegen, ist unterschiedlich: Die Naturwissenschaft beobachtet, was sich ihr bietet, und geht ihm gleichsam auf den Grund. Sie sucht, was hinter dem Beobachteten oder Wahrgenommenen steckt, also nach allgemein gültigen Kausalitäten und mathematischen Gesetzmäßigkeiten, aus denen Schlüsse darauf gezogen werden können, was weiterhin allgemein verbindlich erwartet werden kann. Diese Schlussfolgerungen sind dann unabhängig von der Beschaffenheit des wahrnehmenden Subjekts. Die wahrgenommenen Qualitäten sind sekundäre, während die mathematischen Gesetzlichkeiten die primären Qualitäten sind, welche ausschließlich die Naturwissenschaft interessieren24. Die Philosophie hingegen tendiert auf das Ganze des Seins hin. Es ist ihr fremd, bestimmte Fragestellungen auszuschließen. So kann sie die Beschränkung der Naturwissenschaften auf die Mathematik nicht mitvollziehen25 und sich andererseits auch nicht von ihr in die Schranken weisen lassen.
Daraus leitet sich die Weite des philosophischen Rahmens ab, in dem Dialog, Begegnungen und zwischenmenschliche Beziehungen betrachtet werden. Er kann nicht etwa durch soziologische oder neurowissenschaftliche Forschungen oder Thesen26 eingeengt werden. Von vorrangigem Interesse ist es für uns dabei, Begegnungen und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten auszuleuchten, die sich für Gespräche zwischen Menschen bieten, und diese nicht nur kausal zu begründen, sondern intentional auf etwas hin zu orientieren, was als Logos bezeichnet werden darf. Wie also kann philosophisch gesehen ein Miteinander-sprechen nicht nur als Ereignis beschrieben, sondern in seinem letzten Grund aus einem Hinhören auf den Logos heraus verstanden werden, das sich also nicht nur aus psychischen, sozialen oder neuronalen Gesetzlichkeiten heraus erklärt, sondern auf ein Ziel hin orientiert?
1.1Phänomenologische Annäherung
Zur Bearbeitung dieser Fragen bietet sich ein Blick auf die Phänomenologie an. Sie bringt auf der einen Seite das Subjekt, das Ich, in seinem Denken und Erkennen, und auf der anderen Seite den Gegenstand, der sich diesem Denken und Erkennen zeigt, ihm erscheint, in einen gegenseitigen Zusammenhang, in dem sich beide im Denken und Erkennen gleichsam aufeinander zu bewegen. Auch das dem Ich begegnende andere Subjekt wird in diesen Zusammenhang einbezogen. Und dieser Zusammenhang wird in einer so radikalen und objektiv abstrahierenden Weise ergründet, dass kaum eine einschlägige Publikation zum Thema ohne einen Bezug zu dem Protagonisten der Phänomenologie, E. Husserl (1859 – 1938), auskommt27. E. Stein (1891 – 1942) ist sogar davon überzeugt, dass
„die phänomenologische Methode, wie sie E. Husserl ausgebildet […] hat, […] von den großen Philosophen aller Zeiten bereits angewendet wurde, wenn auch nicht ausschließlich und nicht mit reflektiver Klarheit über das eigene Verfahren.“28
Für die Dialogphilosophie des Neuen Denkens kommt der Phänomenologie grundlegende Bedeutung zu29, denn sie radikalisiert einerseits die Hinwendung zum Subjekt, andererseits thematisiert sie in ebenso radikaler Weise das Verhältnis zum Anderen. Dabei verharrt sie nicht beim erkennenden Subjekt, sondern rückt auch wieder das in den Blick, was die Scholastik unter Natur subsumiert, die Neuzeit hingegen anscheinend aufgegeben hatte. Eindringlich wird dies deutlich an Husserls programmatischer Aufforderung: „Zu den Sachen selbst!“30. In dem „Zu“ dieses Mottos tritt die Bewegung des Denkens vom Subjekt zum Objekt hervor; sie bleibt indessen nicht eingesperrt in den Horizont des subjektiven Denkens, sondern ihr wird in den „Sachen selbst“ eine Richtung vorgegeben, die zu einer objektiven, also (in welcher Weise auch immer) vom Gegenstand her kommenden Verbindlichkeit über das Subjekt hinaus weist. Die Dinge selbst erscheinen, sie geben sich und werden vernehmbar und verstehbar. So schafft die Phänomenologie die Grundlagen für die komplexe Untersuchung von Erfahrung und Erkenntnis und öffnet dadurch Perspektiven für die gesamte Philosophie31. Es tun sich damit Raum und Struktur auf, in der sich objektiv Wahrheit zur Geltung bringen kann32 – die Wahrheit des Logos.
Der phänomenologische Ansatz richtet das Augenmerk darauf, wie sich dem Subjekt ein Gegenstand der Erkenntnis anbietet. Der Erkenntnisgegenstand wird zum Erscheinenden, zum Phänomen. Damit wird begrifflich an die Erkenntnislehre Kants angeknüpft. Der Königsberger Philosoph hatte behauptet, man könne nicht die Dinge an sich erkennen, sondern nur die Art, wie sie sich zeigen: als Erscheinungen, Phänomene. Ihre Einordnung und Definition erfolgen in den Kategorien der menschlichen Vernunft, die diese je schon a priori bereithält. Im Noumenon, der verstandesmäßigen Einordnung des Phänomens, sind damit die Möglichkeiten der Erkenntnis ausgeschöpft.
Husserl setzt dieses Denken begrifflich fort und überwindet es. Seine Absicht ist es, einen Weg aufzuzeigen, auf dem es möglich ist, gegen Kant doch „zu den Sachen selbst“ zu gelangen – nicht im metaphysischen Verständnis, sondern gnoseologisch. Das bedeutet: Im Vorgang des Erkennens soll die Sache selbst gefunden werden. Die Untersuchung richtet sich daher nicht auf den Gegenstand als solchen, sondern es muss darum gehen herauszufinden, wie seine Präsentation im Bewusstsein vor sich geht, wie – und nicht: als was – er erscheint. Eine Erscheinung in diesem Sinne ist deshalb einerseits unabhängig vom Ich und von aller dinglichen Welt33. Andererseits benötigt jedes Erscheinen und damit jedes Seiende als zwei Pole den Gegenstand und das Bewusstsein und kann als eine Art Struktur verstanden werden, die einen konkreten Gegenstand in das Bewusstsein des Subjekts hinein trägt. Was auch immer erscheint, hat sich unabhängig von seiner eigenen Qualität vor dem Bewusstsein auszuweisen, unabhängig davon, welchem konkreten Ich dieses Bewusstsein gehört34.
Um diese Struktur in ihrer objektiven Gültigkeit zu erreichen, entwickelt Husserl, von der Mathematik her kommend35, eine Methode, die ein Charakteristikum seiner Philosophie werden sollte: Es ist die Epoché, die Einklammerung. Dabei wird all das von der Betrachtung ausgenommen, was bezweifelt oder naturwissenschaftlich thetisch ausgedrückt werden kann und damit nicht streng zum reinen Vorgang des Bewusstseinaktes gehört36. Darunter fallen alle Eigenschaften und sonstigen Gegebenheiten des Gegenstandes der Betrachtung auf der einen und des betrachtenden Subjekts, d. h. des konkreten Ich, auf der anderen Seite.
Husserl spricht dabei von „phänomenologischer Reduktion“37. Er beschreibt diesen Zusammenhang (wahrscheinlich im Jahre 1921) so:
„Ich urteile in der phänomenologischen Reduktion nicht über die Natur, über das identische Objektive, das mir in Erfahrung gegeben ist, sondern über die Erfahrung und ihre Zusammenhänge und das reine Bewusstsein überhaupt.“38
Dabei stellt Husserl incidenter klar, dass er die Natur als objektiv vorgegebene und gleich bleibende Wirklichkeit – er bezeichnet sie einmal als „im modernen Sinn ein Abstraktionsprodukt“39 – nicht ablehnt und auch nicht in Zweifel zieht. Das unterscheidet seine Vorgehensweise von dem methodischen Zweifel des Descartes. Husserl enthält sich vielmehr jeglichen Urteils über sie, er blendet sie aus40, indem er von der natürlichen zur phänomenologischen Einstellung übergeht:
„In der natürlichen Einstellung vollziehen wir schlechthin all die Akte, durch welche die Welt für uns da ist. Wir leben naiv im Wahrnehmen und Erfahren, in diesen thetischen Akten […] Naturwissenschaft treibend, v o l l z i e h e n wir erfahrungslogisch geordnete Denkakte […] In der phänomenologischen Einstellung u n t e r b i n d e n wir in prinzipieller Allgemeinheit den Vollzug aller solcher kogitativen Thesen […].“41
Der Phänomenologe ändert also in fundamentaler Weise seine Haltung allem gegenüber, was ihm in der Wahrnehmung begegnet42. Gegenstand der phänomenologischen Untersuchung ist die Erfahrung, jedoch nicht verstanden als konkretes Ergebnis in Form eines erfahrenen Gegenstandes, sondern als Prozess des Erfahrens der Welt, den das Ich vollzieht, der also im Subjekt selbst stattfindet.
„Der Erfahrungsbegriff ist hier sicherlich ein anderer als derjenige, in dem in Geltungszusammenhängen von Begründung der Erkenntnis durch Erfahrung die Rede ist, wo Erfahrung ein Titel ist für theoretisch begründende, theoretischen Akten eine Rechtsunterlage gebende Akte (Ichakte wahrnehmenden Erfassens daseiender Gegenstände oder wiedererinnernden Erfassens etc.).“43 Es geht dabei vielmehr um die Typik der Apperzeptionen, den auf Vorgegebenheiten aufbauenden Vorgang von Affektionen und Aktionen, die sich immer neu bildet und „für jeden eine andere ist“44.
1.1.1Phänomenologie der Intersubjektivität als Wegweiser zum Dialog
In der phänomenologischen Betrachtung gelangt das Ich, vermittelt durch die reine Struktur seiner Erlebnisse, zu sich selbst, zur Welt und zum Anderen.
1.1.1.1Die Intentionalität und die phänomenologische Konstitution der Welt
Die Welt und das Ich bilden einen Zusammenhang, der mit dem Begriff der Intentionalität beschrieben wird. Er äußert sich erstens darin, dass Bewusstsein immer „Bewusstsein von etwas“45 ist. Darin wird die zweipolige Struktur der Intentionalität anschaulich, in der sich das Bewusstsein und damit das Subjekt, das Ego, in seinem Erkennen (Noesis) mit dem Gegenstand der Erkenntnis (Noema) verbindet. Die Akte, in denen sich Intentionalität realisiert, die auf der beschriebenen Struktur dahinströmen, nennt Husserl „Erlebnisse“. In ihnen zeigt sich die Struktur, in der sich dem Ich die dingliche Welt in den Phänomenen erschließt; das Erlebnis erweist sich damit als Gabe46.
Der Schwerpunkt im husserlschen Denken liegt damit nicht so sehr auf einer Neuentdeckung des Ich als solchen, sondern darin, dass der Ausgang beim Erlebnis selbst gesucht wird, und vor allem dass dieses in seiner intentionalen Verortung aus zwei Komponenten besteht, nämlich einer „noetisch“ oder „intentional“ und einer „hyletisch“ oder „material“ genannten47. Zweitens äußert die Intentionalität sich darin, dass Gegenstände in ihrem Erscheinen sich im Bewusstsein konstituieren. Es geht also in der Phänomenologie als Lehre vom Erscheinen nicht nur um Erkenntnislehre, sondern um die Lehre vom Sein selbst: „Wieviel Schein, so viel Sein“48. Bloßes Erkennen würde nach seinem Gegenstand greifen. Diese Haltung der Bemächtigung im Denken ist bereits im Zusammenhang mit dem Umbruch des Denkens verworfen worden. Es ist vielmehr umgekehrt: In seinem Erscheinen greift der Gegenstand selbst nach dem Bewusstsein, vor dem er sich ausweist49, dem er sich gibt und in dem er sich konstituiert. Das Erfahrene lässt also das Ego nicht unberührt, sondern bezieht es ein. Das bedeutet: Die zu erkennende Welt ist nicht ein gegenüber stehendes Außen, sondern gibt sich dem Ich hin und wird erst dadurch als Welt für mich eingeholt50. Die gesamte Welt konstituiert sich also im Bewusstsein in dem Sinne, dass jeder erscheinende Gegenstand
„als solcher dem strömenden Bewusstsein kontinuierlich ‚immanent’, deskriptiv ‚in’ ihm [sc. ist], wie auch deskriptiv in ihm ist das ‚ein und dasselbe’. Dieses In-Bewusstsein ist ein völlig eigenartiges Darinsein, nämlich nicht Darinsein als reelles Bestandstück, sondern als intentionales, als erscheinendes Ideell-darin-Sein oder, was dasselbe besagt, Darin-Sein als sein immanenter ‚gegenständlicher Sinn’. Der Gegenstand des Bewusstseins in seiner Identität mit sich selbst während des strömenden Erlebens kommt nicht von außen her in dasselbe hinein, sondern liegt in ihm selbst als Sinn beschlossen, und das ist als intentionale Leistung der Bewusstseinssynthesis.“51
So tut sich in der Immanenz der klaren und unverstellten Erlebnisse eine Transzendenz auf, und die Erlebnisse gestatten es, zum Wesen (Eidos) der Dinge zu gelangen. Husserl nennt diesen Schritt des Transzendierens eidetische Reduktion52. Damit gelangt er zur Typik, d. h. der tragenden Struktur aller möglichen Betrachtungsweisen, und verleiht der phänomenologischen Analyse allgemeine Gültigkeit und Wahrheitsanspruch:
„In all dem aber waltet – und das macht Wissenschaftlichkeit, Beschreibung, phänomenologisch-transzendentale Wahrheit möglich – eine feste Typik […]. Die Welt des Lebens, die alle praktischen Gebilde (sogar die der objektiven Wissenschaften als Kulturtatsachen, bei Enthaltung von der Teilnahme an ihren Interessen) ohne weiteres in sich aufnimmt, ist freilich in stetem Wandel der Relativitäten auf Subjektivität bezogen.“53
Hierdurch wird ein Bezug von objektiver Wahrheit auf Subjektivität hergestellt, der den Gegensatz von Subjektivismus des Psychischen und dem Objektivismus des Rationalen überwindet54. Der Weg des Phänomenologen führt also jenseits allen Positivismus55 über die Anschauung oder Intuition oder das Gefühl, die immer legitime Erkenntnisquellen sind, hinaus zum Wesen des Dings selbst.
Der phänomenologische Begriff des Erlebnisses ist dabei weit zu fassen. Es geht nicht nur um die Wahrnehmung der dinglichen Welt. Nicht nur das sinnenhafte, sondern auch jede Art geistlichen oder religiösen Erfahrens fällt darunter. Hinter jeder religiösen Erfahrung und jeder ethischen Haltung steckt eine Struktur des Erlebens im phänomenologischen Sinne, die herausgearbeitet werden kann56. Die Phänomenologie hat daher, so ist gesagt worden, zu einem religiösen Gegenstand oder einem ethischen Wert die gleiche Einstellung wie etwa zu der Farbe Rot57. Auf dieser Grundlage konnten prominente Religionsphänomenologen wie R. Otto (1869 – 1937) oder G. v. d. Leeuw (1890 – 1950) wichtige Beiträge58 zum Verständnis des religiösen Phänomens leisten.
Die Frage nach Gott, dem religiösen Gegenstand par excellence, phänomenologisch und damit mit großem subjektiven Akzent anzugehen, birgt allerdings gewisse Zweideutigkeiten. Die Konstitution der Dinge im Bewusstsein wird problematisch, wenn es um die Frage religiöser Erfahrung schlechthin und insbesondere um die Frage nach Gott, zumal von einem christlichen Standpunkt aus, geht. Das Instrumentarium der Religionsphilosophie kann Anschauungsmaterial liefern; dessen theologische Deutung aber kann sie nicht übernehmen. Als Erkenntnistheorie muss sie daher auf andere, ontologische und theologische Instanzen verweisen. Tatsächlich gibt es eine neuere Strömung der Phänomenologie, die, in die Nähe der Hermeneutik rückend, von einem Gott, der ist, zugunsten eines Gottes, der sein kann59, absehen möchte. Das hat zur Folge, dass dieser Ansicht nach Gott nur sein kann, wenn der Mensch dies ermöglicht60, dass Gott geradezu von uns abhängt61. Diese Sichtweise wendet sich ab von einer ontologischen und hin zu einer ethischen, allenfalls eschatologischen Bedeutung Gottes als das Ziel. Dem religiösen Leben dürfte aufgrund individueller Einsichten die Freiheit zukommen, die Welt zu einem gerechteren und liebevolleren Ort zu machen oder nicht62. Dieser Ansatz erscheint in zweierlei Hinsicht attraktiv: Zum einen tritt er im Sinne des Neuen Denkens von vornherein der Versuchung entgegen, sich Gottes, wenn auch nur im Den ken, zu bemächtigen, und wahrt zugleich ganz und gar sein Geheimnis63. Gott verschafft sich durch den Menschen Eintritt in die Welt, begibt sich aber nicht in seine Verfügungsmacht und kann sich auch wieder entziehen64. Dem entspricht das Verständnis der Person des anderen als eine Art Entzugserscheinung: Sie erscheint und entzieht sich und würde aufhören Person zu sein, wenn man sie verstanden hätte65. Des Weiteren öffnen sich scheinbar große und weite Tore für den interreligiösen Dialog. Es kommt vermeintlich nur noch darauf an, dass Gott sich im Bewusstsein sowie im ethischen Handeln Geltung verschafft. Der durch eine solche Haltung mögliche Fortschritt für das Zusammenleben der Menschen in der Welt ist nicht in Abrede zu stellen66. Allerdings erweist sich eine phänomenologisch zugespitzte Aussage über Gott als eines lediglich vom Menschen bedingten Möglichen und nicht als reines Sein an sich als nicht vereinbar mit der vorliegend zu erörternden Fragestellung.
Sieht man jedoch genauer hin, ist ein solcher Schluss aus dem phänomenologischen Ansatz heraus nicht zwingend. Zwar tritt der Phänomenologe, allen voran Husserl, mit der prinzipiellen Behauptung in die Diskussion, die Dinge seien nicht an sich, sondern im Bewusstsein konstituiert. Jedoch ist es nötig, sorgfältig zwischen der phänomenologischen Methode und dem Gegenstand der Erkenntnis zu differenzieren. Der Schluss, Gott sei nicht, sondern er sei nur möglich, ist aus Husserls Phänomenologie nicht herzuleiten, im Gegenteil: Husserl selbst hat nie die lange philosophische Tradition verlassen, die von der Antike über das Mittelalter bis hin in die Neuzeit reichte und als die drei bestimmenden, unterschiedlichen und doch zusammen hängenden Wirklichkeiten das Ich, die Welt und Gott ausmachte67. Er ist nur einen anderen Weg der Erkenntnis gegangen, indem er nämlich die Transzendenz Gottes wie jede andere Transzendenz auch, also alles, was außerhalb des Bewusstseins zu liegen kommt, im Schritte der Reduktion ausschaltete. Damit knüpft Husserl zwar an den methodischen Zweifel von R. Descartes an68, lässt ihn aber insofern hinter sich, als er keine Aussage, nicht einmal eine zweifelnde, über das Eingeklammerte macht69. Aus der Reduktion ist also keinesfalls zu schließen, das in Klammern Gesetzte sei entfernt; vielmehr ist es vorübergehend zurückgestellt, um einen klaren Blick auf das reine Bewusstsein und die Vorgänge seines Erlebens zu erhalten70. Diesen Ansatz in die Richtung eines nur möglichen Gottes weiter zu entwickeln, tritt zwar nicht zu ihm in Widerspruch, nimmt ihm aber seine Originalität und macht ihn im Rahmen der vorliegenden Themenstellung uninteressant.
Die Epoché ergreift nicht nur den konkreten Gegenstand der Wahrnehmung, sondern, wie bereits festgestellt, auch das Subjekt der Wahrnehmung selbst, das konkrete Ich. Wäre dies nicht der Fall, so verbliebe die phänomenologische Methode im Subjektivismus oder im Gebiet der Humanwissenschaften. Durch die Epoché hingegen wird das Ich herausgenommen aus jedem (auch naturwissenschaftlichen) Positivismus, in den es in der aufkommenden Neuzeit verbannt wurde und der es auch heute immer mehr zu einem Ablauf physiologischer oder biologischer Prozesse machen möchte71. Es wird deutlich, dass das Ich ein philosophischer Begriff ist, der keine naturwissenschaftliche Größe darstellt und doch objektiv gültige Erkenntnis vermittelt. E. Stein hat hierzu den in der Phänomenologie entscheidenden Punkt formuliert: Von philosophischem Interesse ist, was der Naturwissenschaftler gerade ausschließen möchte: die Beschaffenheit des wahrnehmenden Subjekts, d. h. sein Erleben, und zwar in seiner den einzelnen Menschen übersteigenden Allgemeinheit und Objektivität72.
Der Weg der Epoché als Einklammerung all dessen, was bezweifelt werden kann, führt damit das Subjekt nicht nur zu den Sachen selbst, sondern auch reflexiv zu sich und zu den tiefsten Gründen seiner selbst, wo ihm nichts mehr bleibt, was in einem faktischen Sinne individuell wäre. Das Ich, das als denkendes Subjekt die Reduktion vollzieht, ist deshalb nicht das Ich, zu dem es letztlich gelangt73, es ist ihm vielmehr entzogen. Ich und Ich sind hier nicht mehr dasselbe. Wird die Epoché so lange durchgeführt, bis nichts mehr da ist, was eingeklammert werden könnte, verbleibt eine jedem Zweifel entzogene Grundbewegung – das ist die „Reduktion der transzendentalen Erfahrung auf die Eigenheitssphäre“74 –, die zugleich die transzendentale Seinssphäre des Ich enthüllt. Das transzendentale Ich wird auch „reines Ich“ genannt: Denn es ist rein von aller Personalität; diese entfaltet sich erst im Strom der Erlebnisse:
„Der Erlebnislauf des reinen Bewusstseins ist notwendig ein Entwicklungsverlauf, in dem das reine Ich die apperzeptive Gestalt des persönlichen Ich annehmen muss.“75