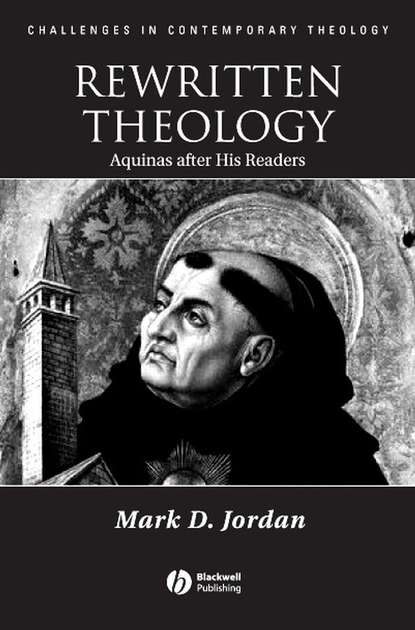Milon und der Löwe

- -
- 100%
- +
Vor dem Weggehen vom Flusshafen betrachtete Milon die Fischerboote und kleinen Warenschiffe. Am meisten aber erregten einzelne vergoldete Ruderschiffe sein Interesse, die reichen Bürgern von Pompeji gehörten.
Bald betraten sie die Innenstadt durch ein hohes Tor. Verglichen mit den Straßen Athens kamen Milon die pompejanischen mit ihrer großen Pflasterung eher schmal vor. Wenn ein Wagen herannahte, musste man auf den fast kniehohen Bürgersteig hinaufspringen, da der Fahrweg viel tiefer lag und der Wagen nicht ausweichen konnte. Nach den Straßen zu lagen offene Kaufläden, und überall waren Handwerker fleißig bei ihrer Arbeit. Hier wurde Leder genäht und zu Gürteln und Schuhen verarbeitet. In einer Metallwerkstätte sah man Kupfer hämmern, und in den Auslagen waren die schönsten Gürtelschnallen, Haarfibeln, aber auch Ringe und Ketten ausgestellt. Schenkwirte schöpften aus riesigen Steinkrügen roten und goldgelben Wein in Trinkschalen und boten dazu Brot mit gebratenen Hühnchen oder gebackenen Fischen an. Hier waren Öllampen in verschiedenen Größen zu kaufen, und ein Töpferweib saß nebenan in einem Heer von Vasen und Töpfen, die sie mit lauter Stimme anpries. Ein geschäftiger Verkäufer schwenkte bunte Tücher in der Luft herum und reichte sie bereitwillig neugierigen Damen, sie an sich selber auszuprobieren.
Bei einem Ziehbrunnen hatten sich mit Krügen und Eimern ärmere Frauen versammelt, in deren Häuser keine Wasserleitung fließendes Wasser herantrug. Milon hörte, wie sie erregt die Schäden des gestrigen Erdbebens besprachen. Eine wies dabei angstvoll auf eine Rauchwolke, die über dem Berg Vesuvius erschienen war. Eselskarren führten vom Lande Gemüse und Früchte herbei, die in der Markthalle auf grobe Tücher ausgebreitet und feilgehalten wurden. Bei einem Händler ließ Fuscus einen Krug mit Fischtunke füllen, bei einem andern kaufte er Mehl. Milon bekam in seinen Korb eine große Zahl von Eiern, die zwischen Weinblättern weich gelagert wurden. Tyrios trug zwei schwere Krüge mit Öl, die man bei einer Ölmühle hatte auffüllen lassen.
Als Fuscus mit seinen Burschen beim großen Platz des Forums ankam, durften sie einen Augenblick die Lasten ablegen und die Tempel und andere Gebäude betrachten. Tatsächlich, da und dort lagen als Zeugen des gestrigen Erdbebens herausgebrochene Steine umher. In einer Seitenmauer des Gebäudes der Stadtregierung klaffte ein Riss von oben bis unten. Milon war nicht erstaunt, bei den Tempeln griechische Säulen zu finden; hatte ihm doch Alkides berichtet, wie die Römer dies von den Griechen übernommen hätten.
Fuscus winkte, begab sich mit ihnen hinüber zur Markthalle an einen schattigen Platz und sprach:
«Legt hier alles auf den Boden. Ich begebe mich für eine gute Weile in ein Badehaus. Die zwei Neulinge dürfen sich die Stadt ansehen. Vesonius und Vargo, bleibt bei unseren Waren und ruht euch aus, bis ich zurück bin!»
So begaben sich Milon und Tyrios auf Entdeckungen und schlenderten durch die belebten Straßen. Sie bewunderten schön bemalte Häuserfassaden, wie sie sie von Athen nicht kannten. Aus dem hohen Portal einer Villa traten eben prächtig gekleidete Menschen heraus, die Damen in Gold- und Silberschmuck und buntfarbigen Tüchern. Übermütiges Lachen hallte von den Hauswänden wider. Die beiden Freunde traten in eine Mauernische zurück, von wo aus sie die schönen, glücklichen Menschen beobachten konnten, die vor das Portal strömten. Kinder mit Körbchen waren dabei, die einem eben heraustretenden Paar Blumen zuwarfen, sodass das Steinpflaster wie ein Blütenteppich aussah.
«Eine Hochzeit!», bemerkte Tyrios; «in solchem Glück und Reichtum möcht’ ich auch Bräutigam sein!»
Der Zug setzte sich Richtung Forum in Bewegung. Im Vorbeiziehen verbreiteten sich Wohlgerüche von Duftwässern, mit denen man die Gewänder besprengt hatte. Aus den wieder gefüllten Körben streuten die lieblichen Kinder unermüdlich nach allen Seiten Blüten. Eine Rose fiel vor Tyrios’ Füße. Rasch hob er sie auf und sog ihren Duft ein. Dann wendete er sich zu Milon:
«Arme Teufel sind wir! Welch ein Glück, reich zu sein!»
«Es gibt ärmere als wir», versetzte dieser. «Sieh, wie hinter dem Zuge Krüppel und elende Bettlergestalten nachhinken, um da und dort eine Bronzemünze vom Boden aufzuheben, die die Hochzeitsgäste übermütig in die Luft werfen.»
Eine Weile verfolgten ihre Blicke den schwindenden Festzug; dann setzten die beiden ihren Entdeckungsweg fort. Sie gelangten in eine Gasse, wo der Geruch frischen Brotes ihnen entgegenwehte; zugleich ließ sich ein merkwürdiges Knirschen vernehmen, das immer lauter wurde, je weiter sie gingen. Als sie um eine Hausecke bogen, bot sich ihnen ein seltsamer Anblick: Bei hohen Steinzylindern gewahrten sie Männer, die mit eingesteckten Stangen eine Art von Steinhauben drehten, wobei das laute Knirschen erzeugt wurde.
«Das sind Mühlen!», rief Milon. «Sieh unten das weiße Mehl!»
Da vier der Müllerburschen eben eine kurze Drehpause machten, indes ein fünfter oben frisches Korn einschüttete, fragte Tyrios:
«Wie lange dreht ihr diese Ungetüme?»
«Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Pompejaner vertilgen Berge von Brot!»
Ganz nah hinter diesen Mühlen zog eben der Bäcker aus einem riesigen Steinofen dampfende Brote heraus, die seine Gehilfen in verschiedene Körbe warfen, je nach Größe.
«Ich kaufe ein kleines», sprach Tyrios.
Und wirklich, er klaubte eine Münze aus seinem Gürtel und handelte beim Bäcker rasch ein frisches Brot ein.
«Wo hat er wohl wieder das Geld her?», dachte Milon. «Bei ihm steckt immer wieder etwas im Gürtel.»
Bereitwillig teilte Tyrios mit seinem Freund das Gebäck und meinte:
«Herrlich ist frisches Pompejanerbrot, wenn man sich auch beim Abbeißen das Maul verbrennen kann!»
So kehrten sie, Brot kauend und genießend, zurück zum Forum, wo sie Fuscus erwarten sollten, bis er vom Besuch des Badehauses zurück wäre.
Auf einem Platze, den die beiden überquerten, blieb Milon vor einer Hauswand stehen. Auf dem Kalkverputz war mit roter Farbe eine Inschrift angemalt, die er entzifferte. Plötzlich begann er schallend zu lachen. Tyrios, der nicht lesen konnte, fragte:
«Was gibt es Lustiges? Schreiben die Pompejaner Witze an ihre Häuser?»
Milon erklärte:
«Du siehst hier zweierlei Inschriften. Die obere, groß und schön geschrieben, meldet, dass demnächst in der Arena der berühmte Gladiator Satrius Valens kämpfen wird, der bis jetzt als unbesiegbarer Liebling der Götter jeden Feind niederkämpfte. Darunter steht mit ungelenken Buchstaben eine zweite Inschrift als Kommentar dazu: ‹Es ist ein Wunder, o Mauer, dass du unter der Last dieses geschriebenen Unsinns nicht einstürzest!› – Sicher hat dies ein Feind von Satrius Valens daruntergeschrieben, um ihn beim Publikum lächerlich zu machen. – Diese zwei möchte ich kämpfen sehn in der Arena! Es sind Ringkämpfer.»
Inzwischen war das warme Brot verzehrt, und die beiden gelangten wieder zum Forum zurück, an dessen Säulenhallen sie entlangschlenderten. Auf schattigen Treppenstufen sah Milon einige vornehme Jünglinge sitzen; vor ihnen saß ein Magister, der sie offenbar unterrichtete. Zu Tyrios meinte er:
«Schleichen wir uns hinter die Säulen, dann können wir vernehmen, was sie lernen!»
«Mich interessiert das nicht. Ich gehe zurück zur Markthalle, zu den anderen. Fuscus kann bald vom Bade zurückkehren. Vale Milon!»
Als Tyrios wegging, dachte Milon: Pompeji hat ihm wohl mächtig imponiert, dass er mich plötzlich mit römischem Gruß verabschiedet.
Unauffällig schlich er in die Nähe der Treppenschule hinter eine der hohen Säulen. Eben vernahm er, wie der Magister vom Kampf der Römer gegen die Barbaren erzählte.
«Wir Römer sind dazu berufen, alle Völker der Erde unter unsere Macht zu zwingen. Ein Volk, das Rom gehorcht, ist wie ein Schiff, das vom wilden Meer in den Hafen zurückkehrt. Rom ist von den Göttern dazu bestimmt, die Erde zu beherrschen. Jeder Römer muss wissen, dass dies unser Stolz, unser täglicher Gedanke sein muss: das große, ewige Rom!»
Milon hatte genug gehört. Versonnen schritt er die Säulenhalle entlang in Richtung des Apollo-Tempels, von wo ihn griechische Säulen grüßten. Als er auf den Vorplatz kam, bemerkte er eine Gruppe von Händlern, die miteinander feilschten. Elende Bettlergestalten lungerten auf den Treppenstufen. Einige spielten mit Würfeln und kreischten gelegentlich auf. Weiber gingen herum und priesen Wein und Essbares aus Krügen und Körben zum Verkauf an. Hinter diesem Wirrwarr erhoben sich die schlanken Säulen, die Milon an die Akropolis denken ließen. Aber dort hatten sich nur stille, verhaltene Schritte dem Tempel genähert; niemand wäre es eingefallen, vor einem Tempel zu zechen, zu würfeln, zu handeln. Auf einmal ließ sich der Klang von Bronze vernehmen. Zwei dicke Priester erschienen auf der Tempeltreppe, den Beginn des Opfers zu melden. Nur wenige erhoben sich lässig aus der Menge und erstiegen die Stufen. Nicht Andacht, eine gewisse Neugier ließ Milon in den Vorraum des Tempels treten. Zu gern hätte er einen Blick in den inneren Raum der Celia geworfen, die Marmorgestalt des Apollo von Weitem zu schauen. Er hatte Glück. Die beiden hohen Tore zur Celia standen offen. Er begab sich etwas näher hinzu, als auch in Pompeji üblich war. Aus dem Halbdunkel schimmerte eine weiße Marmorfigur hervor. Es war eine wundervolle griechische Götterstatue, die die Römer sicher aus Griechenland hierher entführt hatten. Nun stand Apollo da drinnen, gefangen in der Dunkelheit, vergessen im geschäftigen Treiben der Stadt.
«Fort mit dir, elender Sklave!», herrschte ihn plötzlich die Stimme eines Tempeldieners an. Eine Faust stieß in seine Seite. Milon torkelte zwischen den Säulen durch und sprang fluchtartig die Treppenstufen hinunter zurück zum Forum.
Als er bei seinen Gefährten ankam, zeigten sie schon Unruhe über sein Ausbleiben. Jeden Moment war Fuscus zu erwarten.
Plötzlich, was war das? Ein dumpfes Rollen wurde hörbar. Milon und Tyrios, die sich auf den Rand eines Brunnens gesetzt hatten, verspürten ein Zittern unter sich. Schon erschollen laute Schreie. Die Erde bebte wieder. Menschen stürzten aus den Häusern. Weiber verließen ihre Verkaufsstände und eilten zu den Tempeln, da sie sich auf geweihtem Boden sicher glaubten. Das Beben wiederholte sich stärker. Allgemeiner Tumult. Durch das dumpfe Rollen der Erde und Schreien der Menschen tönten Aufschläge niederfallender Steine, die aus den Fassaden der Häuser brachen. Fuscus, der gerade zurückkam, rief seinen Sklaven zu:
«Rettet euch zum Schiff! Fort zum Hafen!»
Es war kein Leichtes, durch die aufgewühlte, vor Angst rasende Menschenmenge und die verstopften Gassen hindurchzukommen. Als seitlich aus einem Hause ein dicker Wirt herausstürzte, warf er Milon samt seinem Eierkorb um. Schnell wieder auf den Beinen, bemerkte der Jüngling hinter sich eine gelbe Eierspur auf der Pflasterung. Aber was lag an einigen Eiern, wo es jetzt um Leben und Tod ging! Milon hatte die andern Gefährten verloren und musste sich allein zum Hafen durchkämpfen; den Korb ließ er nicht fahren, wie oft er auch seinetwegen stecken blieb. Endlich erreichte er den Hafen. Fuscus und die anderen drei hatten das Boot zur Abfahrt gerichtet; aber der Herr war noch nicht da. Aufgeregte Schiffer stießen ihre Fahrzeuge vom Ufer, um aufs offene Meer hinaus zu fahren. Hie und da sprangen wild Flüchtende in wegfahrende Boote, um sich zu retten. Das Warten war für Fuscus und die vier Sklaven eine harte Geduldsprobe; aber es war ganz unmöglich, jetzt Pomponianus irgendwo suchen zu gehen. Endlich tauchte er auf. Atemlos kam er dahergelaufen, das Gesicht so von Schweiß und Staub bedeckt, dass er kaum zu erkennen war. Mühsam unterdrückte er seine Aufregung. Mit beherrschender Ruhe befahl er:
«Losbinden, wegfahren!»
Vesuvius regiert
Vorn im Schiff saß der Herr mit erstarrtem Antlitz. Niemand redete ein Wort; nur das Knirschen und rhythmische Klatschen der Ruder beim Eintauchen ins Wasser mischte sich in das ferner werdende Getöse von der Stadt her. Pomponianus beobachtete vom Heck des Schiffes, rückwärts zur Stadt gewendet, den dahinter aufragenden Berghügel des Vesuvius. Eine riesige Wolke hatte sich wie eine mächtige Baumkrone über dem Gipfel gebildet und breitete sich mit Windeseile immer weiter aus. Die Wolke erschien bald weiß, bald schmutzig und fleckig, als ob sie mit Asche und Erde beladen wäre. Wiederum schienen Flammen aus dem Krater zu züngeln, und Blitzschein erhellte gewisse Partien. Milon, dessen Blicke beim Rudern dieselbe Richtung hatten, schaute gebannt auf das unheimliche Geschehen über dem Berge, der, unten von Rauch und Dampf verhüllt, Feuer zu speien schien. Die Wolke näherte sich Pompeji. Plötzlich rief Fuscus, der am Steuer saß, Pomponianus zu:
«Herr, da fällt Asche in unser Boot; wenn nur nicht Feuer nachfolgt!»
Tatsächlich fielen leichte und schwere Flocken wie grauer Schnee. Auf der Hand konnte man sie zu Aschenmehl zerreiben. Auf einmal, als ob Hagel fiele, spritzte ums Boot herum Wasser auf. Kleinere Steinstücke prasselten ins Schiff. Bald konnte man drüben am Ufer von Stabiae anlegen neben einem größeren Schiff, das ebenfalls Pomponianus gehörte. Der Herr hatte seine anfängliche Beherrschtheit und Ruhe verloren. Er befahl aufgeregt:
«Rasch hinauf zur Villa! Wenn die Feuersteine noch heißer und größer fallen, brennt mein ganzes Gut nieder. Helft heruntertragen hier in mein Schiff, was zu retten ist. Wir werden aufs Meer hinausfahren!»

Oben in der Villa war ein wirres Durcheinander unter der Familie und Dienerschaft des Pomponianus. Seine Frau stürzte ihm weinend in die Arme, da sie schon um sein Leben gebangt hatte. Er aber wiederholte seine Befehle. Sogleich wurden Kisten und Kasten, Vorräte, Tuchballen und Teppiche hinunter ans Meer in das Schiff getragen. Die Träger mussten ihr Haupt zudecken, da mit der warmen Asche immer mehr Steine herabfielen. Milon bückte sich nach einem größeren Stück, das dicht vor ihm zu Boden fiel. Er nahm es in die Hand und fühlte die verglühende Hitze. Trotz seiner Größe war es seltsam leicht und roch schwefelig. Das war kein gewöhnlicher Stein, von einem Felsen gebrochen, das waren Schlacken aus dem Erdfeuer der Unterwelt, aus der Feuerwerkstatt des Hephaistos. Indes war nicht Zeit, seinen Gedanken nachzuhängen. Als er eben seine Bürde ins Schiff hineintrug, bemerkte er, dass ein Vierruderboot, vom Meer herkommend, in der Nähe anlegte. Die Insassen stiegen aus und näherten sich mit raschen Schritten dem Schiff des Pomponianus.
Ein würdiger älterer Herr rief ihn an:
«Ist Pomponianus oben im Hause?»
Da Milon bejahte, begab sich der Fremde mit seinen Begleitern den Treppenweg hinauf zur Villa. Als Milon sich auf dem Schiff seiner Ladung entledigte, sah er, dass die beiden Schiffswächter lange Besen in Wasserkübel steckten und die Bretter des Schiffes bespritzten, wo die heiße Asche mit dem Wasser einen grauen dampfenden Brei bildete. Auf dem Rückweg hinauf zur Villa stülpte er sich eine Lederschürze über den Kopf, um sich vor Steinschlag zu schützen. Er kam oben an, als Pomponianus gerade aus dem Hause unter das Vordach trat, um den unerwarteten Gast aus dem Vierruderboot zu begrüßen. Sie mussten alte Freunde sein; denn Pomponianus schloss ihn in die Arme und rief:
«Plinius, du bist es! Die Götter senden dich in dieser schlimmen Stunde zu mir.»
Der Fremde, der von hoher, gebieterischer Gestalt war, lächelte, machte mit der Hand eine beruhigende Gebärde:
«Was seid ihr alle so außer Rand und Band geraten? Wenn ein Berg etwas Asche und Unrat ausspuckt, geht die Welt noch nicht unter! Mein Freund, du willst doch jetzt nicht durch den Sarnus auf das Meer hinausfahren, um nach einigen Stunden des Herumirrens zurückzukehren?»
Pomponianus stammelte einige verlegene Worte. Da sprach der Gast weiter:
«Lieber Freund, ich wollte flussaufwärts zum Hofe des Cessus Bassus fahren; aber der Steinhagel hat mich zu dir getrieben. Lass uns zusammen essen und trinken und der Ruhe pflegen, bis sich Vesuvius wieder beruhigt hat.»
Diese Worte wirkten Wunder. Pomponianus verlor seine Aufgeregtheit und gebot Fuscus, das Hinuntertragen ins Schiff abzubrechen. Dann wendete er sich wieder seinem Gast zu:
«Mein Freund Plinius, ich wähnte dich in Rom. Was führt dich in diese Gegend?»
«Ich bin als Befehlshaber der kaiserlichen Flotte drüben in Misenum und habe Muße, alte Freunde zu besuchen, um sie vor Torheiten zu bewahren!»
Damit verschwanden die Herrschaften im Inneren des Hauses. Fuscus, der in der Nähe mit den Sklaven das Gespräch belauscht hatte, meldete wichtig:
«Das ist einer der mächtigsten Römer. Er gebietet über Tausende und fürchtet sich vor nichts; und wenn der Schlund der Erde vor ihm aufbräche, der kennt kein Zittern.»
Kaum hatte Fuscus diese Worte zu den Umstehenden gesprochen, verstärkte sich das Prasseln der Steine wieder, sodass schon Ziegel auf dem Dach zerbrachen. Auf Fuscus’ Befehl begab sich Milon in die Küche, da er mit Tyrios die Tafel für den hohen Gast zu richten hatte.
Der Untergang
Nach Beendigung des ausgiebigen Gastmahls fand Milon Gelegenheit, unter das Vordach des Hauses hinauszutreten und den drohenden Berg zu beobachten. Über den Gärten der Villa lag knöcheltief Asche. Es war sehr dunkel geworden, obwohl es erst Nachmittag war. Vom Vesuvius flammte es durch die Rauchnebel wie eine gewaltige Feuersbrunst. Nach dem Mahle traten auch Pomponianus, seine Angehörigen und der Befehlshaber Plinius unter das Vordach heraus. Ein Ausruf des Entsetzens wurde laut:
«Der ganze Berg brennt!»
Doch Plinius beruhigte:
«Das sind nur einige Bauernhäuser, die brennen, da sie nahe am Berge stehen. Lasst uns jetzt für eine Weile der Ruhe pflegen. Einmal wird der Berg ausgetobt haben. Der Zorn der Götter ist wie der Zorn der Menschen von kurzer Dauer.»
Also begaben sich die Herrschaften wieder ins Innere des Hauses. Plinius legte sich in eine Kammer, die vom Hof aus zu betreten war, um Mittagsschlaf zu halten. Der Regen von Asche und Steinchen ging unaufhörlich weiter.
Etwa nach einer Stunde begann ein so heftiges Beben der Erde, dass man glauben konnte, die Mauern der Gebäude rutschten auf dem Boden dahin. Dazu ertönte ein so entsetzliches Krachen, dass sich die ganze Bewohnerschaft, von Angst ergriffen, wieder unter dem Vordach einfand. Man ging Plinius wecken und musste schon Gewalt anwenden, um die Tür, die nach dem Hofe aufging, zu öffnen, da Asche und Steine bereits ein Hindernis bildeten. Als Plinius die Verschlimmerung der Lage nun auch gewahrte und vor allem die Gefahr, weiter im Hause zu verbleiben, das einstürzen konnte, erwog er mit Pomponianus ernsthaft, wohin man am besten fliehen könnte. Vom Sarnus her kam die Meldung, dass mit größeren Schiffen auf dem Fluss kein Durchkommen mehr sei, da die seichten Stellen bereits verstopft wären vom Schlamm der Asche und vom Steinregen. Es sei auch heftiger Gegenwind ausgebrochen, der eine Ausfahrt aufs Meer selbst für kleinere Boote verhindere.
Als plötzlich einige Balken und Ziegel des Daches herabstürzten, beschloss man nach aufgeregtem Hin und Her, in dem nur Plinius seine unerschütterliche Ruhe bewahrte, in die Felder südostwärts zu flüchten, möglichst weit weg von dem tobenden Berge.
«Stürzt das Haus ein, so sind wir lebendig begraben!», rief Pomponianus.
Nun banden sich die meisten ein Kissen auf den Kopf oder stülpten sich Körbe über, um vor dem Steinregen geschützt zu sein. Die Sklaven wurden angewiesen, Speise, Trank und Decken mitzunehmen. Es war dunkle Nacht geworden, als der geisterhafte Zug die Villa verließ, von schwankenden Windlichtern angeführt. Als er am Fischteich vorbeikam, leuchtete ein ferner Blitzstrahl auf. Milon gewahrte für einen Augenblick den in der Asche tanzenden Faun, immer noch Flöte spielend. Ihm schien, er grinse über die von Furcht ergriffenen, flüchtenden Menschen.
Das Vorwärtskommen über die zerbröckelnden, aschegetränkten Steinfelder war mühsam. Manch einer rutschte aus, stürzte und bedurfte der Hilfe, um sich wieder aufzurichten. Weinen und Jammern der Kinder, mitunter Schreie der Angst durchzitterten das unaufhörliche Prasseln der Schlackensteine. Alle hielten sich möglichst dicht hintereinander, da jeder fürchtete, den Anschluss zu verlieren und in die Irre zu gehen.
Fuscus führte, nach Anweisung des Plinius, den Zug etwas südlich auf die Küste zu, wo sich vielleicht die Gelegenheit einer Rettung aufs Wasser ergeben könnte. Es ging immer langsamer vorwärts, da zu allen Hindernissen die staubige Aschenluft das Atmen zu erschweren begann.
Plötzlich sank Plinius erschöpft zu Boden. Tyrios musste für ihn eine Decke ausbreiten. Er verlangte nach kaltem Wasser, das man ihm aus einem Krug reichte. Er trank zweimal. Bald aber trieb der heiße Wind einen stechenden Schwefelgeruch heran, der zu weiterer Flucht zwang. Auf Tyrios und Milon gestützt, richtete sich Plinius auf, brach aber im selben Augenblick tot zusammen.
Verwirrung und Entsetzen der Fliehenden waren nun vollkommen. Da es für sie jetzt nur ein Vorwärts gab, blieb der hohe Tote ohne Wächter in der Nähe des Meeresufers liegen, mit einer Decke zugedeckt. Durch die gewonnene Entfernung hatte der Steinregen nachgelassen; aber die Asche fiel wie Schnee im Winter. Neue Aufregung entstand, als die Frau des Pomponianus hinfiel, obgleich sie von ihrem Mann und einer Sklavin gestützt wurde. Sie verlor die Fassung und schrie auf:
«Es gibt keine Götter im Himmel! Die letzte Nacht ist angebrochen, die ewige Nacht, die unsere Erde verschlingt!»
Schließlich bettete man sie auf eine schwere Decke. Vier Sklaven hoben sie auf und trugen die Jammernde weiter. Pomponianus, mit seinen zwei Töchtern nebenhergehend, versuchte sie zu besänftigen, damit sie nicht ganz von Sinnen käme. Endlich lichteten sich langsam die dunklen Ballungen des Aschengewölks. Ein Schimmer von Tageslicht drang durch, und nach einer Weile leuchtete eine helle Stelle auf, wo die späte Nachmittagssonne am Himmel stand. Grau verstaubte Gestalten, wankten die Flüchtenden durch die weißlich tote Welt. Wohl lebte mit dem Hellerwerden ein Schimmer Hoffnung in den Geängstigten auf; aber das Beben der Erde setzte immer wieder von Zeit zu Zeit ein. Rückwärts, in Richtung Pompeji, war die ganze Gegend weiterhin in Finsternis gehüllt. Fernes Grollen ließ die Schrecken des Untergangs der blühenden Stadt ahnen.
Vor den Augen der Fliehenden erhob sich plötzlich in dunklen Umrissen gespenstisch ein Orangenbaum, aus dessen grauem Laubwerk goldgelbe Früchte wie aus einer unwirklichen Vergangenheit herunterleuchteten. Eine Scheune stand in der Nähe. Ihre festen Pfähle hatten dem Wanken der Erde widerstanden. Pomponianus ließ den Zug anhalten und gebot:
«Hier bleiben wir. Richtet drinnen ein Lager für die Herrschaft. Wir werden hier über Nacht bleiben. Vielleicht ist frühmorgens eine Rückkehr möglich.»
Um in die Hütte hineinzukommen, musste durch Asche und Steine der Zugang frei gemacht werden. Über dem Meer brach auf einmal die niedere Abendsonne unter der Wolkendecke durch und zauberte eine unwirklich rotglühende Landschaft aus Asche und Rauchschwaden hervor. Tyrios kletterte in den Orangenbaum, schüttelte das Geäst. Eine dicke Staubwolke fuhr daraus und eine Anzahl Früchte fielen nieder. Behände sammelte er sie in einen Korb, den er über sich getragen hatte, und rieb mit einem Tuch die Schalen sauber. Dann brachte er seine Gabe zu den Herrschaften, die dankbar danach griffen und die seltenen Früchte als unerwartetes Geschenk der zur Hölle gewordenen Erde verzehrten.
«Tyrios versteht es immer wieder, sich bei den Herrschaften angenehm zu machen», dachte Milon.
Er hatte inzwischen für das Gesinde ein Strohlager auf dem Aschenboden im Freien hergerichtet. Das Stroh hatte man in der Scheune vorgefunden. Plötzlich trat Fuscus zu ihm und sagte:
«Milon, du gehörst zu der Gruppe, die heute Abend mit mir zurück nach Stabiae muss. Pomponianus will das Schiff mit seinen Gütern nicht unbewacht lassen. Bereite dich zum Rückweg! In Kürze brechen wir auf.»
Wie gerne hätte sich Milon auf das eben bereitete Strohlager hingestreckt nach all den überstandenen Strapazen!