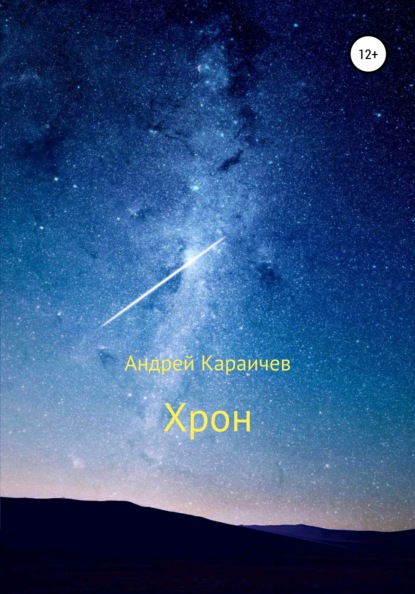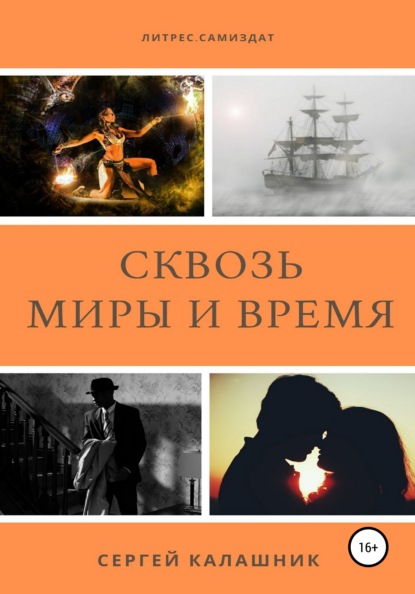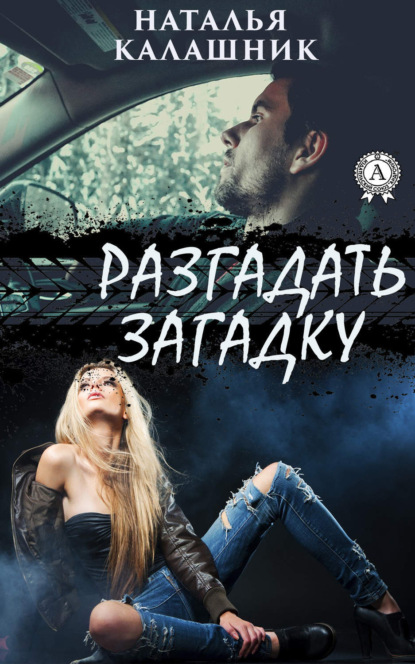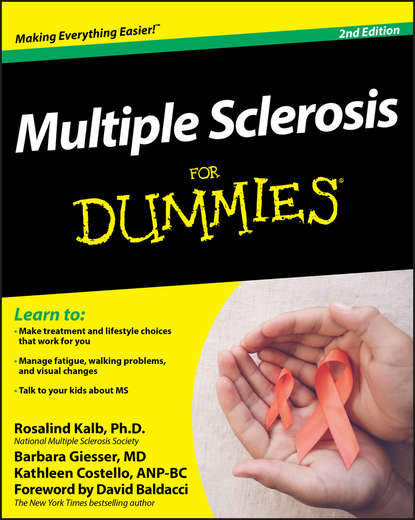Die chinesische Messaging-App WeChat als virtuelle Sprachinsel

- -
- 100%
- +
Die Franziskanermönche hatten die später mit pax mongolica bezeichnete Stabilisierung im Inneren des Mongolischen Reiches als Gelegenheit genutzt, um ihren Wirkungskreis weiter nach Osten auszudehnen. Den Franziskanern folgten nach einem signifikanten zeitlichen Abstand schließlich im Laufe des 16. Jahrhunderts missionierende Jesuiten. Diese prägten in Person u. a. ihres bekanntesten Vertreters, Matteo Ricci (von Collani 2012: 39-56), auf lange Zeit den Wissensstand, den man im Reich der Mitte zu Deutschland hatte:
[Collani brachte] 1584 eine mit Anmerkungen versehene Weltkarte in chinesisch [sic] heraus[], die auch auf Deutschland (Ju-erh-ma-ni-ya) Bezug nahm. Die dort sowie in dem ebenfalls von Patres auf kaiserlichen Befehl verfaßten Erläuterungswerk Chih-fang wai-chi (1623) niedergelegten, aufs Anekdotische beschränkten Notizen bildeten, immer wieder abgedruckt und in andere Schriften übernommen, bis ins 19. Jh. hinein für China die Hauptquelle der Deutschlandkenntnis. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 250; Hervorhebungen i.O.)
Die Vermittlung einer klaren Vorstellung von Deutschland war jedoch für geraume Zeit, einerseits aufgrund der changierenden Bezeichnungen im Chinesischen (vgl. oben; heute wird Deutschland im Chin. 德国 déguó genannt), andererseits aufgrund der französischen bzw. italienischen Herkunft der meisten Patres, schwierig. Ausnahmen gab es aber auch:
Ein gelehrter deutscher Jesuitenpater, Johann Adam Schall von Bell, stieg […] im Gründungsjahr der Mandschu-Dynastie (1644) immerhin zum Direktor des astronomischen Kalenderamtes auf, in dem auch später noch wiederholt deutsche Patres wirkten. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 250)
Hierbei wissen wir einerseits gesichert über das Wirken Deutschsprachiger in China, andererseits können wir nicht rekonstruierend einschätzen, wie sie tatsächlich (mit den Chinesen?) kommunizierten. Die Berichte der Jesuiten lösten im Europa des späten 17. und des 18. Jahrhunderts später eine Chinabegeisterung aus (zur Geschichte der Chinarezeption vgl. von Collani 2012, Kap. IX, 145-161, vgl. für eine detaillierte Aufstellung der deutschsprachigen Drucke der Chinareisenden im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit Jandesek 19923), die aber vor allem Frankreich erfasste. Im Vergleich war in Deutschland die Stimmung verhaltener bzw. ambivalenter:
Als Fürsprecher für einen engeren Kontakt zwischen der europäischen und der chinesischen Kultur trat Leibniz4 auf (Novissima Sinica, 16915), der die praktische Philosophie in dem seiner Ansicht nach vollendet geordneten Reich der Mitte besser verwirklicht glaubte und den Wunsch aussprach, daß lieber von dort Missionare nach dem Westen geschickt werden sollten. Viel skeptischer war dagegen Goethe, der das Chinesische vorwiegend als eine „Kuriosität“ gewertet wissen wollte, sich aber dennoch in einigen Werken (vor allem in den Chinesisch-deutschen Jahres- und Tageszeiten) von Übersetzungen aus dem Chinesischen anregen ließ. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 250; Hervorhebungen i.O.)
Leibniz dürfte trotz seines Einflusses mit seiner Meinung eher wenige Unterstützer gefunden haben, so dass die Vorstellung einer dem Westen überlegenen chinesischen Kultur so kaum weiter verbreitet worden sein kann. Kulturelle Gleichberechtigung wurde nicht angestrebt, ein kommunikativer Austausch auf Augenhöhe sollte noch Jahrhunderte lang nicht stattfinden; zu stark wirkten die Positionen aus den Heimatländern der Missionare. Auf einen Dialog mit den Chinesen wurde nicht gesetzt.
Die Jesuiten zogen sich nach dem sog. Ritenstreit Mitte des 18. Jahrhunderts, in dem man sich über die Art und Weise, wie christliche Mission in Asien generell zu betreiben sei (vgl. Huonder 1921, Minamiki 1985, Mungello 1985), entzweit hatte, aus China zurück. Ihren Platz nahmen während des 19. Jahrhunderts, das in der deutschsprachigen Sinologie v. a. die Chinesische Grammatik (1881) von Georg v.d. Gabelentz sah (Franke 1974: Sp. 1232), Andere ein:
[So] kamen im 19. Jh. andere katholische Missionen (so z. B. seit 1881 die Steyler Patres, darunter viele Deutsche) und vor allem auch protestantische Missionare nach China, unter denen die deutschen (u. a. die „Berliner Mission“ und die „Baseler Mission“) gegenüber den angelsächsischen freilich eine untergeordnete Rolle spielten. Einer der frühesten war der erst im Dienst der „Niederländischen Missionsgesellschaft“, dann als freier Missionar tätige Karl Friedrich August Gützlaff, der in China („Papa Kuo“) wie in Deutschland zu einer etwas zwiespältigen Berühmtheit gelangte, 1833 eine chinesische Zeitschrift über europäische Themen, die auch eine Beschreibung Preußens enthielt, und ca. 1844/45 eine chinesische Weltbeschreibung (Wan-kuo ti-li ch’üan t’u chi) herausgab, die eine Schilderung Deutschlands mit einschloß. Wie alle anderen Missionen wurden jedoch auch die deutschen allmählich immer mehr in die Kolonialinteressen ihres Heimatlandes verstrickt: Die Tötung zweier Steyler Patres (1897) gab Deutschland den Vorwand für die Besetzung des Kiaochow (Chiao-chou)-Gebietes, die am 6. März 1898 durch einen „Pachtvertrag“ legalisiert wurde. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 250-251; Hervorhebungen i.O.)
Die oben beschriebene eurozentrische Kommunikations- und Aktionsperspektive der Missionare wurde in anderer, analoger Form vom Kolonialismus abgelöst. Der Abschluss des oben zitierten Passus bietet eine für unseren Kontext geeignete Überleitung: Im Folgenden betrachten wir die kolonialen Bestrebungen des Deutschen Reiches in China.
2.2. Koloniale Bestrebungen des Deutschen Reiches in China
Die deutsch-chinesischen Beziehungen im politischen Sinn des Begriffs beginnen kaum vor der Mitte des 19. Jh. Die preußische Ostasienexpedition (wörtl. Expedition nach China, Japan und Siam) unter Graf Friedrich zu Eulenburg 1860-1862 wird in der Regel mit diesem Beginn ineinsgesetzt. Sie handelte im Namen des Norddeutschen Bundes (Zollvereins), und ihr Leiter schloß mit dem chinesischen Kaiserreich am 2. Sept. 1861 einen Freundschafts- und Handelsvertrag. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 245)
Seit den 1850er Jahren waren Deutsche entlang der chinesischen Küste im Rahmen einer auf Expansion ausgerichteten Handels- und Schifffahrtspolitik aktiv, es gab an verschiedenen Hafenstandorten hanseatische Konsuln. Diese Aktivitäten hatten nach dem Nankinger Vertrag von 1842 zur Beendigung der Opiumkriege und der sukzessiven Ermöglichung eines freieren Handels in den chinesischen Küstenstädten begonnen (vgl. Wood 1996), der primär den Briten zu Profit und Kontrolle in der Region verhelfen sollte (sie annektierten v. a. Hongkong). Deutschland folgte dem britischen Beispiel: „Aufbruch, Beginn und Ausbau der Beziehungen erfolgten bis in die 1880er Jahre durchaus im Fahrwasser der englischen Vormacht, politisch und auch ökonomisch war die deutsche Rolle in China eine sekundäre.“ (Grimm/Bauer 1974: Sp. 245) Alles, was den wirtschaftlichen Interessen dienen konnte, wurde umgesetzt, diesen Zielen war jedwede Kommunikation untergeordnet. Ein Austausch mit den Chinesen blieb auf das Notwendigste beschränkt. China begriff Preußen als eine der kleineren involvierten Mächte und verhielt sich ihm gegenüber einerseits entsprechend zurückhaltend und bewusst verzögernd:
Auf der anderen Seite bedeutete der erfolgreiche Abschluß eines Vertrages mit China für das aufstrebende Preußen eine willkommene Stärkung seiner Position in Europa. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 245)
Der Sieg gegen Frankreich 1870/71 stärkte Preußens Position in Europa und auch im imperialistischen Machtgefüge, in dem Frankreich neben den Briten Deutschland voraus gewesen war, nachhaltig. Diese neue exponierte Rolle fiel zeitlich zusammen mit dem Wunsch des spätkaiserlichen China, eine moderne Armee aufzubauen; dieser „sollte fortan auch mit Hilfe deutscher Waffen und Militärexperten“ (Grimm/Bauer 1974: Sp. 246) realisiert werden. An dieser Stelle nimmt China eine aktivere Rolle in der bis hierhin zumeist von den Deutschsprachigen diktierten Kommunikation ein:
Der in Tianjin residierende Kanzler Li Hongzhang (1823–1901), der 1896 als Kaiserlicher Bevollmächtigter gemeinsam mit seinem deutschen Berater Gustav Detring (1842–1913) Russland, Europa und Amerika besuchte, war eher deutschfreundlich eingestellt und sah in Deutschland in Bezug auf Waffentechnik, militärische Organisation und Schulung von Soldaten ein Vorbild für China. Er sah darin wohl auch die Chance, durch eine Balance innerhalb des Landes, die westlichen Mächte gegeneinander auszuspielen. Gustav Detring fungierte zwischen 1877 und 1905 als chinesischer Seezolldirektor in Tianjin und hatte als Berater Li Hongzhangs dessen pro-deutsche Einstellung sicher mit beeinflusst. Mit Hilfe des früheren Generalgouverneurs von Zhili und späteren Kanzlers Li Hongzhang war es Deutschland gelungen, seine wirtschaftlichen Beziehungen zu China zu verbessern, denn – so die Auffassung des Historikers Ding Jianhong – Li war nicht nur ein Bewunderer Bismarcks, er war ebenso überzeugt von der Überlegenheit deutscher Waffentechnik. Abgesehen davon hegte er auch die Hoffnung, die in China vertretenen westlichen Mächte in gegenseitigen Rivalitäten zu binden und damit China einen Vorteil zu verschaffen. Die Waffengeschäfte deutscher Unternehmen, an ihrer Spitze die Firma Krupp, hatten Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts einen Höhepunkt erreicht. Um diese Zeit war China der größte ausländische Abnehmer deutscher Rüstungsgüter geworden. (Schmitt-Englert 2012:39)
Nach Grimm/Bauer (1974) prägte die daraufhin eingegangene Handelskooperation zur Realisierung politischer Ziele in beide Richtungen (hier wird sukzessive erstmals eine eher auf Augenhöhe geführte Kommunikation wichtiger) das Bild des jeweils anderen Landes wohl nachhaltiger als vielerlei kultureller Austausch:
Es gehört zu den ungern wahrgenommenen Tatsachen in den deutsch-chinesischen Beziehungen, daß Waffengeschäfte und Militärexpertisen in Verbindung mit Fleiß, technischem Können und Ordnungsliebe das Bild des Deutschen in China mehr geprägt haben als kulturelle Errungenschaften. Auch umgekehrt muss festgehalten werden, daß es die autoritären Züge der chinesischen politischen Kultur gewesen sind, die das deutsche Bewußtsein von China mehr als solche revolutionärer Art bestimmt haben, und zwar seit der Taiping-Revolution1 [1851-1864; MSZ] bis 1949. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 246)
In jedem Fall zeigte sich eine schnell ansteigende geschäftliche Aktivität von Deutschen in China:
Schon bald nach der Niederschlagung des Taiping-Aufstandes bewirkte die Öffnung des Suez-Kanals 1869 einen gewaltigen Schub im deutschen Chinahandel. 1877 waren bereits 41 deutsche Firmen in China vertreten, von denen sich 17 in Shanghai niedergelassen hatten. Entsprechend war die Zahl der Deutschen auf 414 angewachsen. Eine andere Quelle geht gar von 45 deutschen Unternehmen im Jahr 1876 mit 326 Deutschen aus, über die Hälfte davon (26 Niederlassungen und etwa 200 Deutsche) in Shanghai. Damit stand Deutschland an dritter Stelle hinter England (226 Firmen, 1611 Engländer) und Amerika (45 Firmen, 536 Amerikaner), aber vor Frankreich (10 Firmen, 298 Franzosen). In den Folgejahren überstieg die Anzahl der deutschen Niederlassungen sogar die Zahl der amerikanischen. Aus einer Statistik des Jahres 1897 geht hervor, dass Deutschland mit seiner wirtschaftlichen Präsenz von 104 Firmen und 950 Personen an zweiter Stelle hinter Großbritannien (374 Firmen, 4929 Personen) und vor den USA (32 Firmen, 1564 Personen) und Frankreich (29 Firmen, 50 Personen) angesiedelt war. (Schmitt-Englert 2012:37)
Mit der längerfristigen Ansiedlung deutscher Arbeitskräfte an Standorten wie Shanghai, über deren Kommunikation untereinander (auch mit Blick auf die Interaktion mit den Chinesen) wir heute kaum etwas wissen, da zu wenig Zeugnisse erhalten sind, ging zwangsläufig auch mehr Kommunikation zwischen Deutschen und Chinesen einher, auch wenn sich diese oft auf den Bereich des täglichen Bedarfes an Gütern beschränkt haben dürfte (Schmitt-Englert 2012, Kap. 1.2., beschreibt das Shanghaier Pidgin der dort ansässigen Ausländer). Den deutschen imperialistischen Vertretern wird ähnlich wie ihren britischen und französischen Pendants „herrisches Auftreten und de[r] Gebrauch von Machtworten“ (Grimm/Bauer 1974: Sp. 247) attestiert. Hernig (2016) geht in seiner Einschätzung weiter:
Die Truppen des deutschen Kaisers benahmen sich in China so schlecht wie alle anderen ausländischen Militärs. Tausende von chinesischen Aufständischen starben durch deutsche Gewehre bei der Niederschlagung des Boxeraufstands von 1900, der sich gegen die christlichen Missionare und die Ausbeutung Chinas durch die laowai2 richtete, unzählige Zivilisten mussten bluten. In seiner berüchtigten „Hunnenrede“ hatte der deutsche Kaiser Wilhelm II. gegen die chinesischen „Untermenschen“ gewütet: Die sollten es nicht wagen, einen Deutschen auch nur „scheel“ anzusehen. (Hernig 2016: 105; Hervorhebung i.O.)
Dies zeigt weiter eine denkbar große Ungleichheit der kommunikativen Voraussetzungen zwischen Deutschsprachigen und Chinesen im Reich der Mitte bis dahin. Eine zu allem entschlossene Handlungsweise der deutschen Kolonialmacht hatte sich schon nach den Ereignissen manifestiert, die mit der oben erwähnten Ermordung zweier Steyler Missionare ihren Anfang nahmen.
Mühlhahn (2007) beschreibt kompakt die Entwicklungen zur Einrichtung der deutschen Kolonie „Kiautschou“ im Nordosten Chinas mit dem Zentrum Qingdao und ihre Geschichte:
Am 1. November 1897 ermordeten Mitglieder einer antichristlichen Kampfgruppe in der nordchinesischen Provinz Shandong zwei deutsche Missionare. Dies diente der deutschen Regierung als Vorwand, das damalige Dorf Qingdao an der Jiaozhou-Bucht von deutschen Marineeinheiten am 14. November 1897 besetzen zu lassen. Nach längeren Verhandlungen erfolgte am 6. März 1898 die Unterzeichnung eines Vertrages mit China, in dem das Gebiet um die Bucht (von den Deutschen „Gouvernement Kiautschou“ genannt) auf 99 Jahre an Deutschland verpachtet wurde und dem Deutschen Reich Rechte zur Errichtung zweier Eisenbahnlinien und zur Anlage von Bergwerken in Shandong zugesichert wurden. Doch statt 99 Jahre währte die deutsche Kolonialzeit nur 17 Jahre. Kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Europa stellte Japan im August 1914 dem Deutschen Reich ein Ultimatum, Kiautschou bedingungslos zu räumen. Nach Kämpfen im September und Oktober kapitulierte die Kolonie am 7. November 1914. (Mühlhahn 2007: 43)
In der Rückschau werden die Lebensbedingungen in Kiautschou in einer durch geographische, rechtliche und auch kulturelle Segregation geprägten Ordnung – weiter ohne eine auf gegenseitigem Austausch basierende Kommunikation (hierzu wissen wir ingesamt viel zu wenig Gesichertes, anders als für andere Orte; vgl. Schmitt-Englert 2012) – von Mühlhahn folgendermaßen rekonstruiert:
[D]er chinesischen Bevölkerung war es verboten, innerhalb des europäischen Teiles von Qingdao zu wohnen. Für die chinesische Bevölkerung galt außerdem eine völlig andere Rechtsordnung, die sich hinsichtlich der Strafformen (zum Beispiel Prügelstrafe) überwiegend an dem traditionellen chinesischen Recht orientierte. Für die europäische Bevölkerung galt hingegen das ,moderne‘ Recht des Deutschen Reiches. Im Ergebnis wurden für ein und dasselbe Delikt gegen einen Chinesen ein anderes Strafmaß und andere Strafformen verhängt als gegen einen Deutschen. Neben dem Aufbau einer umfassenden Verwaltung kam es in Qingdao also zur konsequenten bürokratischen Umsetzung und Normalisierung einer Rassenideologie. Dem Zweck der auf dem Verordnungswege durchgesetzten und kontrollierten Absonderung dienten vielfältige, sorgsam durchdachte Entscheidungen und Aktionen der Verwaltung, wie die genannte strikte Trennung der chinesischen und deutschen Wohngebiete und die unterschiedlichen Gesetze für Deutsche und Chinesen. Die Rassentrennung wurde erst in den letzten Jahren der Kolonie ab 1910 gelockert. Die Verwaltung kam damit wachsender Kritik der chinesischen Bevölkerung an der Rassentrennung nach. (Mühlhahn 2007: 44-45)
Kulturell setzten die Deutschen laut Mühlhahn darauf, die chinesische Kultur über die Vermittlung deutscher Kultur an die Chinesen zu verändern. In einer gemeinsamen Anstrengung von Behörden, Kirchen und privaten Trägern (Mühlhahn 2007: 45) sollte ab 1905 Kiautschou nicht mehr bloß ein Außenposten des deutschen Handels sein, sondern vielmehr eine Art deutsches Kulturzentrum in China: „Die vom Deutschen Reich in Kiautschou systematische betriebene Kulturpolitik sollte neben Diplomatie und Außenwirtschaftspolitik die dritte Säule in den Beziehungen zu China werden.“ (Mühlhahn 2007: 45) Insgesamt stießen diese kommunikativen Bestrebungen bei der chinesischen Bevölkerung während der Kolonialzeit auf eine ambivalente Reaktion: Es gab einerseits Positionen, die die Haltung der Kolonialherren rigoros ablehnten, und andererseits nutzten Menschen die sich ihnen bietenden Chancen, ihre eigene Lebenssituation durch die Interaktion mit den Deutschen zu verbessern. Hierbei sind sowohl Menschen vom Lande zu erwähnen, die sich angesichts ihrer Armut neue Möglichkeiten versprachen, wie auch einige Kaufleute, die von der Situation profitierten (vgl. Mühlhahn 2007: 46).
Grimm/Bauer (1974: Sp. 247) halten fest, dass die Deutschen als Kolonialherren bei den Chinesen insgesamt als – wenn man dies so sagen kann – beliebter gegolten hatten als die größeren Kolonialnationen: „Deutsche galten in China in der Regel als umgängliche Leute. Sie waren weniger typische Kolonialherren als etwa Engländer und Franzosen. […] Deutsche wurden von den Chinesen oft weit freundlicher behandelt als von ihren ehemaligen europäischen Partnern […]“. Insgesamt war aber, wie oben bereits vorweggenommen, die Kolonialzeit auch für das Deutsche Reich nicht von nachhaltigem Erfolg gekrönt. Dennoch bestanden natürlich auch nach der Kapitulation Kiautschous weiterhin deutsch-chinesische Beziehungen, die sich aber weniger auf gemeinsame kulturelle Werte und Austausch, sondern vielmehr auf ein pragmatisches wirtschaftliches Miteinander gründeten.
2.3. Zwischenkriegszeit
Durch die geopolitische Lage, die sich im Laufe des Ersten Weltkrieges und nach seinem Ende ergab, entstand für das Spannungsfeld zwischen China und Deutschland eine besondere, eine gegenseitige Annäherung begünstigende Situation:
Die Einnahme Kiaochows durch Japan nach zehnwöchiger Belagerung am 7. Nov. 1914 und die nach einer anfänglichen Neutralitätserklärung vom 6. Aug. 1914 auf Drängen der USA am 14. Aug. 1917 erfolgte Kriegserklärung Chinas an Deutschland legten zunächst zwar alle deutschen Kultureinrichtungen lahm (die von Missionen betriebenen allerdings nur mit Einschränkungen), erwiesen sich aber in der Folge als eine fast vorteilhafte Niederlage: Das Nachrücken Japans in die Positionen der ehemaligen deutschen Kolonialmacht, das durch den am 28. Juni 1919 von China endgültig abgelehnten Versailler Vertrag von den Westmächten sanktioniert wurde, brachte China und Deutschland als gemeinsame Verlierer nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch kulturell näher. Der offiziellen Erklärung der Beendigung des Kriegszustandes zwischen den beiden Ländern durch Präsident Wilson (Sept. 1919) folgte am 20. Mai 1921 das deutsch-chinesische Abkommen, das als erster Vertrag mit einer europäischen Macht auf den Grundsätzen der völligen Gleichstellung beruhte. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 252)
In Chinas Augen wurde Deutschland so in einer Art Umkehrung der kolonialen Geschichte zu einem Modellfall, wie die Beziehungen zu westlichen Nationen in der Zukunft ausgestaltet werden könnten. Hier bestanden Chancen auch zu mehr interkulturellem Austausch mit den in China präsenten Deutschen. Deutschland verfolgte dennoch eigene wirtschaftliche Ziele und wollte weiter in China Handel treiben können:
Die Vertreter der deutschen Chinawirtschaft wollten […] nichts von größeren Kompromissen, Zugeständnissen und Rücksichtnahmen in China wissen. Keinesfalls sollten die „legitimen Ansprüche“ – z. B. auf ein Niederlassungsrecht – aufgegeben werden, wie es der Ostasiatische Verein in einer Stellungnahme zu einer Denkschrift der Deutsch-Chinesischen Verbandes über „Friedensziele in China“ formulierte […]. (Ratenhof 1987: 283)
Schmitt-Englert (2012) illustriert in ihrer Studie, die auf in der Zeit zwischen 1920 und 1950 in China lebende Deutsche fokussiert, dass es verschiedene Zentren gab, an denen Deutsche angesiedelt waren. Hierbei geht sie jeweils ausführlich auf Shanghai, Tianjin und Beijing ein und inkludiert auch Aspekte zum Alltagsleben. Allerdings gibt es in ihrer Studie keine explizite Kommunikation mit den Chinesen thematisierende so benannte Abschnitte. Aus Umfangsgründen kann in der vorliegenden Studie nicht näher auf die Lebensumstände der deutschen Population in diesen Städten während dieser Zeit eingegangen werden. Szurawitzki (i.V.) betrachtet am Beispiel der Shanghaier Publikation Gelbe Post zu Zeiten jüdischer Immigration auf der Flucht vor den Nationalsozialisten Werbekommunikation für und durch Flüchtlinge, deren Identitäten sich teils auch in der Werbung spiegeln. Insgesamt stellen diachrone linguistische Studien zur Kommunikation v. a. in der Shanghaier Diaspora ein übergreifendes Desiderat in der Forschung dar. Hierzu ließen sich geeignet u. a. die digitalen Archive des Leo Baeck Institutes1 nutzen, die v. a. für Shanghai Tausende Digitalisate enthalten.
Zurück zu den größeren wirtschaftlich-politischen Linien der Zeit: Mit Blick auf spätere Geschäftstätigkeit hatten deutsche Handelskreise Japan signalisiert, keine Ansprüche auf die Kolonialgebiete um Qingdao zu erheben, um später vielleicht in den Genuss von wirtschaftlichen Vorteilen zu gelangen (Ratenhof 1987: 283). Diese Vorstellungen sollten sich zunächst aber in der Praxis nicht umsetzen lassen, die Geschäfte liefen nicht vergleichbar gut wie vor dem Krieg (Ratenhof 1987: 284-286). Erst gegen Mitte der 1920er Jahre konnten in den Ausfuhren nach China, aber auch nach Japan, die besten Vorkriegsjahre übertroffen werden (Ratenhof 1987: 291). Dennoch achtete die deutsche Wirtschaft darauf, dass auch kulturelle und auf Kommunikation setzende Projekte forciert wurden, hierbei vor allem der Wiederaufbau der 1907 in Shanghai mit deutschen Mitteln eingerichteten Tongji-Universität (Ratenhof 1987: 296; vgl. hierzu auch 2.6. unten). Ein zentrales Interesse zur Anknüpfung an alte wirtschaftliche Erfolge sollte der Rüstungsindustrie (vgl. oben) zukommen:
Über die Wiederaufnahme rüstungswirtschaftlicher Beziehungen und guter Verbindungen zum chinesischen Militär in China [sic] hoffte sie [die deutsche Chinawirtschaft; MSZ], die Geschäftsgrundlage langfristig stabilisieren zu können. Die Industrie blickte hierbei bereits seit Anfang der 20er Jahre vor allem nach Südchina. Die Kuomintang-Gegenregierung in Canton schien die beste Aussicht zu bieten, China zu einigen und die Modernisierung auch zum Vorteil der deutschen Wirtschaft fortzuführen […]. (Ratenhof 1987: 299)
Politisch erwies sich die Umsetzung von Geschäften mit Rüstungsgütern mit der Kuomintang aber als schwierig, einerseits aus den Regelungen des Versailler Vertrags, andererseits aus politischen Vorbehalten heraus (vgl. Ratenhof 1987: 306). Es wurde zunächst der Handel mit relevanten Ersatzteilen wieder angeschoben, insgesamt konnte aber nicht an die Situation der 1870er Jahre angeknüpft werden:
Die Hoffnungen der deutschen Industrie, wieder stärker ins chinesische Rüstungsgeschäft einzudringen, konnten trotz der „laissez-faire“-Haltung der Reichsregierung gegenüber deutschen Beratern und Technikern in China […] nur teilweise erfüllt werden. Obwohl die Chinesen deutsches Rüstungsmaterial äußerst schätzten, blieb die Situation der Rüstungswirtschaft auf dem chinesischen Markt in noch weit größerem Maße […] unbefriedigend. (Ratenhof 1987: 310)
Als schwierig zeigte sich neben traditionell (selbst heute noch) schwer zu führenden Verhandlungen auch die innenpolitische Lage in China. Wollte Deutschland die Militärmachthaber im Norden stützen oder eher die kommunistische Gegenregierung im Süden, die offen wohlwollend Deutschland gegenüberstand (Ratenhof 1987: 315)? Die wirtschaftlichen Interessen der Konzerne lagen hier mit den Vorstellungen des Auswärtigen Amtes über Kreuz. Insofern entstand eine Situation, in der der Handel mit dem Norden wie dem Süden – mit Fokus auf dem Norden – quasi durch das AA geduldet wurde, das Ministerium jedoch die Kaufleute darauf eindrücklich hinwies, dass von Seiten der Reichsregierung bei Konflikten keine Unterstützung für sie zu erwarten sei (Ratenhof 1987: 313, 323). Wirtschaftliches Engagement in China wurde weiterhin geduldet, aber ohne eine größere offene politische Agenda oder Einflussnahme (Ratenhof 1987: 324):