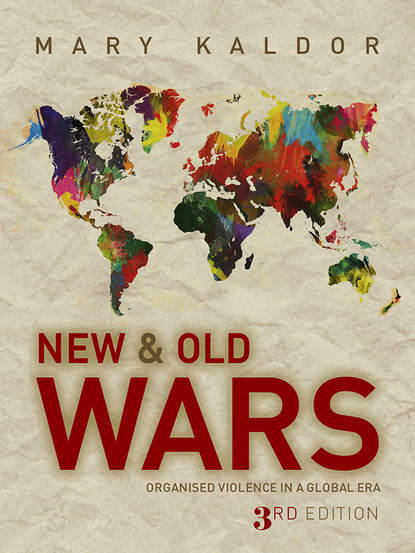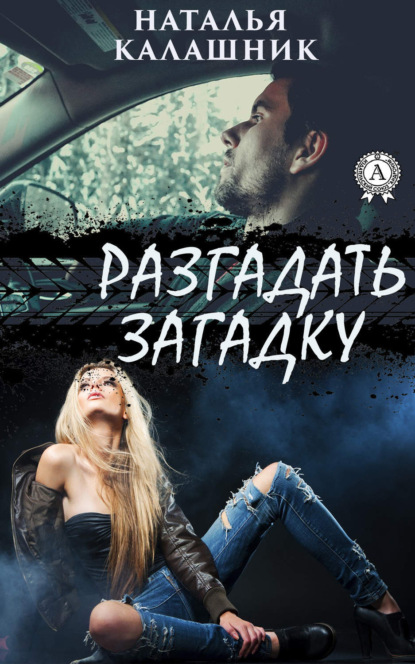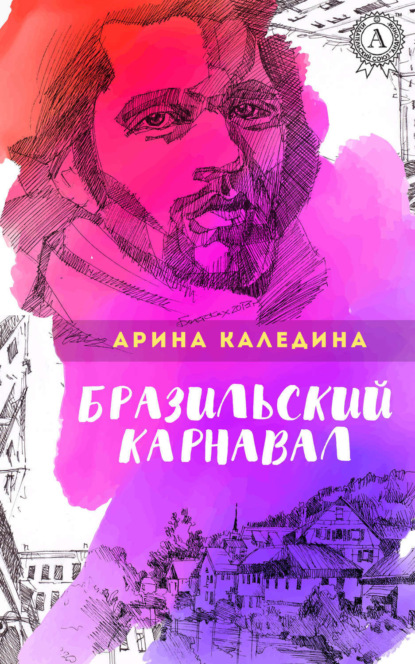Die chinesische Messaging-App WeChat als virtuelle Sprachinsel

- -
- 100%
- +
Die Neutralitätspolitik der Reichsregierung in China, die sich Ende 1926 bewusst als eigenständiger Weg zwischen den Bürgerkriegsparteien und zwischen den Mächten verstand, suchte zwar weiterhin die Nähe zum Westen, wollte sich aber keinesfalls in den russisch-angelsächsischen Konflikt in China einmischen oder sich von irgendeiner Macht in eine chinafeindliche Position drängen lassen. (Ratenhof 1987: 337)
Neben deutschen Importen nach China gelang es ab Mitte der 1920er Jahre auch chinesischen Firmen, mit ihren Erzeugnissen in das Exportgeschäft Richtung Deutschland einzusteigen (Ratenhof 1987: 339-340). Hier erweitert sich die Sphäre des Handelsaustausches und somit der Notwendigkeit von mehr Kommunikation, bei der die Chinesen als gleichberechtigte Geschäftspartner angesehen werden. Insgesamt zeigte sich die deutsche Wirtschaft nicht zufrieden mit dem Ende in China der 1920er Jahre erreichten Geschäftsvolumen, das weit hinter den Großmächten zurückblieb (Ratenhof 1987: 342-344). Die – für die Deutschen sehr lukrativen – Waffengeschäfte waren für den Norden wie für den Süden Chinas ein Zankapfel, der sowohl das diplomatische Korps in Peking wie die Reichsregierung von beiden Seiten unter Druck setzte (Ratenhof 1987: 343). Offiziell war der politische Kurs mehr in Richtung Japan ausgerichtet, zu China sollte eine Neutralität des diplomatischen Austausches gewahrt bleiben. Die deutsche Wirtschaft jedoch strebte eine stärkere Unterstützung der Kuomintang im Süden Chinas an (Ratenhof 1987: 348). Diese von der Industrie forcierte Linie zur Aufrüstung fand bei den eher an internationalen Lösungen interessierten Diplomaten naturgemäß weniger Anklang (Ratenhof 1998: 353-355). Bevor wir weiter auf die politisch-wirtschaftlichen Entwicklungen blicken, richten wir im Folgenden den Fokus auf die sich parallel vollziehenden Schritte kulturellen Austausches zwischen Deutschland und China.
Seit den Studentenprotesten gegen den Versailler Vertrag in der sog. Bewegung des 4. Mai im Jahre 1919 war eine „erhöhte kulturelle Weltoffenheit“ (Grimm/Bauer 1974: Sp. 252) in China zu spüren, die sich positiv auf die Rezeption der deutschen Kultur auswirkte. Dies betraf u. a. die Werke von Marx und Engels, die bis heute Pflichtlektüre für alle Studierenden an Universitäten sind, Schopenhauer, Kant, Nietzsche, Goethe, den Gebrüdern Grimm, Schiller, Heine und Anderen (ebd.). Grimm/Bauer (1974: Sp. 253) konstatieren, dass diese „neuen geistigen Beziehungen“ nach Deutschland zurückwirkten, dessen Sinologie mittlerweile von den Kategorien der Soziologie und Ethnologie beeinflusst war, nachweislich ein Verdienst von August Conrady (Franke 1974: Sp. 1233):
Mit China befaßte kulturelle Vereinigungen bestanden in Deutschland z.T. schon seit vor dem Weltkrieg, so namentlich die „Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens“, die „Gesellschaft für Ostasiatische Kunst“, der „Ostasiatische Verein Hamburg-Bremen“ und der 1914 aus dem Kulturausschuß der „Deutsch-Asiatischen Gesellschaft“ hervorgegangene „Verband für den Fernen Osten“, von denen die beiden letzten allerdings in erster Linie wirtschaftliche Interessen vertraten. Sie wurden aber nach dem Weltkrieg durch eine Reihe weiterer Institutionen verstärkt. Besondere Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang das 1925 eröffnete China-Institut an der Universität Frankfurt/Main. Sein Gründer und erster Direktor, Richard Wilhelm, der 1899 als evangelischer Missionar nach China gegangen war, hatte mit seinen Schriften und Übersetzungen aus dem Chinesischen eine große Wirkung auf das deutsche Publikum, die auch heute noch spürbar ist. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 253)
Diese Einschätzung kann heute noch als valide angesehen werden, wie man der Literatur zum Schaffen Richard Wilhelms, das hier aus Umfangsgründen nicht ausführlich gewürdigt werden kann, entnehmen kann. Eine seiner bis heute erhältlichen Übersetzungen ist diejenige des Buchs der Wandlungen (z. B. Wilhelm 2005); für eine ausführliche Nachzeichnung von Wilhelms letztem Lebensjahrzehnt 1920–1930 vgl. Zimmer (2008). Weitere sinologische Zentren bildeten sich in Hamburg (Otto Franke war seit 1909 der Inhaber der ersten planmäßigen China-Professur in Deutschland), Berlin und Leipzig (Franke 1974: Sp. 1233). Nach 1933 erlitt die Sinologie in Deutschland durch die Auswanderung bedeutender Forscher „einen schweren Rückschlag“ (Franke 1974: Sp. 1234).
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten „gerieten die deutsch-chinesischen Beziehungen zwangsläufig in eine schwierige Situation, selbst wenn zunächst noch das ,Deutschland-Institut‘ in Peking gegründet werden konnte“ (Grimm/Bauer 1974: Sp. 253). Weiter erschienen u. a. in Shanghai, Peking und Tianjin deutschsprachige Zeitschriften (eine Übersicht ist aus geschichtswissenschaftlicher wie linguistischer Sicht Desiderat), auch Deutschunterricht gab es in China. Seit 1933 existierte in Shanghai aufgrund v. a. jüdischer Emigration eine große deutschsprachige Kolonie (vgl. Szurawitzki 2017a: 3-6). Parallel gab es in Deutschland weiter viele chinesische Studierende:
Nachdem zwischen 1919 und 1933 insgesamt 265 Chinesen in Deutschland promoviert hatten […], lagen sie [1939 und 1940] gar an der Spitze aller ausländischen Promovierten. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 254)
Diese sich damals schon zeigende Tendenz gilt heute auch wieder, indem die chinesischen Studierenden mit 36.915 (2018) die größte ausländische Gruppe von in Deutschland immatrikulierten AusländerInnen darstellen2. Mit dem Hereinbrechen des Zweiten Weltkrieges brachen sukzessive alle kulturellen Beziehungen ab.
Deutschland hatte in China seinen „eigenen wirtschaftlichen und politischen Spielraum“ (Ratenhof 1987: 539) signifikant erweitern können, auch wenn man von den westlichen Großmächten insgesamt politisch abhängig gewesen war und öfter aufgrund der eigenen Interessen – wie Waffengeschäften – Ärger mit ihnen heraufbeschwor. Eine gewollte militärische Modernisierung der verschiedenen Machthaber in China (Ratenhof 1987: 540) begünstigte die Auftragslage der deutschen Firmen. Zwischen 1933 und 1938 beteiligte sich Deutschland so aktiv an der „Wehrhaftmachung des Staates“ (Ratenhof 1987: 542).
Die deutsche Außenpolitik ließ insgesamt die innenpolitischen Anliegen Chinas außen vor und setzte auf Weltmachtstreben und einen nationalen Revisionismus (Ratenhof 1987: 541). Das Militär übernahm auch in der Außenpolitik in Richtung China die Führung (Ratenhof 1987: 544). China sei potenziell ein auszubeutender Rohstofflieferant, nicht viel mehr (ebd.). An dieser Stelle kommen (wieder) koloniale Denkmuster, auch mit Blick auf die Kommunikation, zum Tragen.
2.4. Die deutschen Beziehungen zur VR China ab 1949 bis in die 1970er Jahre
Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges hatte sich die Situation in den deutsch-chinesischen Beziehungen besonders aufgrund einer Position zwischen den beiden ostasiatischen Großmächten China und Japan problematisch dargestellt:
Nach dem gescheiterten Vermittlungsversuch zwischen China und Japan 1937, der in der engen wirtschaftlichen Verbindung zu China einerseits und der wachsenden politischen Annhäherung an Japan andererseits seinen Grund gehabt hatte, beeinträchtigte die kriegsbedingte Spaltung Chinas in die Chungking-Regierung und die mit der japanischen Besatzungsmacht kollaborierende Nanking-Regierung unter Wang Ching-wei zunehmend auch die Kulturbeziehungen, entscheidend schließlich durch die Anerkennung der Nanking-Regierung durch Deutschland (1. Juli 1941), der die Kriegserklärung der Chungking-Regierung (8. Dez. 1941) unmittelbar folgte. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 254)
Politisch war Nazi-Deutschland mit Japan verbunden, insofern spielte China nur eine eher strategische Rolle in den Überlegungen der NS-Diktatur. Hier kam es bisweilen aber zu abwegigen Hoffnungen, Deutschland könne sich dauerhaft an ein China kontrollierendes Japan gewissermaßen ,anhängen‘ und so ohne viel eigenes Zutun profitieren (Ratenhof 1987: 546). Dazu kam, dass China lange bestrebt war, freundschaftliche Bande zu Deutschland aufrechtzuerhalten:
Hingegen versuchten die Chinesen trotz Drängens der Alliierten, so lange wie möglich freundschaftliche Verbindungen zu ihrem Modernisierungsvorbild Deutschland zu halten – ein Verhalten, das die vergangene deutsche Chinapolitik mit ihren tatsächlichen Absichten gar nicht verdient hatte. (Ratenhof 1987: 546)
Aus Umfangs- und Relevanzgründen betrachten wir hier explizit nicht die Geschehnisse während des Zweiten Weltkrieges, sondern setzen mit der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949 und der deutschen Teilung im selben Jahr an. Aufgrund der Nähe der politischen Systeme kam der DDR zunächst eine besondere Rolle zu. Sie setzte aus verständlichen Gründen der ideologischen Nähe viel früher als die Bundesrepublik Deutschland auf Kommunikation mit der VR China:
Bis Mitte der 1960er Jahre waren die deutsch-chinesischen Beziehungen vor allem von der DDR ausgestaltet worden, die bereits im Oktober 1949 mit der neuen kommunistischen Regierung in Peking Botschafter ausgetauscht hatte. Nach einem Freundschafts- und Kulturabkommen (25. Dezember 1955) konnte sich Ostberlin in den 50er Jahren hinter der Sowjetunion zum zweitgrößten Handelspartner der Volksrepublik China entwickeln. Der Studentenaustausch nahm größere Dimensionen an. Selbst als die Sowjetunion sich längst von Peking abgewandt hatte, blieben die guten Kontakte zunächst weiter bestehen. Erst ab 1963 gerieten die Beziehungen in eine ernste Krise, von der letztlich dann das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zur Volksrepublik China profitierte. (Ratenhof 1987: 554)
Die Bundesrepublik Deutschland war außenpolitisch um einen neutralen Kurs gegenüber der VR China und Taiwan bemüht (ebd.) und hatte gleichzeitig enge Beziehungen zu den USA. Die Volksrepublik China stellte wirtschaftlich einen weit attraktiveren Markt als Taiwan dar; insofern verwundert es nicht, dass die deutsche Wirtschaft trotz der politischen Andersartigkeit des Systems weiter mehr Interesse an China zeigte und am „privilegierten Partner“ (Ratenhof 1987: 555) weiter festhielt. Dies geschah jedoch nicht ohne Schwierigkeiten, da internationale Handelsbeschränkungen existierten und der Warenverkehr und Bankgeschäfte nicht ohne die Hilfe internationaler Partner realisiert werden konnten (ebd.). Hierbei gab es Anfang der 1950er Jahre sogar (nicht verwirklichte) Bestrebungen von Handelskooperationen, in die Bonn wie Ostberlin involviert hätten sein sollen. Mit der Lockerung amerikanischer Embargopolitik Mitte der 1950er Jahre konnte dann der Handel zwischen der BRD und der VR China intensiviert werden. Bis 1960 waren signifikante Steigerungen der Handelsvolumina in beide Richtungen, Import und Export, zu verzeichnen (Ratenhof 1987: 555-556). Dennoch kam es vorerst zu keiner diplomatischen Anerkennung Pekings durch Bonn (Ratenhof 1987: 556). Durch den Botschafteraustausch zwischen Frankreich und der VR China kam nochmals Bewegung in diese Angelegenheit, jedoch waren der BRD mit Rücksicht auf den Partner USA hier die Hände gebunden, auch wenn vielleicht hier bereits der Wunsch nach mehr Austausch schon existiert hatte, aber noch nicht offen kommuniziert werden konnte bzw. durfte (ebd.).
Ungeachtet der Wirren der ,Kulturrevolution‘ in China, der Blockbildung im Kalten Krieg und einer damit einhergehenden Verkomplizierung der internationalen Konstellationen konnte die deutsche Wirtschaft 1967 den Gesamthandel mit China auf über 1 Milliarde D-Mark anheben (Ratenhof 1987: 557).
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges musste sich im Bereich der kulturellen Beziehungen die Sinologie in Deutschland konsolidieren:
Die Sinologie in Deutschland hat nur langsam die Verluste aufholen können, die ihr durch den Krieg personell und materiell entstanden waren. Die Zeitschriften Sinica, Ostasiatische Zeitschrift und Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen bestehen seit Anfang der 40er Jahre nicht mehr; die international führende Asia Major mußte 1935 ihr Erscheinen einstellen und wird seit 1948 in London weitergeführt. Als Fachzeitschrift für die gesamte Ostasienwissenschaft erscheint seit 1954 Oriens Extremus, seit 1951 die Nachrichten der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Asiens. Durch Kriegsereignisse gingen die Seminarbibliotheken von Berlin, Leipzig, Göttingen und Frankfurt verloren; die reichen chinesischen Bestände der Preußischen Staatsbibliothek verteilten sich nach 1945 auf mehrere Besatzungszonen. Sinologische Lehrstühle gab es 1945 nur in Hamburg, Berlin und Leipzig. Zu ihnen trat 1946 die schon lange geplant gewesene Professur in München. (Franke 1974: Sp. 1234)
Seit 1960 forcierte die Politik auf Empfehlung des Wissenschaftsrates eine wesentliche Ausweitung der akademischen Sinologie (Franke 1974: Sp. 1234-1235). Mit Blick auf die später wieder intensivierten Wirtschafts- und Kulturbeziehungen (vgl. 2.5. und 2.6. unten) stellte sich diese Weichenstellung aus heutiger Sicht günstig dar und bereitete den Boden für den heute sehr regen Austausch zwischen Deutschland und China.
Eine politische Annäherung von Deutschland und China begann in den 1970er Jahren unter der Ägide der sozial-liberalen Koalition in Bonn:
Weit intensiver, als es jemals zuvor eine Regierung in Bonn getan hatte, widmete sich schließlich die SPD/FDP-Koalitionsregierung China, wenn auch zunächst äußerst behutsam und ohne größere Erfolge: Bonn wollte unter allen Umständen eine Gefährdung seiner neuen Ostpolitik vermeiden – Moskau besaß absolute Priorität –, und Peking warb weiterhin um Ostberlin. […] Erst im Zuge der amerikanisch-chinesischen Entspannung kam es dann zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Peking (10. Oktober 1972).1 Ein offizielles Handelsabkommen folgte wenig später (5. Juli 1973), ergänzt durch eine Vereinbarung über Zivilluftfahrt und Seeverkehr (Oktober 1975). Als besonders vorteilhaft erwies es sich dabei für die Bundesregierung, daß Bonn Taiwan nicht anerkannt hatte und lediglich kulturelle und wirtschaftliche Kontakte dorthin unterhielt […]. (Ratenhof 1987: 557)
Taiwan war bis dahin ein vom Volumen her viel größerer Wirtschaftspartner der BRD gewesen als die VR China. Durch die neuen Vereinbarungen änderte sich dies jedoch sehr schnell zugunsten Chinas. (Ratenhof 1987: 557-558)
2.5. Öffnungspolitik
Im vorliegenden Abschnitt folgen wir der Darstellung der deutsch-chinesischen Beziehungen bei Huang (2019; Kap. 3.1.2.). Deutsche Politiker, beginnend mit Franz Josef Strauß (CSU) 1975, begannen China zu besuchen und schlugen somit ein neues Kapitel der Annäherung auf. Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) wurde im Oktober 1975 von Mao Zedong in Peking empfangen (Huang 2019: 39). Im Dezember 1978 verkündete China die offizielle Reform- und Öffnungspolitik; „[d]anach fanden regelmäßige hochrangige Staatsbesuche zwischen Bonn und Peking“ (ebd.) statt. Diese dienten einer Annäherung beider Seiten, allmählich adjustierte die Volksrepublik China gewisse Aspekte ihres politischen Systems:
Nach dem Tod von Mao Zedong 1976 regierte sein Nachfolger Deng Xiaoping China, der die politische Priorität auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes setzte. Ohne ideologische Scheuklappen sprach Deng aus: „Egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache, sie fängt Mäuse“ (Der Spiegel, 1997, S. 156). Zum Zeichen der Kurswende der chinesischen Regierung unter der Führung von Deng Xiaoping wurde die kapitalistische Marktwirtschaft anstelle der sozialistischen Planwirtschaft eingeführt. Die Ideologisierung der chinesischen Außenpolitik wurde allmählich durch eine Ökonomisierung abgelöst. Die seit 1978 bestehende Reform- und Öffnungspolitik Chinas hat die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit angestoßen, die zu einer Markterschließung nach internationalem Standard führte. Ein Jahr darauf riefen beide Regierungen durch ein Abkommen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit einen gemeinsamen Ausschuss für wirtschaftliche Kooperation auf ministerieller Ebene ins Leben (Hederer, 2015). Von 1979 bis 1989 vervierfachte sich das Volumen des bilateralen Außenhandels von 2,7 auf 10,4 Mrd. DM (Runge, 2003, S. 68). (Huang 2019: 39)
Die Bundesrepublik Deutschland und China unterzeichneten sukzessive weitere Abkommen, so zur Kooperation im Bereich der Technologie (1982) sowie im Finanzwesen (1985) (Huang 2019: 39).1 Seit 1982 hatte die BRD in diesen beiden Bereichen Entwicklungshilfe geleistet, die sich nachhaltig positiv auswirkte (Huang 2019: 39-40). „Seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen nach den 1980er-Jahren [sic] hat die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit an Gewicht gewonnen, welche auch heute noch den wichtigsten Aspekt im Verhältnis der Bundesrepublik und der VR China darstellt.“ (Huang 2019: 40) Dahingegen wurde weniger Kooperation im Bereich der Kultur angestoßen:
Im Vergleich zu den diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen waren die bilateralen kulturellen Beziehungen nicht sehr auffällig. Im Oktober 1978 unterzeichneten beide Seiten ein Abkommen über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit. Im kulturellen Bereich wurde ein Kooperationsabkommen über den kulturellen Austausch zwischen den beiden Staaten im Jahr 1979 abgeschlossen. Im Juni 1988 vereinbarten die deutsche und die chinesische Regierung die Einrichtung einer Zweigstelle des Goethe-Instituts in China (Bundesgesetzblatt im Jahrgang 1988), welches damals die einzige ausländische Kultureinrichtung in China war. (Huang 2019: 40)
Politisch beschäftigte Mitte der 1980er Jahre die Tibet-Frage, die durch die neu gegründete grüne Partei im deutschen Bundestag thematisiert wurde, die deutsche Politik und erschwerte punktuell die deutsch-chinesischen Beziehungen. Seit der Niederschlagung der chinesischen Studentenbewegung 1989 sind die Menschenrechte dauerhaft Teil der deutschen Chinapolitik (Huang 2019: 41) und geben immer wieder Anlass zu Störungen der diplomatischen ansonsten zumeist guten Beziehungen.
Wie weiter oben (2.4.) erwähnt, hatte es bereits seit 1949 diplomatische Beziehungen zwischen der DDR und der VR China gegeben. Diese wurden nachhaltig durch den Bruch der VR China mit der Sowjetunion verschlechtert (von 1960 bis 1979; Huang 2019: 41). Die Konstellation hatte jedoch keine Auswirkungen auf die diplomatischen Kontakte Westdeutschlands nach China (ebd.).
Huang (2019: 41-42) zieht folgendes Fazit der Entwicklungen:
Ein entscheidendes Motiv für die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der VR China waren zum einen die wirtschaftlichen Interessen. […] Durch die Aufnahme der bilateralen diplomatischen Beziehungen konnte China als ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat zumindest den geplanten Beitritt der beiden deutschen Staaten nicht blockieren (Leutner, 1995, S. 141). […] Im Vergleich zu der Bundesrepublik konnte die VR China mehr von der Normalisierung der bilateralen Beziehungen profitieren. Was die Motive und Interessen der chinesischen außenpolitischen Ausrichtung nach Westen angeht, hatten China und der Westen eine gemeinsame Bedrohung vonseiten der Sowjetunion. Aufgrund der Spannung mit Moskau betrachtete China die Sowjetunion als einen gemeinsamen Gegner mit dem Westen. Weil die Bundesrepublik unter militärisch-strategischen Aspekten als NATO-Frontstaat die größte Armee in Westeuropa hatte, galt sie für China als ein strategischer Partner. Im Grunde genommen wurde China vom Westen offensichtlich als ein strategisches Gegengewicht gegenüber der Sowjetunion gezielt aufgewertet (Heilmann, 2002, S. 1). Außerdem hoffte die chinesische Regierung auf die Unterstützung der Bundesrepublik bei der Modernisierung Chinas. Aus militärisch-strategischen und wirtschaftlichen Interessen näherten sich die beiden aneinander an. […] Gegensätzlich zu anderen westlichen Staaten hat die Bundesrepublik auf eine Anerkennung Taiwans verzichtet und die Volksrepublik China als ausdrücklich einzige legale Regierung Chinas anerkannt. Die Zurückhaltung in der Taiwan-Frage der zwei deutschen Regierungen [sic] und die Unterstützung der Wiedervereinigung Deutschlands aus der VR China trugen dazu bei, die deutsch-chinesischen Beziehungen nach der Wiedervereinigung ohne historische Belastung im Allgemeinen weiter zu entwickeln. Obwohl die VR China jeweils mit der Bundesrepublik und der DDR diplomatische Beziehungen aufnahm, sprach sie sich gegen eine dauerhafte Teilung der deutschen Nationen aus. […] Die Bundesrepublik und China befanden sich während des Ost-West-Konflikts auf unterschiedlichen Polen. Das offensive Demokratieverständnis des Westens und die ungelösten Legitimationsprobleme des politischen Systems in China sorgten immer wieder für Spannungen zwischen Deutschland und China (Maull, 2014, S. 852). Dies hatte zur Folge, dass sich die sino-sowjetischen Beziehungen auch auf die bundesdeutsche Chinapolitik auswirkten. Mit anderen Worten war die Chinapolitik der Bundesrepublik stark von den Gegebenheiten des Ost-West-Konflikts geprägt. (Huang 2019: 41-42)
Huang (2019) betrachtet sukzessive die Entwicklungen der deutsch-chinesischen Beziehungen im Lichte der Chinapolitik der Bundesregierung bis in die neueste Zeit: Er trennt dabei nach Kanzlerschaften, d.h. Kohl (Huang 2019, Kap. 4: 53-91), Schröder (Huang 2019, Kap. 5: 93-139) sowie Merkel (Huang 2019, Kap. 6: 141-233).
Eine genauere Nachzeichnung dieser Linien ist im Kontext der vorliegenden Studie aus Umfangsgründen nicht möglich; Interessierte seien daher auf die genannte Literatur verwiesen. Abschließend für das vorliegende Kapitel werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der Germanistik und der Beschäftigung mit der deutschen Sprache in China.
2.6. Exkurs: Deutsche Sprache und Germanistik in China
Die Geschichte von Deutsch als Fremdsprache in China reicht bis in das Jahr 1871 zurück. Mit dem Ziel, Dolmetscher für den diplomatischen Dienst auszubilden, wurde Deutsch in den Fächerkanon der im Jahre 1862 gegründeten kaiserlichen Pekinger Fremdsprachenhochschule (Tongwenguan) integriert. Dort lehrte man die deutsche Sprache [..] eng verknüpft mit anwendungsorientierten Fächern aus den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Jura und Ökonomie. (Hernig 2010: 1637)
Auf der Agenda der Kolonialmächte, die im 19. Jahrhundert in China aktiv wurden, stand neben der Übernahme von Gebieten auch eine Modernisierung orientiert „an den westlichen Industriemächten“ (Reinbothe 2007d: 13): „Von zentraler Bedeutung bei diesen Modernisierungsplänen war, dass Chinesen das überlegene Wissen des Westens sich aneigneten und die westlichen Sprachen erlernten, die den Zugang zu diesem Wissen eröffnen konnten.“ (Reinbothe 2007d: 13; vgl. auch Reinbothe 1992, v. a. 19-55) Zu diesen Sprachen gehörte natürlich auch das Deutsche, das nach dem Sieg Deutschlands gegen Frankreich 1871 stärker in den Blick der Chinesen geriet (für eine Geschichte der Germanistik in China vgl. Hernig 2000):
[D]ie deutsche Sprache gewann in China erst an Gewicht, als nach dem Sieg über Frankreich 1871 Deutschland von Chinesen als starke Militärmacht geschätzt wurde, deren Techniken man sich zunutze machen wollte. […] Für die Waffengeschäfte, militärischen Projekte und Schulen brauchte man ebenfalls chinesische Dolmetscher, die Deutsch konnten. Deshalb wurden an den Militärschulen in begrenztem Umfang Deutschkurse abgehalten. […] Von einem deutschsprachigen Fachunterricht war man […] noch meilenweit entfernt. (Reinbothe 2007d: 15-16)
Im Rahmen der Reformen, denen China im ausgehenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterworfen war, kam v. a. eine gewichtige Weichenstellung hinzu, die die Entwicklung einer verbesserten Position des Deutschen wie aller anderen westlichen Fremdsprachen begünstigte:
Eine entscheidende Wende trat jedoch erst ein, als 1905 die traditionellen staatlichen Beamtenprüfungen abgeschafft wurden, die ganz auf der konfuzianischen Bildung aufgebaut waren und das chinesische Bildungssystem bis dahin beherrscht hatten. […] Erst dadurch, dass man das Studium der europäischen Wissenschaft und Sprachen in das staatliche Prüfungssystem integrierte, wurden diese erheblich aufgewertet und der Weg für die Heranbildung einer chinesischen Elite freigemacht, die ihre Ausbildung an modernen Schulen und Hochschulen in China und im Ausland erworben hatte. […] Jedenfalls wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in China ein Netz moderner Schulen (Elementar- und Mittelschulen) und Hochschulen aufgebaut, an deren Spitze die 1898 gegründete zentrale Universität Peking (Beida) stand. Nachdem ihr 1903 die alte Fremdsprachenschule Tongwen Guan angegliedert worden war, hatte sie bald acht Abteilungen: Chinesische Klassik, Politik und Recht, Literatur und Sprachen (Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Deutsch, Japanisch), Naturwissenschaften, Medizin, Landwirtschaft, Technik und Industrie sowie Handel[.] (Reinbothe 2007d: 18; vgl. Reinbothe 1992: 42-45)