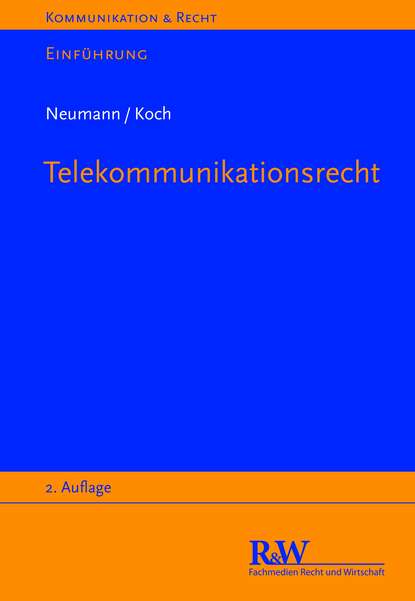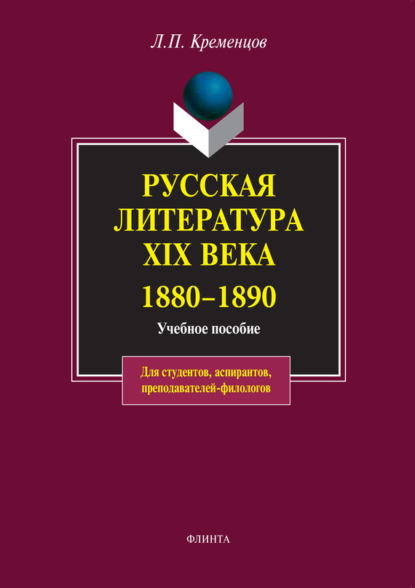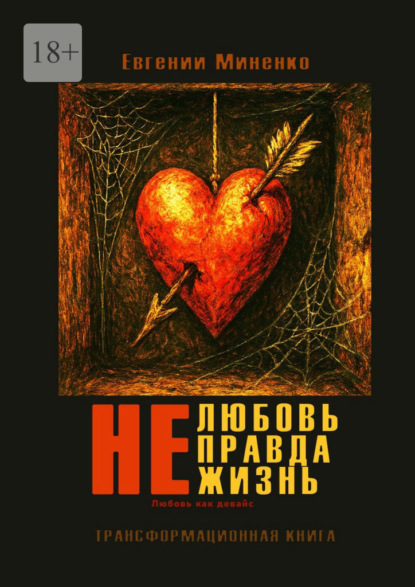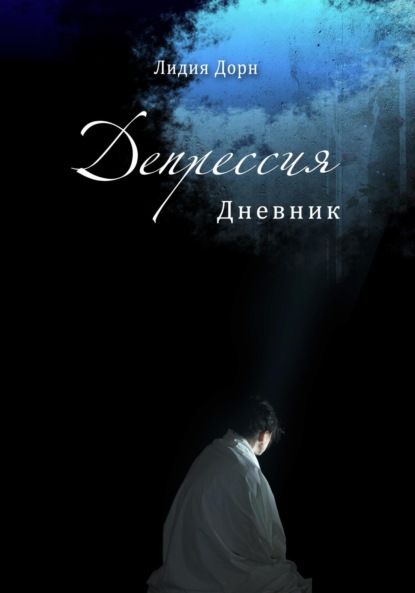Recht im E-Commerce und Internet

- -
- 100%
- +
116
Diese Rechtsfolge kann vermieden werden, wenn der Anfechtende ein Verbraucher ist, ein Widerrufsrecht gem. §§ 312g Abs. 1, 355 BGB besteht und innerhalb der Widerrufsfrist widerrufen wird, statt die Anfechtung zu erklären. Dabei ist zu beachten, dass sich die Frist des dem Verbraucher zustehenden Widerrufsrechtes auf zwölf Monate und 14 Tage verlängert, sofern der Unternehmer nicht oder nicht ordnungsgemäß entsprechend den Anforderungen des Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EGBGB über das Widerrufsrecht informiert hat (§ 356 Abs. 3 S. 2 BGB).160
5. Anfechtung bei Fernabsatzverträgen
117
In der Praxis steht die Anfechtung eines über das Internet geschlossenen Vertrags in aller Regel nicht im Vordergrund, weil für Verträge, die Verbraucher (§ 13 BGB) abschließen, die Regelungen über Fernabsatzverträge gem. §§ 312c ff. BGB einschlägig sind. Ist dies der Fall, besteht ein Widerrufsrecht gem. §§ 312g Abs. 1, 355 BGB, sodass in den genannten Irrtumsfällen keine Notwendigkeit besteht, hier den Vertrag anzufechten. Wenn man den Vertrag widerrufen kann und er infolgedessen rückabgewickelt wird, besteht keine Veranlassung zur Anfechtung, weil das Widerrufsrecht an keinen besonderen Grund geknüpft ist und auch keine Schadensersatzansprüche auslöst.161
118
Nur in Einzelfällen muss auf die Regelungen des Anfechtungsrechtes zurückgegriffen werden. Denkbar sind verschiedene Konstellationen:
1. Die Regelungen über Fernabsatzverträge gem. §§ 312c ff. BGB sind nicht einschlägig, weil es sich etwa um ein B2B-Geschäft handelt.
2. Die Regelungen sind zwar einschlägig, jedoch besteht kein Widerrufsrecht gem. § 312g Abs. 2 BGB, so z.B. bei individuell angefertigten Waren oder dann, wenn das Widerrufsrecht gem. § 356 Abs. 4 S. 1 BGB erloschen ist, weil bei einer Dienstleistung der Unternehmer diese vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert.
3. Es liegt ein Anfechtungsgrund nach § 123 BGB vor. Dieser berechtigt einen Vertragspartner, ein Rechtsgeschäft anzufechten, wenn es durch arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung zu Stande gekommen ist. Bei diesem Anfechtungsgrund besteht eine Anfechtungsfrist von einem Jahr.
119
Wird hingegen die Widerrufsfrist nach den Regelungen über Fernabsatzverträge versäumt, so kann nur dann noch nach § 119 Abs. 1 BGB angefochten werden, wenn die Anfechtung „unverzüglich“, d.h. ohne schuldhaftes Zögern erfolgt. Bei Versäumung der Widerrufsfrist ist diese Voraussetzung bei Warenlieferungen in den meisten Fällen nicht mehr gegeben, weil man spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung den Irrtum erkennt. Wird dann noch bis zum Ablauf der Widerrufsfrist mit der Anfechtungserklärung gewartet, so erfolgt die Anfechtung nicht mehr „unverzüglich“.
120
Handelt es sich hingegen um Verträge, die einen Verbrauchsgüterkauf zum Gegenstand haben, der auf die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum gerichtet ist oder um Verträge, die eine nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, die Lieferung von Fernwärme oder die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten zum Gegenstand haben, so sind Fälle denkbar, in denen der Irrtum erst nach Ablauf der Widerrufsfrist erkannt wird, weil bei diesen Vertragstypen die Widerrufsfrist schon mit Vertragsschluss bzw. dem Erhalt der ersten Ware (§ 356 Abs. 2 Nr. 1 lit. d sowie Nr. 2 BGB) beginnen kann. Beginnt die Widerrufsfrist bereits zu diesem Zeitpunkt, so ist der Irrtum möglicherweise erst dann offensichtlich, wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Zu beachten ist dabei aber, dass das Mängelgewährleistungsrecht nach der Leistungserbringung grundsätzlich Vorrang hat, insbesondere ein auf Mängeln begründeter Eigenschaftsirrtum über die Kaufsache i.S.d. § 119 Abs. 2 BGB verdrängt wird.
121
Grundsätzlich sind Irrtumsanfechtungen nicht nur seitens des Käufers möglich; auch der Verkäufer kann sich bei der Abgabe seiner auf den Vertragsschluss gerichteten Willenserklärung über wesentlichen Inhalt seiner Erklärung geirrt haben. Wird etwa in einem Internetshop ein falscher Preis eingegeben (199,00 € anstatt 1.999,00 €), kann nach § 119 Abs. 1, 2. Alt. BGB angefochten werden. Wird aber nach Kenntniserlangung über das Auseinanderfallen von äußerem Erklärungswillen und innerem Geschäftswillen auf der die fehlerhafte Preisangabe enthaltenen Produktbeschreibung ein Angebot eines Kunden mit der fehlerhaften Preisangabe einen Tag später bestätigt, so liegt schon kein bei Abgabe der Willenserklärung vorhandener Irrtum mehr vor. Ein Überschreiten der Anfechtungsfrist nach § 121 BGB braucht dann gar nicht mehr geprüft zu werden.162
148 Dazu Glossner, in: Leupold/Glossner, MAH IT-Recht, 2013, Teil 2, Rn. 52ff.; Koitz, Informatikrecht, 2002, S. 24ff.; Pierson/Seiler, JurPC Web-Dok. 217/2003, Abs. 1, Abs. 25ff. 149 Diesbezüglich keine Unterscheidung machend Kitz, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Multimedia-Recht, 2021, Rn. 275f.; ebenso nicht Dörner, in: Schulze, BGB, 10. Aufl. 2019, § 119 Rn. 13; zu Recht, wenn auch nur in der Fußnote auf eine analoge Anwendung hinweisend Feuerbach, in: NK-BGB, 3. Aufl. 2016, § 119 Rn. 33 Fn. 99; korrekt auch Spindler, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2019, BGB, §§ 119, 120 Rn. 12. 150 Vgl. hierzu OLG Nürnberg, Urt. v. 9.10.2002 – 12 U 1346/02, CR 2003, 769; Ellenberger, in: Palandt, BGB, 2021, § 119 Rn. 10. 151 Ellenberger, in: Palandt, BGB, 2021, § 119 Rn. 32. Zur Irrtumsanfechtung des Anbieters auch AG Fürth, Urt. v. 8.10.2009 – 360 C 2779/08 (unveröffentlicht), und AG Fürth, Urt. v. 30.7.2008 – 340 C 1198/08 (unveröffentlicht). 152 Vgl. Kitz, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Multimedia-Recht, 2021, Kap. 13.1, Rn. 260f.; BGH, Urt. v. 28.2.2002 – I ZR 318/99, WRP 2002, 839; OLG Düsseldorf, Urt. v. 9.2.2016 – I-21 U 100/15, BeckRS 2016, 115264, Rn. 50f. 153 Vgl. Hoffmann, Beilage zu NJW 2001, Heft 14, 1, 9; LG Köln, Urt. v. 16.4.2003 – 9 S 289/02, MMR 2003, 481 m. Anm. Mankowski, EWiR 2003, 853; BGH, Urt. v. 26.1.2005 – VIII ZR 79/04, K&R 2005, 176. 154 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 20.11.2002 – 9 U 94/02, EWiR 2003, 953. 155 Vgl. Hoffmann, Beilage zu NJW 2001, Heft 14, 1, 9. 156 BGH, Urt. v. 7.7.1998 – X ZR 17/97, NJW 1998, 3192; Spindler, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2019, BGB, §§ 119, 120 Rn. 10. 157 BGH, Urt. v. 26.1.2005 – VIII ZR 79/04, K&R 2005, 176. 158 OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.5.2016 – I-16 U 72/15, MMR 2016, 593. 159 Vgl. Begründung zum Regierungsentwurf Schuldrechtsmodernisierung, BT-Drs. 14/6040, S. 400; Spindler, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2019, BGB, §§ 119, 120 Rn. 13. 160 Vgl. Dörner, AcP 202 (2002), 363, 381; Grüneberg, in: Palandt, BGB, 2021, § 356 Rn. 8; Ring, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB, 2021, § 356 Rn. 24. 161 Ausführlich zum Widerrufsrecht Kap. 5. 162 AG Fürth, Urt. v. 8.10.2009 – 360 C 2779/08 (unveröffentlicht), und AG Fürth, Urt. v. 30.7.2008 – 340 C 1198/08, K&R 2008, 770.
VII. Haftung für Handeln Dritter bei Missbrauch
von Zugangsdaten
122
Nutzt ein Dritter fremde Zugangsdaten und führt so einen Vertragsschluss im Internet herbei, ist zu betrachten, wer durch diese Handlung vertraglich gebunden ist und damit haftbar gemacht werden kann. Zum einen kommt der Dritte in Betracht, aber auch eine Haftung des Inhabers der Zugangsdaten scheint nicht ausgeschlossen.
123
Werden fremde Zugangsdaten ohne Bevollmächtigung genutzt und mithilfe dieser ein Vertragsschluss herbeigeführt, so erweckt der Dritte für den Rechtsverkehr den Anschein, der Inhaber der Zugangsdaten habe sich vertraglich binden wollen. Der Dritte gibt keine Erklärung für einen anderen ab, sondern tritt bewusst mit einem falschen Namen auf. Eine solche Erklärung, die den Anschein eines Eigengeschäfts hervorruft, ist nach den Regeln für die Stellvertretung gem. §§ 164ff. BGB in entsprechender Anwendung zu beurteilen.163 Etwas anderes kann dann gelten, wenn die verwendeten Zugangsdaten und die damit verbundene Täuschung für den Abschluss des Geschäfts irrelevant ist. Dies wird in Abgrenzung von der Identitätstäuschung als bloße Namenstäuschung bezeichnet. In diesem Fall kommt der Vertrag mit dem tatsächlich Handelnden zustande.164 Regelmäßig wird dies aber im E-Commerce nicht der Fall sein, weil der eine Vertragspartner auf die „Online-Identität“ des anderen vertraut.
1. Anscheinsvollmacht
124
Im Falle des Handelns unter fremdem Namen165 gilt es zunächst zu untersuchen, ob der Dritte im Rahmen einer sog. Rechtsscheinvollmacht gehandelt hat. Im Rahmen der Rechtsscheinvollmachten ist zwischen der Duldungs- und der Anscheinsvollmacht zu differenzieren. Während der Vertretene bei der Duldungsvollmacht in Kenntnis, dass ein anderer für ihn als Vertreter auftritt, ein solches Verhalten bewusst geschehen lässt, kommt es bei der Anscheinsvollmacht entscheidend darauf an, dass der Vertretene fahrlässig verkennt, dass er durch einen Scheinvertreter vertreten wird.166
125
So kann eine Haftung des Inhabers der Zugangsdaten zum einen dadurch zustande kommen, dass der Inhaber der Zugangsdaten Kenntnis von dem Handeln des Dritten hat, dieses duldet und der Geschäftspartner dieses Dulden dahingehend versteht, dass der Inhaber der Zugangsdaten als Vertragspartner gelten soll.167
126
Eine Haftung nach den Grundsätzen über die Anscheinsvollmacht kann hingegen dann in Frage kommen, wenn dem Inhaber der Zugangsdaten die Erklärung zugerechnet werden kann und das Verhalten des Dritten von gewisser Dauer und Häufigkeit ist.
2. Voraussetzungen für eine Zurechnung
127
Sodann stellt sich die Frage, wann eine Zurechnung des Verhaltens zulasten des Inhabers der Zugangsdaten anzunehmen ist. Eine Einstandspflicht des Inhabers der Zugangsdaten kann sich nur dann ergeben, wenn der Geschäftspartner schutzwürdiger als er selbst erscheint.168 Während eine Zurechnung der Erklärung des Dritten bei einer bewussten Weitergabe der Zugangsdaten immer anzunehmen ist, kann ein bloßer Fahrlässigkeitsvorwurf im Umgang mit den Zugangsdaten noch keine Zurechnung begründen.169 Es fehlt an einem zurechenbaren Rechtsschein immer dann, wenn die Zugangsdaten sorgfältig aufbewahrt werden oder auch, wenn ein nicht leicht zu erratendes Passwort verwendet wird.170 Im Einzelfall muss aber abgegrenzt werden, wann eine fahrlässige Aufbewahrung der Zugangsdaten einer bewussten Weitergabe gleichkommen könnte.171 So ist eine Zurechnung dann anzunehmen, wenn der Inhaber der Zugangsdaten dem Dritten ohne große Schwierigkeiten eine Zugangsmöglichkeit eröffnet und die Verwendung der Daten seitens des Dritten somit voraussehen kann oder den Missbrauch des Dritten erkennt und diesen weiter gewähren lässt.172
3. Abgrenzung zur Halzband-Entscheidung
128
Anders beurteilte der BGH die Voraussetzungen der Zurechnung eines Verhaltens in seiner „Halzband-Entscheidung“.173 Danach sei ein Verhalten dann zuzurechnen, wenn der Inhaber der Zugangsdaten diese bereits unsorgfältig aufbewahre. Grundsätzlich bestehe eine generelle Verantwortung des Inhabers von Zugangsdaten, seine Daten so aufzubewahren, dass die Möglichkeit der Kenntnisnahme Dritter ausgeschlossen ist. Anders als mit der Zurechnung fremder Willenserklärungen beschäftigte sich der BGH in dieser Entscheidung aber mit einer Unterlassungshaftung im Urheber- und Markenrecht. Dort thematisiert er als Grund für eine solche Verantwortlichkeit die ansonsten drohende Gefahr für den Rechtsverkehr, dass sich Unsicherheiten in Bezug auf den Vertragspartner und seine Inanspruchnahme, die rechtsgeschäftlich oder deliktisch ausgestaltet sein kann, ergeben. Auf die rechtsgeschäftliche Bindung durch einen Dritten sind diese Grundsätze allerdings nicht übertragbar.174
4. Folgen für das Online-Banking
129
Auch im Online-Banking konnte das Handeln Dritter nach den Grundsätzen der Anscheinsvollmacht bislang zugerechnet werden, da durch das PIN/TAN-Verfahren prinzipiell eine ausreichende Sicherheit der Daten bestand.175 Aufgrund der größeren Gefahren beim Online-Banking ist der Kunde in Bezug auf Speicherung und Aufbewahrung von PIN- und TAN-Nummern zu einer größeren Sorgfalt auch mithilfe eines Virenprogramms verpflichtet, sodass eine Kenntnisnahme von Dritten auszuschließen ist.176 Bei sog. Phishing-Attacken ist für den Nutzer des Online-Banking die missbräuchliche Verwendung seiner Daten hingegen auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht erkennbar, sodass eine Rechtsscheinhaftung dann nicht in Betracht gezogen werden kann.177
Fragen und Aufgaben
1. Wofür stehen die Abkürzungen B2B und B2C? Ist die Differenzierung für die Anwendung des Fernabsatzrechts bedeutsam?
2. Ist die Anfechtung eines über das Internet geschlossenen Vertrags möglich?
3. Ist es rechtlich relevant, ob ein Internetsurfer bei einem Mausklick das Bewusstsein hat, eine rechtserhebliche Erklärung abzugeben? Begründen Sie bitte Ihre Ansicht.
4. Handelt es sich bei Anpreisungen einer Ware oder Dienstleistung auf einer Internetseite um ein Angebot im Rechtssinne? Skizzieren Sie bitte Grundsätze und Ausnahmen.
5. Der Verkäufer eines Luxusautos hat sich bei der Eingabe des Startpreises auf einer Versteigerungsplattform vertippt, indem er statt 10.000 € nur 100 € für das Auto verlangt. Der Käufer des Autos hat den Wagen für 500 € gekauft. Wie ist die Rechtslage?
6. Wie ist die Rechtslage, wenn der Verkäufer 1.000 € als Startpreis in die Maske eingegeben hat, aufgrund eines unerkannten Softwarefehlers 100 € als Startpreis erscheint und ein Vertrag zum Preis von 500 € geschlossen wird?
7. Wie ist ein Angebot auf einer Auktionsplattform rechtlich zu bewerten, das unter der Rubrik „Sofortkauf“ eingestellt wurde?
8. Die Studentin A hat ihre Zugangsdaten für diverse Online-Verkaufsplattformen auf ihrem Schreibtisch unter ihrem Notebook liegen. Sie erlaubt regelmäßig ihrem Mitbewohner B, ihr Notebook zu nutzen und es mit in sein Zimmer zu nehmen. Ihr Mitbewohner bestellt ihr nun über ihren Account eine neue Winterjacke, weil er ihre Klagen über den kalten Winter nicht mehr hören kann. Muss die A diesen Mantel zahlen oder doch eher der B? Wovon hängt die Zahlungsverpflichtung ab?
163 BGH, Urt. v. 3.3.1966 – II ZR 18/64, BB 1966, 425. 164 Schubert, in: MüKo-BGB, 2018, § 164 Rn. 141, mit dem Beispiel eines unverbindlichen Spielvertrags nach § 762 BGB. 165 BGH, Urt. v. 11.5.2011 – VIII ZR 289/09, K&R 2011, 496. 166 BGH, Urt. v. 11.5.2011 – VIII ZR 289/09, K&R 2011, 496. 167 BGH, Urt. v. 11.5.2011 – VIII ZR 289/09, K&R 2011, 496. 168 BGH, Urt. v. 11.5.2011 – VIII ZR 289/09, K&R 2011, 496. 169 BGH, Urt. v. 11.5.2011 – VIII ZR 289/09, K&R 2011, 496; Borges, NJW 2011, 2400. 170 Spindler, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2019, BGB, § 164 Rn. 10. 171 Borges, NJW 2011, 2400. 172 Borges, NJW 2011, 2400. 173 BGH, Urt. v. 11.3.2009 – I ZR 114/06, K&R 2009, 401. Siehe dazu auch Hecht, K&R 2009, 462. 174 Borges, NJW 2011, 2400. 175 Spindler, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2019, BGB, § 164 Rn. 10. 176 Kind/Werner, CR 2006, 353. 177 Kind/Werner, CR 2006, 353.
Kapitel 3
Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Übersicht
Rn.I. Anwendungsbereich, § 310 BGB21. Eingeschränkte Kontrolle von AGB bei B2B-Verträgen32. Eingeschränkte Kontrolle in der Grundversorgung4II. Vorliegen von AGB, § 305 Abs. 1 S. 1 und 3 BGB51. Vorformulierte Vertragsbedingung62. Absicht mehrfacher Verwendung73. Stellen der AGB durch Verwender8III. Einbeziehung von AGB in den Vertrag101. Allgemeine Bedingungen für die Einbeziehung von AGB112. Bereitstellung in speicherbarem und druckfähigem Format133. Besonderheiten im M-Commerce144. Sprache der AGB155. Einverständnis mit Geltung der AGB176. Geltung überkreuzter AGB187. Vorrang der Individualabrede198. Verbot überraschender Klauseln21IV. Verwenderfeindliche Auslegung von AGB23V. Inhaltskontrolle von AGB251. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit272. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit303. Allgemeine Inhaltskontrolle nach § 307 BGB32a) Abweichung von Grundgedanken der gesetzlichen Regelung33b) Gefährdung der Erreichung des Vertragszwecks36c) AGB-rechtliche Generalklausel38d) Intransparente Klauseln39e) Unwirksamkeit unangemessen benachteiligender Klauseln41VI. Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen AGB-Vorschriften43VII. Prozessuales451
Zur Vereinfachung und Standardisierung von Internet-Verträgen sind Anbieter von Waren oder Dienstleistungen bestrebt, diesen Allgemeine Geschäftsbedingungen (kurz „AGB“) zugrunde zu legen. Zum Schutz des jeweiligen Verwendungsgegners hat der Bundesgesetzgeber bereits 1977 im eigens dafür geschaffenen „Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB-Gesetz oder kurz „AGBG“) besondere Schutzmechanismen geschaffen, um dem Umstand einer wirtschaftlichen Irrationalität des Überprüfungsaufwands von AGB im Geschäftsverkehr einerseits und dem oft bestehenden wirtschaftlichen Ungleichgewicht zwischen Verwender und Verwendungsgegner andererseits durch eine verschärfte Kontrolle der AGB Rechnung zu tragen. Die Vorschriften aus dem AGBG werden unter Modifikation insbesondere im Hinblick auf das Verbraucherrecht seit dem 1.1.2002 in den §§ 305 bis 310 BGB weitergeführt.
I. Anwendungsbereich, § 310 BGB
2
Der Anwendungsbereich der AGB-rechtlichen Vorschriften richtet sich auch im Internet und E-Commerce nach § 310 BGB. Die § 305ff. BGB finden Anwendung, soweit sich aus den dort niedergelegten Grenzen nichts anderes ergibt.1
1. Eingeschränkte Kontrolle von AGB bei B2B-Verträgen
3
Die AGB-Kontrolle unterliegt im unternehmerischen Verkehr (B2B) erheblichen Restriktionen durch § 310 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB. Nach § 310 Abs. 1 S. 1 BGB finden die §§ 305 Abs. 2 und 3, 308 Nr. 1, 2 bis 8 und 309 BGB im unternehmerischen Verkehr keine Anwendung. Allerdings eröffnet § 310 Abs. 1 S. 2 BGB die Möglichkeit einer Beachtung der § 308f. BGB unter dem Blickwinkel des § 307 Abs. 1 und Abs. 2 BGB. Dabei sollen die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten berücksichtigt werden. Der BGH spricht jedenfalls in Bezug auf die Klauselverbote des § 309 BGB regelmäßig von einer Indizwirkung.2 Dies hat in der Praxis allerdings zur Konsequenz, dass häufig bei einem Verstoß gegen die §§ 308, 309 BGB die Unwirksamkeit der Klauseln herbeigeführt wird.3 Höchst selten wird eine anerkannte Praxis im unternehmerischen Verkehr den Fällen der §§ 308f. BGB zuwiderlaufen.4
2. Eingeschränkte Kontrolle in der Grundversorgung
4
Weiterhin sind nach § 310 Abs. 2 S. 1, 2 BGB Verträge der Wasser-, Energie- und Wärmeversorgung sowie der Abwasserentsorgung von den Beschränkungen der §§ 308 und 309 BGB teilweise ausgenommen. Hintergrund sind die diesbezüglich geschaffenen gesetzlichen Grundlagen, welche eine hinreichende Berücksichtigung der Interessen des Verwendungsgegners der AGB gewährleisten.5 Nur dann, wenn die AGB des Versorgers von diesen gesetzlichen Vorgaben abweichen, kommt eine AGB-Kontrolle in Betracht.
1 Weitere Einschränkungen ergeben sich aus § 310 Abs. 4 BGB; für dieses Buch nicht von Bedeutung. 2 Mittlerweile erstreckt der BGH im unternehmerischen Verkehr die Indizwirkung auch auf § 307 Abs. 2 BGB, vgl. BGH, Urt. v. 4.7.2017 – XI ZR 562/15, NJW 2017, 2986, 2989. 3 Schuster, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2019, BGB, § 310 Rn. 7. 4 So aber etwa bei § 309 Nr. 9 lit. a BGB, der eine reine verbraucherspezifische Schutzregelung darstelle, BGH, Urt. v. 8.12.2011 – VII ZR 111/11, NJW-RR 2012, 626, 627; OLG Stuttgart, Urt. v. 7.12.2016 – 3 U 105/16, BeckRS 2016, 121372 Rn. 29. 5 BT-Drs. 14/6040, S. 160.
II. Vorliegen von AGB, § 305 Abs. 1 S. 1 und 3 BGB
5
Ob AGB vorliegen, beurteilt sich nach §§ 305 Abs. 1 S. 1 und 3 BGB. Demnach sind AGB für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die der Verwender der anderen Vertragspartei stellt und die nicht im Einzelnen ausgehandelt sind.
1. Vorformulierte Vertragsbedingung
6
Vorformuliert sind Vertragsbedingungen, wenn sie durch eine Partei vor Abschluss des Vertrags bereits vollständig konzipiert sind.6 Auf die Art und Weise der vorausgegangenen Konzeption kommt es nicht an. Sie müssen weder vorher einsehbar sein noch textuell vorliegen.7 Typischerweise ist dies aber im Bereich des E-Commerce ohnehin der Fall, wenn die AGB auf den Websites der Anbieter oder deren Präsenzen in sozialen Netzwerken abrufbar sind.
2. Absicht mehrfacher Verwendung
7
Die AGB sind auf eine Vielzahl von Verträgen ausgelegt, wenn der Verwender beabsichtigt, die AGB mindestens drei Mal gegenüber seinen Vertragspartnern zu nutzen.8 Ob es zu dieser Mehrfachverwendung kommt, ist unerheblich. Im Verbraucherrecht liegen hingegen AGB bereits dann vor, wenn sie durch den Unternehmer überhaupt gegen einen Verbraucher verwendet werden, § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB. Auf diesem Gebiet verliert das Kriterium der mehrfachen Verwendungsabsicht seine Bedeutung als Abgrenzungsmerkmal zwischen AGB einerseits und Individualvertrag andererseits.
3. Stellen der AGB durch Verwender
8
Die AGB werden gestellt, wenn sie einseitig durch den Verwender eingebracht werden. Das Merkmal geht Hand in Hand mit der Frage, ob die Klauseln im Einzelnen ausgehandelt i.S.d. § 305 Abs. 1 S. 3 BGB sind. Im Einzelnen ausgehandelt werden Vertragsbedingungen dann, wenn der gesetzesfremde Kern der Vertragsbedingung ernsthaft zur Disposition gestellt wird.9 Erforderlich ist also, dass die einzelne AGB-Klausel durch den Verwendungsgegner auch vollständig hätten abgelehnt werden können.
9
Dies erscheint insoweit kongruent, als dass dadurch eine Gleichstellung mit einer Individualvereinbarung gewährleistet ist und folglich der Schutz des AGB-Rechts nicht eröffnet zu werden braucht. Andererseits führt dies in der Praxis dazu, dass selbst Vertragswerke, die zwischen Unternehmen über Monate oder Jahre ausgehandelt werden, trotzdem der AGB-Kontrolle unterliegen, weil die einzelnen Klauseln oft für die Vertragspartner nicht zur Debatte standen, letztlich der Kompromiss also nicht innerhalb der einzelnen Klausel, sondern durch die wechselseitige Anerkennung verschiedener Klauseln zustande kommt, was aber nach derzeitigem Stand der Rechtsprechung nicht ausreichend ist.10 Für den E-Commerce heißt das, dass Klauseln praktisch nie einzeln ausgehandelt sein können. Die ohnehin realitätsferne Möglichkeit der Auswahl zwischen verschiedenen AGB ist jedenfalls nicht ausreichend.11
6 Basedow, in: MüKo-BGB, 2019, § 305 Rn. 13. 7 Zum Phänomen der „AGB aus dem Kopf“ erstmals BGH, Urt. v. 30.9.1987 – IVa ZR 6/86, NJW 1988, 410. 8 Basedow, in: MüKo-BGB, 2019, § 305 Rn. 17. 9 Zuletzt BGH, Beschl. v. 19.3.2019 – XI ZR 9/18, NJW 2019, 2080, 2081. 10 „Aushandeln bedeutet mehr als Verhandeln“ – zuletzt BGH, Beschl. v. 19.3.2019 – XI ZR 9/18, NJW 2019, 2080, 2081. 11 BGH, Urt. v. 3.12.1991 – XI ZR 77/91, BB 1992, 169; BGH, Urt. v. 7.2.1996 – IV ZR 16/95, BB 1996, 611.