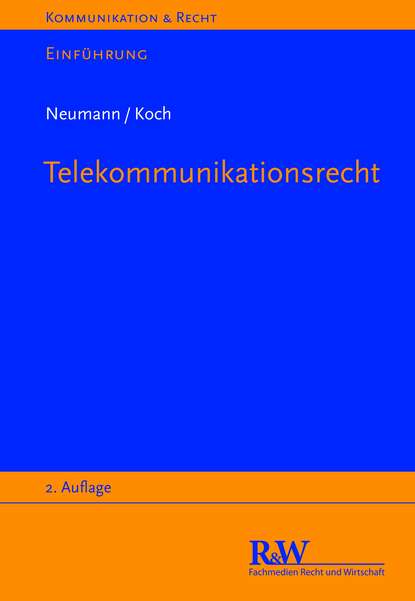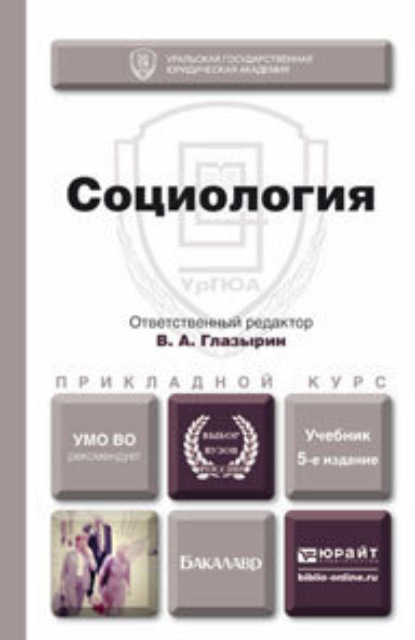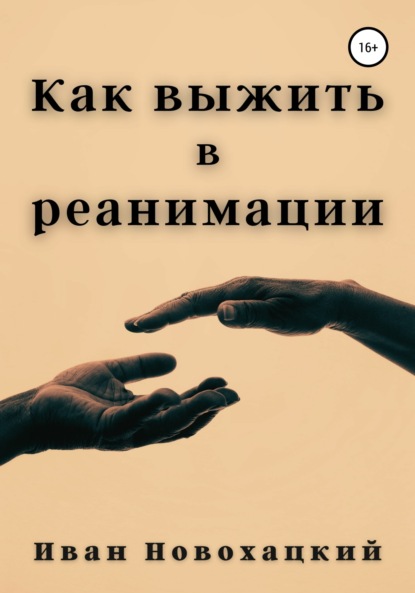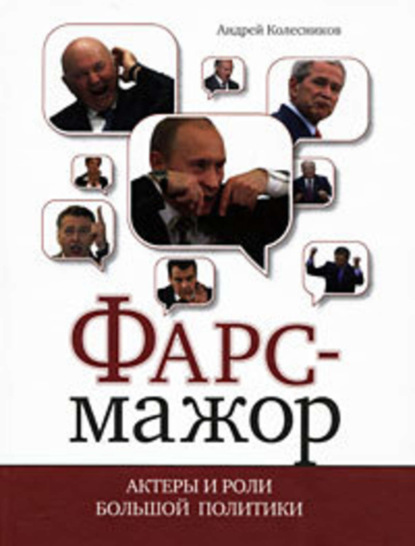Recht im E-Commerce und Internet

- -
- 100%
- +
III. Einbeziehung von AGB in den Vertrag
10
Die AGB müssen in den Vertrag einbezogen werden. Das Gesetz differenziert insoweit zwischen der Einbeziehung („werden ... Vertragsbestandteil“) und Wirksamkeit der Klauseln („sind unwirksam ...“). Die Einbeziehung zeichnet sich dadurch aus, dass die Klauseln aufgrund ihrer formalen, praktischen Gestaltung für den Verwendungsgegner nicht hinreichend als Vereinbarungsgegenstand erkennbar sind, wohingegen die Unwirksamkeit im Schwerpunkt auf die mangelnde inhaltliche Akzeptanz der Klausel nach objektiven Kriterien abstellt.12
1. Allgemeine Bedingungen für die Einbeziehung von AGB
11
§ 305 Abs. 2 BGB stellt zunächst allgemeine Bedingungen für die Einbeziehung von AGB auf. Gemäß § 305 Abs. 2 BGB muss der Verwender vor Vertragsschluss ausdrücklich bzw. unter Verweis auf einen deutlich sichtbaren Aushang (Nr. 1) und durch eine Möglichkeit zur zumutbaren Kenntnisnahme durch den Verwendungsgegner (Nr. 2) dessen Einverständnis mit der Geltung der AGB erzielen.
12
Die Einbeziehung wird im Internet häufig durch Checkboxen vollzogen, in welchen der Besteller durch aktives Setzen eines Häkchens die Kenntnisnahme der AGB bestätigen muss, bevor die Bestellung entgegengenommen wird. Dabei werden die AGB häufig innerhalb der Checkbox verlinkt. Diese Praxis begegnet keinen rechtlichen Bedenken.13 Im Gegenteil: Das LG Essen erachtete es als ausreichend, dass die AGB vor der Bestellung bei flüchtigem Blick erkannt und abgerufen werden konnten.14 Eine aktive Bestätigung durch den Besteller ist gerade keine zwingende Voraussetzung für die wirksame Einbeziehung von AGB im Internet.15 Unzureichend ist es allerdings, wenn die AGB nicht im Zusammenhang mit dem verbindlichen Bestellvorgang zur Kenntnis genommen werden können.16
2. Bereitstellung in speicherbarem und druckfähigem Format
13
Die Zurverfügungstellung hat dabei in einem speicherbaren und druckfähigen elektronischen Format zu erfolgen.17 Bloße Bildschirmdarstellung reicht, wie früher teilweise angenommen,18 nicht aus, weil dadurch die Vertragsbedingungen für den Verwendungsgegner möglicherweise nicht mehr nachträglich abrufbar sind. Das Problem dürfte aber schon deswegen von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich aus § 312i Abs. 1 Nr. 4 BGB ohnehin die Pflicht zur Übermittlung der AGB in einem speicherfähigen Format ergibt. Nicht ausreichend ist es, wenn die AGB nur über ein kleines Scroll-Fenster abrufbar sind und nicht heruntergeladen werden können.19
3. Besonderheiten im M-Commerce
14
Besondere Herausforderungen bei der Einbeziehung von AGB stellen sich im M-Commerce. Auch hier gilt grundsätzlich das zuvor Geschriebene. Allerdings muss man unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten berücksichtigen, dass nicht jeder Betreiber einer Website zwangsläufig eine mobil unterstützte Variante seiner AGB bereithalten muss. Dies muss insbesondere deswegen gelten, weil eine Überprüfung der Art der Endgeräte durch den Betreiber nicht in jedem Fall zulässig ist.20 Vielmehr ist eine solche Pflicht nur dann anzunehmen, wenn sich der Verwender durch eine mobile Ansicht seiner Website bewusst für den M-Commerce entschieden hat. Erst dann erscheint es angemessen, ihm auch die aus dem M-Commerce erwachsende besondere Pflicht zur Bereithaltung mobil lesbarer AGB aufzubürden.21 Wiederum gilt aber auch hier: Unabhängig von den AGB-rechtlichen Konsequenzen ist der Anbieter im E-Commerce via § 312i Abs. 1 Nr. 4 BGB ohnehin zur Bereitstellung der AGB in speicherbarer Form verpflichtet, sodass schon allein deswegen eine Unterrichtung (typischerweise via E-Mail oder über ein Nutzer-Konto) zu erfolgen hat.
4. Sprache der AGB
15
In welcher Sprache die AGB vorliegen müssen, um einbezogen zu werden, ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz. Einerseits sind die Interessen des Verwendungsgegners zu berücksichtigen, welcher sich nicht von AGB in fremder Sprache überzogen sehen möchte, wenn und weil er diese nicht hinreichend verstehen kann.22 Andererseits wird es dem einzelnen Unternehmer beim geschäftlichen Verkehr im Internet kaum zumutbar sein, für Kunden aus aller Welt AGB in deren Sprache zu formulieren.
16
Vermittelnd wird daher vorgeschlagen, dass die AGB in der Sprache vorliegen müssen, in welcher sich auch die Internet-Präsenz des Verwenders bewegt.23 Das ist auch richtig, führt man sich vor Augen, dass es dem Nutzer eines Online-Angebots klar sein muss, dass die Vertragssprache mit einem Anbieter, der seine Leistung etwa auf Französisch anpreist, ebenfalls Französisch sein wird. Das Problem mildert sich aber jedenfalls dadurch ab, dass der Nutzer dem Schutzbereich der AGB-Kontrolle nicht entzogen wird. Regelmäßig werden die AGB ohnehin durch den Nutzer nicht gelesen, sodass die Sprachwahl schlussendlich keine entscheidende Rolle mehr spielt.
5. Einverständnis mit Geltung der AGB
17
Das Einverständnis mit Geltung der AGB spielt insbesondere im unternehmerischen Verkehr eine bedeutsame Rolle. Zwar findet § 305 Abs. 2 BGB keine unmittelbare Anwendung auf den unternehmerischen Verkehr, vgl. dazu § 310 Abs. 2 S. 1 BGB (siehe oben Rn. 3). Jedoch heißt dies nicht, dass AGB in jedem Fall einbezogen sind. Stattdessen ist auf die allgemeinen Grundsätze für vertragliche Einigungen nach §§ 145ff. BGB zurückzugreifen, wobei § 305 Abs. 2 BGB als eine Ausprägung dessen, was tatsächlich vertraglich vereinbart worden ist (= einbezogen wird in den Vertrag), auch im unternehmerischen Verkehr gilt. Der Entfall im Sinne des § 310 Abs. 2 S. 1 BGB bezieht sich lediglich auf die verbraucherbezogenen Schutzmechanismen der Vorschrift. So müssen AGB der anderen Partei auch im unternehmerischen Verkehr vor Vertragsschluss bekannt gemacht werden, allerdings ohne dass dies eine besondere Hinweispflicht nach sich zieht. Das Einverständnis mit deren Geltung ist daher schneller anzunehmen.
6. Geltung überkreuzter AGB
18
Unter dem Stichwort der überkreuzten AGB wird die Konstellation diskutiert, dass zwei Unternehmer (zeitgleich oder nacheinander) wechselseitig AGB an die jeweils andere Partei stellen und anschließend den Vertrag vollziehen. Nach der sogenannten Theorie des letzten Wortes24 sollten für die Vertragsabwicklung die AGB Geltung finden, welche zuletzt von einer Partei an die andere gestellt worden sind, ohne dass diese sich dagegen zur Wehr setzte. Es wurde dabei auf die gesetzliche Systematik rekurriert, insbesondere auf § 150 Abs. 2 BGB. Diese Auffassung hat aber unberücksichtigt gelassen, dass der andere durch die eigene Stellung von AGB seinerseits der fehlenden Akzeptanz anderer AGB Ausdruck verliehen hat. Daher wird heute vorherrschend darauf abgestellt, inwieweit sich die von den Parteien gestellten AGB widersprechen. Soweit sie das tun, heben sie sich wechselseitig auf, sodass das dispositive Recht subsidiär eingreift, also das Gesetz gilt. Soweit sie das nicht tun, bleiben sie bestehen (Prinzip der Kongruenzgeltung).25
7. Vorrang der Individualabrede
19
§ 305b BGB normiert den Vorrang der Individualabrede. Demnach werden AGB von schriftlich oder mündlich geschlossenen andersartigen Abreden überlagert. Dies soll dem Umstand Rechnung tragen, dass AGB typischerweise ein abstraktes, modulierbares Grundgerüst bilden, welches von den Parteien durch konkrete Vereinbarung für den einzelnen Vertrag angepasst werden kann.26 Da aber die ständige Anpassung der einzelnen Klauseln mit unverhältnismäßigen Mühen verbunden wäre, werden häufig mündliche Vereinbarungen getroffen, die dann auch – gesetzlich in § 305b BGB zum Ausdruck kommend – Vorrang genießen sollen.27 Zu beachten bleibt dabei, dass § 305b BGB nur dann Relevanz entfaltet, wenn die individuellen Vereinbarungen auch tatsächlich im Widerspruch zu den AGB stehen. Dies ist durch Auslegung der fraglichen Klausel und der Individualabrede zu ermitteln. Bloß ergänzende oder klarstellende Abreden überlagern die AGB entsprechend nicht.28
20
Der Vorrang der Individualabrede kann nicht durch eine sog. doppelte Formklausel in den AGB begrenzt oder ausgeschlossen werden. Eine doppelte Formklausel besagt, dass Änderungen der AGB einer bestimmten Form bedürfen sollen (z.B. der Schriftform) und auch die Aufhebung der Formklausel selbst dieser Form unterfällt. In anderer Form getroffene individuelle Abreden der Parteien wären dann wegen Nichtbeachtung der doppelten Formklausel unwirksam. Dem ist der BGH jedoch entgegengetreten und hat doppelte Formklauseln, mit denen der Vorrang individueller Abreden unterbunden werden konnte, für unwirksam erklärt und damit dem Parteiwillen Vorrang gegeben.29 Die doppelte Formklausel ist damit letztlich nur eine Beweisregel.
8. Verbot überraschender Klauseln
21
§ 305c Abs. 1 BGB enthält das Verbot sogenannter „überraschender“ Klauseln. Demnach werden AGB nicht Vertragsbestandteil, wenn der Verwendungsgegner aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes des Vertrages nicht mit solchen AGB zu rechnen braucht. Der Unterschied zur Intransparenz der Klausel nach § 307 Abs. 1 S. 2 BGB liegt darin, dass der Verwendungsgegner die Klausel unabhängig von ihrem Inhalt als solche nicht wahrnehmen konnte, wohingegen eine intransparente Klausel zwar wahrnehmbar, aber inhaltlich nicht verständlich ist.30
22
Beide Fälle können sich aber überlagern: Teilweise wird aus unschlüssiger Positionierung der AGB auch eine inhaltliche Unschlüssigkeit der Klausel selbst folgen.31 Beispiele für überraschende Klauseln finden sich häufig dort, wo diese unter einer ungewöhnlichen Überschrift dargestellt werden.32 Dies ist wiederum durch inhaltliche Auslegung der Überschrift und der Klausel zu ermitteln. Überraschend sind aber auch etwa Klauseln, die Zahlungspflichten in den AGB positionieren, ohne dass darauf sonst hingewiesen oder gar außerhalb der AGB der Eindruck erweckt wird, es handele sich um eine unentgeltliche Leistung.33
12 Ähnlich Kutlu, AGB-Kontrolle bei stationärer Krankenhausaufnahme, 2006, S. 46. 13 Zur Änderung von AGB mit den Nutzungsbedingungen eines sozialen Netzwerks über ein Pop-Up-Fenster siehe OLG Dresden, Beschl. v. 19.11.2019 – 4 U 1471/19, K&R 2020, 229. 14 LG Essen, Urt. v. 13.2.2003 – 16 O 416/02, MMR 2004, 49. 15 LG Essen, Urt. v. 13.2.2003 – 16 O 416/02, MMR 2004, 49, 50. 16 Erstmals Löhnig, NJW 1997, 1688, 1688f.; dem wird in der Literatur bis heute gefolgt, vgl. etwa Föhlisch, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Multimedia-Recht, 2021, Kap. 13.4 Rn. 115. 17 Roloff, in: Erman, BGB, 2014, § 305 Rn. 37. 18 LG Osnabrück, Urt. v. 10.11.1995 – 2 O 60/94, CR 1996, 227; LG Bielefeld, Urt. v. 30.10.1991 – 1 S 174/90, NJW-RR 1992, 955; Brinkmann, BB 1981, 1183, 1183ff.; Lachmann, NJW 1984, 405, 408; Mehrings, BB 1998, 2373. 19 OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 9.5.2007 – 6 W 61/07, K&R 2007, 417. 20 Janal, NJW 2016, 3201, 3202. 21 OLG Hamm, Urt. v. 20.5.2010 – I-4 U 225/09, K&R 2010, 591. 22 LG Berlin, Urt. v. 9.5.2014 – 15 O 44/13, K&R 2014, 544, wonach der Messenger-Dienst WhatsApp seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen in deutscher Sprache anbieten muss. Siehe dazu auch Ernst, jurisPR-ITR 22/2014 Anm. 5. 23 So schon Drexl, in: Lehmann, Rechtsgeschäfte im Netz, 1998, S. 75, 95f.; auch Köhler/Fetzer, Recht des Internet, 2016, Rn. 253; einschränkender Waltl, in: Lehmann, Internet- und Multimediarecht, 1999, S. 185, 193f. Siehe auch BGH, Urt. v. 10.3.1983 – VII ZR 302/82, NJW 1983, 1489, wonach keine Übersetzung von fremdsprachigen AGB erforderlich ist, wenn die Verhandlungssprache Deutsch ist. Fraglich ist aber, ob die Nutzung einer Website, die aus Bildern und wenigen Wörtern besteht, mit der Nutzung einer Verhandlungssprache gleichgesetzt werden kann. 24 So früher der BGH, wonach unter Anwendung von § 150 Abs. 2 BGB die zuletzt verwendeten AGB Vertragsbestandteil geworden sein sollten, vgl. BGH, Urt. v. 29.9.1955 – II ZR 210/54, NJW 1955, 1794. 25 Westphalen, in: Westphalen, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, 2019, Teil Vertragsrecht, Vertragsabschlussklauseln – Einbeziehung, Rn. 55 m.w.N. 26 Basedow, in: MüKo-BGB, 2019, § 305b Rn. 1 mit weiteren Nachweisen bis tief in das 20. Jahrhundert. 27 Basedow, in: MüKo-BGB, 2019, § 305b Rn. 1. 28 Basedow, in: MüKo-BGB, 2019, § 305b Rn. 2. 29 BGH, Urt. v. 10.5.2007 – VII ZR 288/05, NJW 2007, 3712; Urt. v. 27.9.2000 – VIII ZR 155/99, BGHZ 145, 203; Urt. v. 15.2.1995 – VIII ZR 93/94, NJW 1995, 1488; kritisch dazu Noack/Kremer, in: Heidel/Hüßtege/Mansel/Noack, BGB, 2020, § 125 Rn. 65f. 30 Teilweise wird zu Unrecht auf eine mangelnde Trennschärfe von Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB) und überraschender Klausel (§ 305c Abs. 1 BGB) wegen gleicher Zweckrichtung verwiesen, etwa Niebling, NJ 2019, 103. 31 Insoweit richtig Niebling, NJ 2019, 103. 32 So ausdrücklich OLG Hamm, Beschl. v. 29.1.2010 – I–20 U 200/09, BeckRS 2012, 15952. 33 So etwa geschehen in einem Fall des AG München, Urt. v. 16.1.2007 – 161 C 23685/06, Zusammenfassung abrufbar unter Becklink 213620, in welchem die Nutzung eines Online-Angebots zur Schätzung der Lebenserwartung nur innerhalb der AGB als kostenpflichtig deklariert wurde.
IV. Verwenderfeindliche Auslegung von AGB
23
Sofern dies noch nicht im Rahmen der §§ 305b und 305c BGB erfolgt ist, sind die AGB inhaltlich auszulegen. Maßgebend für die Auslegung ist § 305c Abs. 2 BGB. Demnach sind AGB grundsätzlich verwenderfeindlich auszulegen. Dies darf aber nicht zu dem Trugschluss führen, dass man an dieser Stelle die Klausel so auslegt, dass diese den Verwendungsgegner möglichst wenig einschneidend trifft. Vielmehr ist an dieser Stelle (zunächst) eine maximal verwenderfreundliche Auslegung vorzunehmen, also diejenige Auslegungsvariante zu wählen, die den Verwendungsgegner am stärksten beschneidet.34
24
Diese Auslegungsvariante ist dann anhand der §§ 307ff. BGB einer Inhaltskontrolle zu unterziehen. So kann der Verwendungsgegner umfänglich vor einer unzulässigen, für ihn ungünstigen Interpretation der Klausel bewahrt werden. Außerdem trägt dies dazu bei, dass Verwender von AGB diese klar und eindeutig formulieren, um die Folgen der Inhaltskontrolle absehen zu können. Bei Verbraucherverträgen sind dabei gemäß § 310 Abs. 3 Nr. 3 BGB zusätzlich die vertragsbegleitenden Umstände zu berücksichtigen. Dabei sollen vor allem Überrumpelungs- und Monopoleffekte durch den Unternehmer berücksichtigt werden können. Gerade im Internet und E-Commerce sind Überrumpelungen von Verbrauchern durch die Leichtigkeit von Klicks und Fingertipps ein alltägliches Risiko ebenso wie die Ausnutzung von Monopoleffekten durch marktbeherrschende Plattformen wie eBay und Amazon oder die App Stores von Google und Apple.
34 BGH, Urt. v. 5.10.2016 – VIII ZR 222/15, NJW 2017, 1596, 1599; Basedow, in: MüKo-BGB, 2019, § 305c Rn. 51 mit Erörterungen zur Entwicklung der Interpretation von § 305c Abs. 2 BGB.
V. Inhaltskontrolle von AGB
25
Sind die AGB wirksam einbezogen und steht der zu prüfende Inhalt nach deren Auslegung fest, so müssen die AGB mit den Maßgaben der §§ 307ff. BGB in Einklang zu bringen sein. Geprüft wird dabei typischerweise „von hinten nach vorne“, also zunächst § 309, dann § 308 und zuletzt § 307 BGB. An die Bereichsausnahme des § 310 Abs. 1 S. 2 BGB für die AGB-Kontrolle im unternehmerischen Verkehr sei an dieser Stelle erinnert (siehe oben Rn. 3).
26
Wichtig zu beachten ist dabei, dass nach § 307 Abs. 3 BGB nur gesetzeswidersprechende AGB zur Prüfung gestellt sind. Das schließt zum einen gesetzeswiederholende AGB aus, zum anderen aber auch solche Regelungen, die der Parteiautonomie mangels Gesetzesvorgaben vollständig unterliegen. Dies betrifft insbesondere die Essentialia Negotii, also die Vertragspartner, den Leistungsgegenstand im Kern und die Preisabrede.35
1. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit
27
§ 309 BGB enthält sogenannte Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit. Sie greifen unmittelbar nur gegenüber Verbrauchern als Verwendungsgegnern, haben aber auch im unternehmerischen Verkehr Indizwirkung für die Unwirksamkeit entsprechender AGB (siehe oben Rn. 3).
28
Die Klauselverbote zeichnen sich dadurch aus, dass die dort aufgezählten Fälle eindeutig sind und stets zur Unwirksamkeit der AGB führen. Exemplarisch seien an dieser Stelle nur die Nrn. 7a und 7b genannt, also die Unwirksamkeit von Haftungsausschlüssen bei grober Fahrlässigkeit oder bei Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit.
29
Mit dem Gesetz für faire Verbraucherverträge36 wurde § 309 Nr. 9 BGB mit Inkrafttreten zum 1. Juli 2022 neu gefasst, welcher zwingende Vorgaben zur Laufzeit, Verlängerung und Kündigung von Dauerschuldverhältnissen beinhaltet. Anders als im bisherigen § 309 Nr. 9 lit. b BGB sind hiernach stillschweigende Verlängerungen von Dauerschuldverhältnissen stets unzulässig, wenn der Verbrauchervertrag sich hierdurch nicht auf unbestimmte Zeit mit einer Kündigungsfrist von höchstens einem Monat verlängert. Dies soll dem Schutz der Verbraucher bei in Vergessenheit geratenen Verträgen dienen.
2. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit
30
§ 308 BGB enthält die sogenannten Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Diese enthalten anders als § 309 BGB wertungsbedürftige Begrifflichkeiten wie „unangemessen“, „zumutbar“ oder „besondere Bedeutung“. Sie unterliegen einer gewissen Unschärfe und bilden insoweit den Übergang zwischen der Generalklausel des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB und den Klauselverboten ohne Wertungsmöglichkeit gemäß § 309 BGB.
31
Beispielhaft kann hier auf die vertraglich vereinbarten Fiktionen bei Abgabe und Zugang von Willenserklärungen nach den Nrn. 5 und 6 verwiesen werden, welche gegebenenfalls eine Unwirksamkeit nach sich ziehen können. Auch die Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit greifen unmittelbar nur für AGB gegenüber Verbrauchern, werden aber zunehmend ebenfalls als Indizien für die Inhaltskontrolle unternehmerischer AGB in § 307 Abs. 2 BGB hineingelesen (siehe oben Rn. 3).
3. Allgemeine Inhaltskontrolle nach § 307 BGB
32
Sofern weder § 309 BGB noch § 308 BGB den thematischen Gehalt der zu überprüfenden Klausel abdeckt oder es sich um AGB aus dem unternehmerischen Verkehr handelt, ist die Überprüfung der AGB anhand von § 307 BGB vorzunehmen. § 307 BGB differenziert zwischen der unangemessenen Benachteiligung wegen Treuwidrigkeit nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB einschließlich deren Regelbeispiele in § 307 Abs. 2 BGB und der Unangemessenheit wegen der Intransparenz einer Klausel nach § 307 Abs. 1 S. 2 BGB.37 Beide Fälle schließen sich nicht aus. Die Treuwidrigkeit der Klausel wird als Wertungsfrage innerhalb des Anwendungsbereichs der §§ 305ff. BGB originär nach § 307 BGB bestimmt. Eines Rückgriffs auf § 242 BGB bedarf es insoweit nicht.38
a) Abweichung von Grundgedanken der gesetzlichen Regelung
33
Nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB liegt im Zweifel eine unangemessene Benachteiligung vor, wenn die AGB mit dem wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht mehr zu vereinbaren ist. Wichtig ist dabei die Arbeit am Wortlaut der Norm: Entscheidend ist der Vergleich zwischen AGB und Rechtslage, nicht zwischen AGB und Grundgedanken des Vertrags. Insofern unrichtig entschied der BGH, dass eine AGB-Klausel in einem Flugbeförderungsvertrag, welche einen Rückzahlungsanspruch bei Stornierung der Flugreise gänzlich ausschloss, nicht die Merkmale des § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB erfülle, weil die gesetzliche Regelung des § 648 Abs. 1 S. 2 BGB, von welcher abgewichen werden sollte, auf den Flugbeförderungsvertrag nicht passe, folglich nicht das Leitbild des Vertrags sei.39 Diese Argumentation ist mit dem Wortlaut des § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht vereinbar und daher nicht verallgemeinerungswürdig.40
34
Weiterhin hat der BGH eine Klausel der Ryanair Ltd. als unangemessen angesehen, die den Verträgen über Flugbuchungen im Internet zugrunde lag.41 Danach hatten die Passagiere für die benutzten Zahlungssysteme unterschiedlich hohe „Gebühren“ zu zahlen. Die angegriffene Gebührenregelung für die Zahlung mit Kredit- oder Zahlungskarte ist nach Ansicht des BGH mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung unvereinbar (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB) und benachteiligt die betroffenen Kunden in unangemessener Weise (§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB). Zu den wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung gehört nach Ansicht des Gerichts, dass jeder seine gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen hat, ohne dafür ein gesondertes Entgelt verlangen zu können. Mit der Entgegennahme einer Zahlung komme der Unternehmer nur seiner Obliegenheit nach, eine vertragsgemäße Leistung des Kunden anzunehmen. Er müsse dem Kunden die Möglichkeit eröffnen, die Zahlung auf einem gängigen und mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Weg zu entrichten, ohne dass dafür an den Zahlungsempfänger eine zusätzliche Gebühr zu bezahlen ist. Die von der Beklagten vorgesehene gebührenfreie Zahlungsart genüge diesen Anforderungen nicht.
35
Dagegen wurde die Klausel, die die Barzahlung ausschließt, nicht beanstandet. Die mit dem Ausschluss der Barzahlung einhergehende Benachteiligung der Fluggäste sei angesichts des anerkennenswerten Interesses der Beklagten an möglichst rationellen Betriebsabläufen nicht als unangemessen anzusehen. Bei der vorzunehmenden Abwägung sei ausschlaggebend, dass die Beklagte ihre Leistungen nahezu ausschließlich im Fernabsatz erbringe und eine Barzahlung für beide Parteien mit erheblichem Aufwand verbunden wäre. Anzumerken ist dabei, dass die AGB-rechtliche Überprüfung durch den BGH überflüssig war. Denn die Zahlungsmittelwahl gehört untrennbar zu der Hauptleistungsabrede der Parteien.42 Insoweit fällt eine Abrede über die Zahlweise unter den Ausschlusstatbestand von § 307 Abs. 3 S. 1 BGB, welcher die gerichtliche Kontrolle der wechselseitigen Hauptleistungspflichten gerade ausschließt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn eine oder mehrere Zahlungsart(en) als solche treuwidrig mit Zusatzkosten verbunden wird/werden.43
b) Gefährdung der Erreichung des Vertragszwecks
36
Nach § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB ist die Unangemessenheit einer AGB in der Regel zu bejahen, wenn durch die Klausel die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet würde. Dies ist nach dem BGH stets der Fall, wenn durch die AGB „Kardinalpflichten“44 abbedungen oder beschränkt werden. Kardinalpflichten oder wesentliche Vertragspflichten meint dabei alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Verwendungsgegner als Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.45
37
Unter wesentliche Vertragspflichten werden etwa Konstellationen verstanden, bei denen der Verwender für den Fall der Nichterfüllung der Hauptpflicht jegliche Nacherfüllungshaftung ausschließt.46 Ein weiteres Beispiel ist darin zu sehen, dass rechtsverbindlich eine Auskunft eingeholt werden soll, aber in den AGB die Haftung für die Falschauskunft kategorisch ausgeschlossen wird.47 Entscheidend ist also, ob der Vertrag unter Berücksichtigung der fraglichen AGB noch den vom Verwendungsgegner angestrebten erkennbaren Sinn des Geschäfts erfüllen kann.