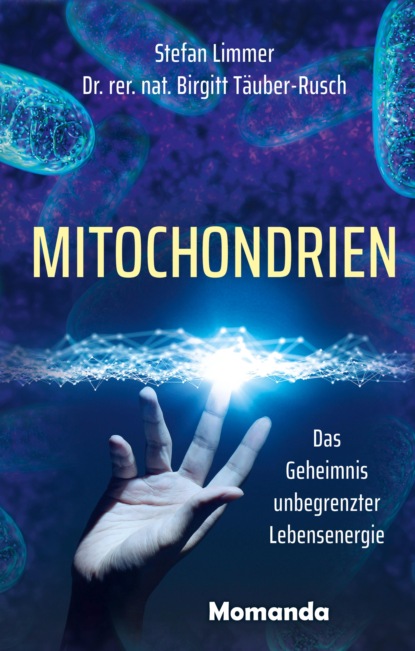- -
- 100%
- +
Die Innenmembran enthält Proteine aus drei unterschiedlichen Funktionskreisen:
• Proteine, die die Oxidationsreaktionen der Atmungskette durchführen.
• Enzymkomplexe, die als »ATP-Synthase« bezeichnet werden und die in der Matrix ATP herstellen.
• Spezifische Transportproteine, die die Passage von Metaboliten – den Zwischenprodukten des Stoffwechsels – durch die Membran in die Matrix und aus ihr heraus regulieren.
Über die Innenmembran wird ein Protonengradient – ein Konzentrationsunterschied – errichtet, der die ATP-Synthase antreibt. Die Membran muss für die meisten kleinen Ionen undurchlässig sein, da der Gradient sonst nicht aufrechterhalten werden kann. Einzig Wasser, Sauerstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Stickstoffmonoxid können frei diffundieren.
Die Innenmembran ist hoch spezialisiert und enthält unter anderem große Mengen des Doppel-Phospholipids Cardiolipin, das mit seinen vier Fettsäuren wahrscheinlich dazu beiträgt, die Membran besonders Ionen-undurchlässig zu machen. Zudem enthält sie eine Reihe unterschiedlicher Transportproteine; sie machen die Membran sehr selektiv durchlässig für spezifische kleine Moleküle, die in der Matrix verstoffwechselt werden sollen oder von den vielen Mitochondrien-Enzymen im Matrixraum benötigt werden.
Der Intermembranraum, also der Bereich zwischen den beiden Membranen, enthält verschiedene Enzyme, die das aus der Matrix entlassene ATP zur Phosphorylierung anderer Nukleotide verwenden. Da die äußere Membran für kleine Moleküle frei durchlässig ist, ist die Konzentration von kleinen Molekülen wie Ionen und Zucker identisch mit deren Konzentration im Zytosol. Große Proteine benötigen eine spezifische Signalsequenz, um durch die Membran transportiert zu werden.
Somit unterscheidet sich die Zusammensetzung der Proteine zwischen dem Intermembranraum und dem Zytosol. So ist z.B. das Cytochrom C ein Protein, das im Intermembranraum gehalten wird. Proteine des Intermembranraumes sind für viele mitochondriale und zelluläre Prozesse bedeutend, unter anderem für den Energiestoffwechsel, die Apoptose und den Transport von Metaboliten und Proteinen.
Die Matrix enthält ein hoch konzentriertes Gemisch aus Hunderten von Enzymen, unter anderem die für die Oxidation von Pyruvat und Fettsäuren sowie für den Zitronensäurezyklus benötigten Enzyme. Auch enthält sie mehrere identische Kopien des mitochondrialen DNA-Genoms, spezielle mitochondriale Ribosomen, t-RNAs und verschiedene Enzyme für die Expression, also für die Realisierung der Information, die in der DNA der Mitochondrien-Gene gespeichert ist.
Die Hauptarbeit der Mitochondrien findet in der Matrix und in der Innenmembran statt.
Funktionen der Mitochondrien im Überblick
Energieproduktion (➧ Teil 2)
• Umwandlung von Pyruvat aus der Glykolyse in Acetylex-CoA durch den Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex
• Bildung von Acetyl-CoA durch Beta-Oxidation der Fettsäuren
• Gewinnung von Reduktionsäquivalenten (NADH/H+ und FADH2) aus Acetyl-CoA im Zitronensäurezyklus
• Übertragung der Elektronen und Protonen aus den Reduktionsäquivalenten (NADH/H+ und FADH2) auf Enzymkomplexe der Atmungskette – Entstehung eines Protonengradienten
• Bildung von ATP durch den Protonengradienten, der die ATP-Synthase antreibt, bei der oxidativen Phosphorylierung
• Erstreaktionen der Glukoneogenese (Bildung von Glukose aus dem Zuckerspeicher Glykogen)
• Ketonkörpersynthese
Weitere Stoffwechselwege, die zum Teil in den Mitochondrien ablaufen:
• Die Synthese von Häm als Zentralbestandteil von Hämoglobin und Bestandteil von anderen Stoffen ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Sie findet zum Teil im Intermembranraum der Mitochondrien statt.
• Mitochondrien sind für die Bildung von Steroidhormonen in bestimmten hormonbildenden Geweben mitverantwortlich. Sie stellen den Startort der Synthese aus Cholesterin und den Endpunkt bei der Bildung des Stresshormons Cortisol und des Dursthormons Aldosteron dar.
• Außerdem entstehen Aminosäuren aus Intermediaten des Zitronensäurezyklus, die zum Teil für Enzyme der Atmungskette gebraucht werden, aber auch aus der Zelle heraustransportiert werden können, um für weitere Proteinbildungen zur Verfügung zu stehen.
• Ein Teil des Harnstoffzyklus läuft unter Energieverbrauch in den Mitochondrien ab. Dabei wird z.B. der giftige Ammoniak, der unter anderem beim Abbau von Aminosäuren entsteht, zu harmlosem Harnstoff abgebaut.
Zusätzliche Funktionen:
• Synthese von Eisen-Schwefel-Clustern, den Bestandteilen der Proteinkomplexe der Atmungskette.
• Speicherort für Kalzium: Mitochondrien sind in der Lage, Kalzium-Ionen aufzunehmen und wieder abzugeben, und spielen daher eine Rolle bei der für die Zelle wichtigen Kalzium-Homöostase (Gleichgewicht).
• Apoptose (programmierter Zelltod): Das im Intermembranraum befindliche Cytochrom C, das als Elektronenüberträger der Atmungskette unverzichtbar ist, hat zusätzlich eine wichtige Funktion für den programmierten Zelltod. Liegen in der Außenmembran der Mitochondrien Schäden vor, so kann Cytochrom C ins Zytoplasma der Zelle gelangen und Enzyme aktivieren, die den programmierten Zelltod einleiten.
Die Hauptaufgabe der Mitochondrien ist die Energiegewinnung durch die Zellatmung. Die dafür notwendigen Bestandteile sind Sauerstoff und Nahrung. Dabei wird die Nahrungsenergie in kleine »Energiepäckchen« (das ATP, die Energiewährung des Körpers) umgewandelt.
Doch wie gelangen der Sauerstoff und die Nährstoffe in die Zelle und zu den Mitochondrien?
Die Reise des Sauerstoffs zu den Zellen
Sauerstoff ist für die Energiegewinnung in unseren Mitochondrien essenziell. Als Bestandteil der Luft ist er überall in unserem Lebensraum reichlich vorhanden. Der Sauerstoffgehalt in der Luft bleibt weitgehend konstant bei 21 Prozent. Sie enthält außerdem 78 Prozent Stickstoff, ca. 0,9 Prozent Argon – ein Edelgas –, Spurengase wie Kohlendioxid, Neon, Helium, Krypton und Xenon. Problematisch für unsere Gesundheit und für die Umwelt ist dabei der stetige Anstieg der primären Luftschadstoffe, z.B. Kohlendioxid, Stickoxide, Ammoniak, Schwefeloxide, Stoffpartikel wie Staub, Rauch, Ruß und Aerosole (Gemische aus festen und flüssigen Schwebeteilchen in einem Gas).
Ein erwachsener Mensch atmet ungefähr 17.000 bis 21.000 Mal am Tag ein und aus. Der komplexe Atemvorgang ist notwendig für den Gasaustausch: Blut wird mit Sauerstoff angereichert, und Kohlendioxid wird aus dem Blut abtransportiert.
Das wichtigste Organ für die Atmung und den Gasaustausch ist die Lunge. Die sauerstoffreiche Luft strömt beim Einatmen über die oberen Atemwege (Nase, Mund, Kehlkopf und Rachen) zu den unteren Atemwegen (Luftröhre, Lunge mit Bronchien und Bronchiolen) und den dort sitzenden Lungenbläschen, den Alveolen. Die Alveolen sind mit einem feinen Kapillarnetz – den kleinsten Blutgefäßen – umzogen; dort findet der eigentliche Gasaustausch statt. Das durch die Kapillaren fließende Blut nimmt Sauerstoff aus den Alveolen auf und gibt gleichzeitig in die Alveolen CO2 ab, das dann bei der Ausatmung nach draußen strömt.
Da sich Sauerstoff schlecht im Wasser bzw. im Blut löst, braucht es ein Transportmedium, um zu den Zielzellen und dort zu den Mitochondrien transportiert zu werden. Diese Aufgabe übernehmen im Blut die roten Blutkörperchen, die mit Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, verbunden sind. Hämoglobin kann sehr gut Sauerstoff binden und bei Bedarf auch wieder abgeben. So fungieren das Hämoglobin und die roten Blutkörperchen wie ein Taxidienst, der den Sauerstoff abholt, ihn aufnimmt und zum Zielort transportiert. Das Kohlendioxid wiederum, das als Abfallprodukt bei der Energiegewinnung in den Mitochondrien entsteht, löst sich wesentlich besser in Wasser und im Blut. So wird es zum einen von den »Taxis« – den roten Blutkörperchen mit dem Hämoglobin – zu den Alveolen zurücktransportiert und dort abgeatmet. Zum anderen kann es in Hydrogencarbonat umgewandelt werden, das in Blut sehr gut löslich ist. So wird es zur Lunge transportiert und dort vor dem Ausatmen wieder in CO2 verwandelt. Wie für alle Körpervorgänge benötigt und verbraucht der Körper dabei Energie, die die Mitochondrien zur Verfügung stellen.
Der Sauerstoffgehalt der Ausatemluft enthält immer noch 16 Prozent Sauerstoff. Wir nehmen also nur 5 Prozent des in der Luft enthaltenen Sauerstoffs auf. Der CO2-Gehalt in der Ausatemluft beträgt 4 Prozent; also atmen wir 40 Milliliter CO2 pro Liter Luft aus.
Verdeutlichen wir uns diese Dimension des Atemvorgangs, wird dessen essenzielle Bedeutung ersichtlich. Ein erwachsener Mensch atmet im Durchschnitt pro Minute 12- bis 15-mal ein und aus. Dabei werden ca. 8 Liter Luft in uns hinein- und hinausbewegt. Am Tag sind das über 12.000 Liter Luft. Pro Minute setzen wir 0,4 Liter Sauerstoff um.
Saubere Luft ist lebenswichtig
Saubere Luft ist essenziell für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Die Luftverschmutzung, also die Anreicherung der Atemluft mit verschiedensten Schadstoffen, hat aber seit Beginn der Industrialisierung immer mehr zugenommen. Gerade in etlichen Ballungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und in Industriegebieten hat die Konzentration von verschiedensten gesundheitsschädlichen Stoffen trotz vieler Bemühungen zur Luftreinhaltung längst bedenkliche Werte erreicht oder überschritten. Unser menschlicher Körper benötigt dann mehr Energie, um Schadstoffe wieder auszuleiten und physische Schäden zu reparieren bzw. die Funktion bereits geschädigter Bereiche aufrechterhalten zu können. Dadurch steht weniger Energie für andere Aufgaben zur Verfügung. Luftreinhaltung ist daher bekanntlich kein Luxus, sondern grundlegend notwendig für Menschen, Tiere, ja die gesamte Natur und für die Aufrechterhaltung gesunder, funktionierender Lebensgrundlagen, da auch Pflanzen, Böden, Gewässer, Gebäude und Materialien unter den vielen Luftschadstoffen leiden.
Zusammen mit Wind, Wärme und Sonnenlicht reagieren die primären Schadstoffe miteinander, sie vermischen sich – es entstehen sekundäre Luftschadstoffe wie Feinstaub, Ozon usw.
Ozon reizt die Atemwege und ist in höheren Konzentrationen giftig.
Die Feinstaubpartikel sind so klein, dass sie über die Lungenbläschen in den Blutkreislauf und von dort weiter zu Körperzellen gelangen. Dort können sie zu unkontrollierten Reaktionen führen – sie gelten unter anderem als krebserregend. Rauch und Ruß setzen sich in der Lunge ab und beeinträchtigen deren Funktion.
Stickstoffdioxid (NO2) schädigt Pflanzen und wirkt als Reizgas buchstäblich reizend auf uns Menschen, was z.B. besonders problematisch für Asthmatiker ist. Aufgrund der starken Oxidationswirkung kann es zu Entzündungsreaktionen in den Atemwegen kommen.
Stickstoffmonoxid (NO) reagiert weniger in den Lungen, sondern geht ins Blut über und hat eher einen systemischen Effekt. Es beeinflusst die Spannung der Blutgefäße und ruft eine Gefäßerweiterung hervor. Zudem ist Stickstoffmonoxid ein körpereigener Botenstoff, aber das von außen zugeführte NO kann massiv in verschiedene Mechanismen wie die Blutdruck-Regulierung oder die Signalübertragung an das Gehirn und das periphere Nervensystem eingreifen und sie empfindlich stören. Zudem werden Heilreaktionen verhindert, da sich die Blutplättchen und weißen Blutkörperchen nicht mehr an die Gefäßwände anheften können.
Kohlenmonoxid (CO) entsteht immer bei einer unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen, besonders im Fall von Sauerstoffmangel bei Verbrennungsprozessen. Es handelt sich um ein starkes Atemgift, verhindert die Aufnahme von Sauerstoff bei Menschen und Tieren und kann starke Auswirkungen auf unser zentrales Nervensystem haben.
Stickoxide (NOx) entstehen bei der Verbrennung von Kohle und Öl. Sie reizen Schleimhäute, Augen und Atemwege.
Die Reise der Nährstoffe zu den Zellen
Genauso wie der Sauerstoff müssen auch die in der Nahrung enthaltenen und für die Energiegewinnung notwendigen Stoffe zu den Mitochondrien gelangen. Sind die Nahrungsaufnahme und/oder die Verdauung gestört, werden möglicherweise weniger Nährstoffe resorbiert; in der Folge fehlen die notwendigen Stoffe, sodass unser Körper nicht genügend Energie bereitstellen kann.
Aber woher weiß unser Körper, wann er welche notwendigen Verdauungsschritte ankurbeln soll, damit die Nahrungsverwertung optimal funktioniert?
Wissenschaftler des Max-Plank-Institutes haben herausgefunden, dass bereits vor der Nahrungsaufnahme Verdauungsprozesse im Körper beginnen. Damit die aufgenommene Nahrung effizient verarbeitet werden kann, wird in dieser sogenannten Kopfphase der Verdauung bereits die Magensäureproduktion aktiviert, sobald wir die Nahrung riechen und sehen; gleichzeitig werden Neuronen, also Nervenzellen, in der Hypothalamusregion des Gehirns aktiviert, die Signale an die Leber leiten, um sie auf die Verdauung vorzubereiten.
Der ganze weitere Prozess der Nahrungsaufnahme sowie der Verwertung und des Transports der für die Energiegewinnung notwendigen Stoffe wird durch ein hoch komplexes Kontroll- und Regelsystem vom Gehirn und vom Hormonsystem und, wie wir später sehen werden (➧ Teil 2 ➧ »Lichtquanten – Biophotonen – Intelligente Zellkommunikation«), von Lichtquanten gesteuert.
Proteinverdauung und Aufnahme von Aminosäuren im Körper
Die über die Nahrung aufgenommenen Eiweiße (Proteine) werden im Magen-Darm-Trakt mithilfe von Enzymen (Pepsine/Proteasen) zunächst zu Oligopeptiden, dann weiter zu Di- und Tripeptiden und schließlich zu Aminosäuren abgebaut. Die erste Spaltung beginnt im Magen. Im Duodenum (Zwölffingerdarm) werden die Proteine mithilfe von Enzymen aus dem Pankreas (Bauchspeicheldrüse) weiter zu Oligopeptiden zerlegt. Letzte Spaltungsschritte werden von Enzymen der Enterozyten durchgeführt, wobei Di- und Tripeptide entstehen.
Die Resorption der Spaltprodukte in die Enterozyten (Zellen der Darmwand) erfolgt aktiv (es wird Energie benötigt), da sich dort bereits eine hohe Konzentration an Aminosäuren befindet. Die Di- und Tripeptide werden hier weiter zu Aminosäuren abgebaut. Über die Mukosazellen der Darmwand werden sie passiv durch Diffusion ins Blut abgegeben und zunächst über die Pfortader zur Leber transportiert. Von hier werden sie weiter über das Blut zu den jeweiligen Zielzellen befördert. Zusätzlich zu den mit der Nahrung aufgenommenen Proteinen werden auch die Proteine in einer Zelle ständig abgebaut, um sie zu erneuern.
Durch diesen regen Proteinstoffwechsel sind immer freie Aminosäuren verfügbar. Deshalb ist es nicht notwendig, Aminosäuren auf Vorrat zu speichern, im Gegensatz zu den Kohlenhydraten und Fetten. Nimmt man mehr Proteine auf, als man braucht, werden die überschüssigen Aminosäuren zu Energie verbrannt. Allerdings entsteht beim Abbau von Aminosäuren eine Art Sondermüll in Form von Ammoniak, der für den Körper giftig ist. Er muss deshalb zunächst über das Blut zur Leber transportiert werden, wo er in den ungiftigen Harnstoff umgebaut wird. Nachdem dieser über das Blut zu den Nieren gelangt ist, kann er mit dem Urin ausgeschieden werden. Das verbleibende Kohlenstoffgerüst der Aminosäuren wird vor allem zu Acetyl-CoA (aktivierte Essigsäure), aber auch zu Acetoacetyl-CoA, Pyruvat, Oxalacetat oder anderen Intermediaten des Zitronensäurezyklus umgewandelt und somit im Energiestoffwechsel zur ATP-Bildung, für die Glukoneogenese oder für die Fettsäuresynthese verwendet (➧ Teil 2).
Fettverdauung und Fettaufnahme in die Zelle
Viele der heutigen Nahrungsmittel enthalten große Mengen an Fetten (Lipiden). Wenn die Aufnahme von Fett den eigenen Bedarf übersteigt, gilt dies als ungesund, da sich das überschüssige Fett in den Arterien ablagern und Herz- und Gefäßerkrankungen verursachen kann. Trotzdem: Ohne Fett kann der Mensch nicht leben.
Fett ist ein wichtiger Geschmacksträger und liefert viel Energie (9,3 kcal bzw. 39 kJ pro Gramm), mehr als doppelt so viel wie Kohlenhydrate (4,1 kcal bzw. 17 kJ pro Gramm) oder Eiweiße (ebenfalls 4,1 kcal bzw. 17 kJ pro Gramm). Weiterhin dient es zur Wärmeisolation, schützt innere Organe und spielt eine wichtige Rolle beim intrazellulären Membranaufbau. Die Fette, die wir über die Nahrung aufnehmen (also Pflanzenöle, Butter etc.), setzen sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen: Phospholipiden, Cholesterin, Triglyceriden, den fettlöslichen Vitaminen E, D, K und A und Fettsäuren.
Fette lösen sich nicht in Wasser und können nicht einfach ins Blut aufgenommen und dort transportiert werden; zu diesem Zweck werden sie in sogenannte Lipoproteine (Komplex aus Apoproteinen, Phospholipiden, Cholesterin und Triglyceriden) eingebaut.
Die Fettverdauung beginnt bereits im Mund. Ein dort freigesetztes Enzym (Zungengrund-Lipase) beginnt hier schon mit der Fettzerlegung. Hauptsächlich findet sie jedoch im Dünndarm statt, und zwar mithilfe von Gallensäuren aus der Leber und anderen Lipase-Enzymen aus dem Verdauungssaft der Bauchspeicheldrüse. Durch den Kauvorgang und die Magenmotilität (Motilität = Bewegung) sowie die Beimischung von Gallensalzen im Dünndarm findet eine Emulsion der Fette statt, wodurch sie sich in sehr feine Tröpfchen in der wässrigen Umgebung verteilen und somit den Lipasen eine große Angriffsfläche bieten. Die vorwiegende Fettresorption findet im Zwölffingerdarm (Duodenum) und im oberen Leerdarm (Jejunum) statt. Dafür ist eine Zerlegung der Triglyceride mittels Lipasen in Glycerin und Fettsäuren notwendig. Aus diesen werden im Darmlumen sogenannte Mizellen gebildet, die in die Dünndarmzelle aufgenommen werden und ihren Inhalt, also die Glyceride und Fettsäuren, in die Darmzelle (Enterozyt) abgeben.
Nur kurze und mittellange Fettsäuren gelangen durch die Darmzotten ins Blut, das sie zum Abbau in die Leber transportiert. Für langkettige Fettsäuren findet zunächst eine Resynthese zu Triglyceriden statt. Diese können die Zelle nicht verlassen und müssen vorher mit einer speziellen Proteinhülle versehen werden. Es entstehen sogenannte Chylomikronen, mit deren Hilfe die Fette die Zellmembran wieder passieren können und dann ins Lymphsystem abgegeben werden. Von dort aus gelangen sie in den großen Blutkreislauf und werden zu den Zielzellen transportiert.
Die freien Fettsäuren dienen nun der Zielzelle zur Energiegewinnung. Wie wir gesehen haben, ist die Fettaufnahme, der Fetttransport und der Weg in die Zelle ein hoch komplexer, intelligenter Vorgang, der eines Höchstmaßes an Koordination bedarf.
Der Hauptspeicherort der Fette ist im Zytosol der Zellen.
Kohlenhydratverdauung und Zuckeraufnahme im Körper
Kohlenhydrate bzw. Zucker sind in vielen Lebensmitteln enthalten und als Energielieferanten für uns Menschen lebenswichtig. Besonders der Traubenzucker (Glukose) liefert Energie für sehr viele Vorgänge im Körper.
Die Kohlenhydratverdauung beginnt bereits im Mund unter Einfluss des Enzyms Amylase: Es entstehen Stärke und Maltose. Im Magen quellen die Zuckermoleküle mithilfe von Wasser und Säure auf und entwirren sich. Im Dünndarm findet nun die weitere Aufspaltung statt. Hierbei sind die Enzyme der Bauchspeicheldrüse von Bedeutung, welche die Stärke vollständig in Maltose zerlegen. Mit Enzymen des Bauchspeichels und der Darmwand wird die Maltose weiter in Glukose verwandelt. Aber nicht nur Stärke, sondern alle mit der Nahrung aufgenommenen Polysaccharide (Vielfachzucker) und Disaccharide (Zweifachzucker) werden auf diese Art und Weise in Einfachzucker wie Glukose, Fruktose und Galaktose gespalten. Glukose und Galaktose werden aus dem Dünndarm aktiv resorbiert, Fruktose hingegen wird über erleichterte Diffusion in die Enterozyten des Darms aufgenommen. Von dort gelangen sie über die Blutkapillaren in den Blutkreislauf.
Mit dem Blut wird die Glukose nun zunächst zur Leber transportiert. Die Glukose dient hier zum einen als Energielieferant, zum anderen wird sie als Glykogen gespeichert. Der Hauptanteil jedoch verlässt die Leber und wird zu den Zielzellen transportiert, die Glukose benötigen.
Die meisten Zellen können aber den Zucker nicht direkt aufnehmen. Sie brauchen dazu das Insulin, mit dessen Hilfe der Zucker durch die Zellwand in den Zellinnenraum gelangen kann. Ohne Insulin verbleibt der Zucker im Blut, wo die Konzentration ansteigt – was zu hohe Blutzuckerwerte zur Folge hat und viele negative Auswirkungen, Symptome und Schäden verursacht (z.B. bei Diabetes).
Insulin ist das in der Bauchspeicheldrüse in den Betazellen der Langerhans-Inseln gebildete und dort gespeicherte Hormon. Die Bauchspeicheldrüse hält immer ca. 10 mg Insulin vorrätig – eine Menge, die je nach den momentanen Lebensumständen und Belastungen für ca. 5 Tage ausreicht. Während und nach der Nahrungsaufnahme leert sich dieser Speicher entsprechend dem Insulinbedarf. Die Zuckermengen im Blut werden gemessen und signalisieren der Bauchspeicheldrüse, Insulin auszuschütten und gleichzeitig neues Insulin für das Depot zu bilden.
Auf der Zelloberfläche befinden sich Rezeptoren, an die das Insulin andocken kann; das gleicht einem Schlüssel, der genau ins Schloss passt. Wenn also Insulin die Rezeptoren aktiviert hat, können die Zellen in den Organen die Zuckermoleküle aufnehmen und den Zucker zur Energiegewinnung abbauen, sodass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird.
Etwa 2 Stunden nach der Nahrungsaufnahme ist der Zucker mithilfe des Insulins im Blut weitgehend in den Zellen verschwunden. Würde Insulin weiter ungebremst Zucker in die Zellen schleusen, dann würde im Blut »Unterzucker« herrschen. Das Gehirn bekäme dann zu wenig Treibstoff: Dadurch sinkt die Konzentration, die Laune verschlechtert sich und wir fühlen uns immer schwächer. Deshalb schüttet die Bauchspeicheldrüse kein weiteres Insulin aus, sobald der Blutzuckerspiegel das Normalniveau erreicht hat.
Der Gegenspieler des Insulins ist das Hormon Glukagon, das die Leber veranlassen kann, aus den Zuckerdepots (Glykogen) den Zucker freizusetzen.
Eiweiße, Fette und Zucker gelangen wie beschrieben in den Körper und werden zerlegt. Das dabei entstehende Kohlenwasserstoffmolekül wird dann mithilfe von Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser verbrannt. Beim Zucker ist es das Pyruvat, bei den Fetten sind es die Fettsäuren, und bei den Eiweißen sind es die Aminosäuren, die in die Mitochondrien gelangen und über die dortigen Stoffwechselwege in Energie umgewandelt werden.
Bei der Energiegewinnung durch die Zellatmung werden ungefähr 80 Prozent des eingeatmeten Sauerstoffs verbraucht. Durch die Verbrennung wird Energie frei; damit sie nicht auf einmal freigesetzt wird, speichert die Zelle sie in der energiereichen und für die Zelle nutzbaren Form des ATP. Die Zellatmung besteht aus verschiedenen Teilschritten. Zum einen sind dies die Glykolyse im Zytosol sowie der in der Matrix stattfindende Zitronensäurezyklus oder Krebs-Zyklus (nach seinem Entdecker benannt) und zum anderen die Atmungskette mit der oxidativen Phosphorylierung in der inneren Mitochondrien-Membran.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.