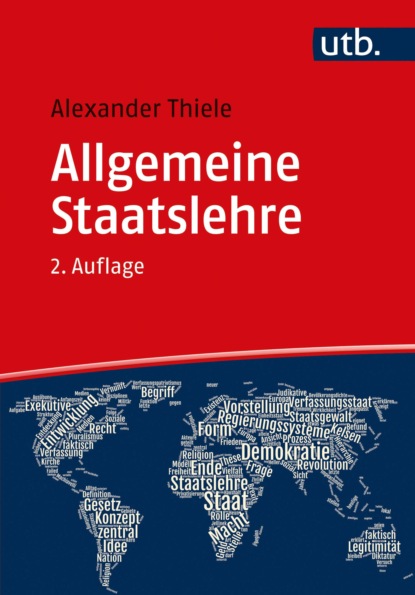- -
- 100%
- +
Darüber hinaus muss sich eine Allgemeine Staatslehre auf eine Untersuchung des bestehenden Staatensystems beschränken. Die Allgemeinheit auch in historischer Perspektive einlösen zu wollen und damit zugleich eine umfassende Evolutionsgeschichte des modernen Staates zu verfassen, ist |18|angesichts der Vielfalt der historischen Staaten und staatsähnlichen Herrschaftsstrukturen nicht möglich, muss daher anderen überlassen bleiben.[112] Durch die Erkenntnisse der politischen Anthropologie ist die Zahl politischer Systeme, die in einer solchen Geschichte zu behandeln wären, noch einmal erheblich angestiegen. Diese hat seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dargelegt, dass Formen von Politik und damit auch Formen von Staatlichkeit und Herrschaft keineswegs erst mit den Hochkulturen, sondern bereits in den frühen segmentären und tribalistischen Gesellschaften im Anschluss an die neolithische Revolution zu finden sind.[113] Diese Gesellschaften waren stets auch von politischem und sozialem Wandel geprägt[114] und haben eine politische Geschichte, die zu erzählen ebenso wichtig erscheint, wie sie von einer Allgemeinen Staatslehre nicht geleistet werden kann. Martin Kriele hat also Recht, wenn er festhält, dass jede Generation ihre eigene Allgemeine Staatslehre entwickeln muss.[115] Das ist demnach nicht nur aufgrund sich verändernder politischer Herausforderungen und erkenntnistheoretischer Modelle der Fall, sondern auch weil jede Generation eine veränderte Staatenwelt vorfindet, die einer eigenständigen Beschreibung und normativ-kritischen Einordnung bedarf. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg verfasste Lehrbücher nicht selten ihren Schwerpunkt beim demokratischen Verfassungsstaat setzen, hängt insofern auch damit zusammen, dass sich dieser (erst) seitdem weltweit verbreitet hat. Damit steht zugleich fest: Keine Allgemeine Staatslehre kann zeitlose Geltung beanspruchen. Dazu hängen ihre Ergebnisse zu sehr an den sich verändernden empirischen Begebenheiten. Hier liegt der Grund, warum Hermann Heller auf den Zusatz „Allgemeine“ von vornherein verzichtete: „Dass also eine zeiträumlich ‚allgemeine‘ Staatslehre nicht erstrebt, weil gar nicht für möglich gehalten wird, soll schon im Titel dieser Arbeit zum Ausdruck gelangen.“[116] Entscheidend ist, dass man sich dieser eingeschränkten Bedeutung des Begriffs „Allgemeine“ bewusst ist, dass es also um eine Allgemeinheit im Jetzt und nicht um eine Allgemeinheit in der Zeit geht. Dann spricht nichts gegen dessen Verwendung (zumal sich diese Begrifflichkeit auch durchgesetzt zu haben scheint). Das bedeutet im Übrigen nicht, dass eine Allgemeine Staatslehre auf historische Betrachtungen jedweder Art verzichten müsste oder sollte. Sie werden allerdings nur dort erfolgen, wo es darum geht, typische Entwicklungen (etwa die Entstehung |19|und Ausbreitung des modernen Staates, den „normalen“ Ablauf von Revolutionen oder den Untergang von Staaten) durch historisch belegte Prozesse zu verdeutlichen, kurz: wo es „zum Verständnis der Gegenwart nötig ist.“[117]
Mit dieser zweiten Einschränkung hängt die letzte zusammen. Der universelle Anspruch der Allgemeinen Staatslehre sollte nicht überinterpretiert werden. Wer mit dem Ziel antritt, das Wesen des Staates zu ermitteln oder eine Theorie des Staates an sich[118] zu entwickeln, wird in einem gewissen Übereifer möglicherweise dazu neigen, bestehende Differenzen und Unterschiede zum Wohle der eigenen allgemeinen Theorie zu überspielen. Er oder sie zwängt die reale Staatenwelt dadurch in ein Prokrustesbett und verfehlt das Ziel einer empirisch zutreffenden Beschreibung des Status quo, die den Ausgangspunkt der Allgemeinen Staatslehre bilden muss. Ähnlich hält Christoph Möllers fest: „Die Rede vom ‚Staat‘ als solchem hat von vornherein Unterschiede im Namen eines vermeintlichen Idealtyps unterschlagen.“[119] Es gilt sich eine gewisse Offenheit für die Mannigfaltigkeit der heutigen Staatenwelt zu bewahren, die sich über Jahrhunderte nicht systematisch, sondern immer auch aufgrund historischer, kultureller und sozialer Zufälligkeiten und Pfadabhängigkeiten entwickelt hat. Voreilige Schlussfolgerungen können so vermieden werden. Auch die hier im Fokus stehenden demokratischen Verfassungsstaaten weisen eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten, aber eben auch an Unterschieden auf,[120] die nicht zu Gunsten einer möglichst einheitlichen Staatsidee allzu grobschlächtig übergangen werden dürfen. Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Erneut sei R. M. MacIver zitiert: „Practically all modern states are, in terms of the definition already given, democracies, but no two are quite alike in character.“[121]
Fußnoten
72
Ähnlich auch G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 10. Siehe auch M. Payandeh, Allgemeine Staatslehre, in: J. Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, § 4, Rn. 2. Eine solche „Besondere Staatslehre“ findet sich etwa bei H. H. von Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984. Ähnlich auch W. Heun, Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 2012 sowie U. Volkmann, Grundzüge einer Verfassungslehre der Bundesrepublik Deutschland, 2013. Siehe zu dieser Unterscheidung auch R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 35 ff.
73
Siehe K. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band II, S. 259: „Der einzige Weg, der den Sozialwissenschaften offensteht, besteht darin, […] die praktischen Probleme unserer Zeit mit Hilfe der theoretischen Methoden zu behandeln, die im Grunde allen Wissenschaften gemeinsam sind: mit Hilfe der Methode von Versuch und Irrtum, der Methode des Auffindens von Hypothesen, die sich praktisch überprüfen lassen, und mit Hilfe ihrer praktischen Überprüfung.“ Vgl. dazu auch J. Nasher, Die Staatstheorie Karl Poppers, S. 48 ff.
74
Vgl. auch R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 35 f.
75
G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 9 f.
76
G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 22: „Eine zweite Begrenzung unserer Aufgabe liegt darin, dass sie im wesentlichen nur die Erscheinungen der heutigen abendländischen Staatenwelt und deren Vergangenheit insoweit, als es zum Verständnis der Gegenwart nötig ist, als Forschungsobjekt betrachtet.“
77
R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 36.
78
R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 37.
79
H. Heller, Staatslehre, 2. Auflage, S. 27. Dieser Staat dürfte auch der Allgemeinen Staatslehre von Hans Kelsen zugrunde liegen.
80
Vgl. auch G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 23: „In solcher zeitlichen und räumlichen Beschränkung der Aufgabe liegt aber keineswegs eine Unvollkommenheit oder wenigstens eine größere als in allen auf historischem Boden erwachsenen Disziplinen.“
81
M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, S. 1 f.
82
Vgl. auch P. Mastronardi, Verfassungslehre, Rn. 173 f.
83
Knapp zu den Verfassungen der DDR A. Thiele, Der konstituierte Staat, S. 357 ff.
84
Vgl. dazu Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020, „In sickness and in health?“, 2021. Insgesamt hat die weltweite „Demokratiequote“ im Jahr 2020 erneut abgenommen – der globale Durchschnittswert fiel auf den niedrigsten Wert seit der ersten Erhebung im Jahr 2006, was zweifellos auch mit der Coronapandemie zusammenhing.
85
Vgl. auch R. M. MacIver, The Modern State, S. 343: „Democracy, it is true, is a matter of degree, and lines are hard to draw here as elsewhere.“
86
Georgien befindet sich gewissermaßen auf halber Strecke zwischen autoritärem Regime und Demokratie.
87
M. Welz, Afrika seit der Dekolonisation, S. 165.
88
Hongkong wird man zwar (noch) dazu zählen können, es gehört formal aber zur Volksrepublik China und ist daher nicht in diese Liste aufgenommen worden.
89
Siehe nunmehr aber J. Lempp/S. Mayer/A. Brand (Hrsg.), Die politischen Systeme Zentralasiens, 2020.
90
R. M. MacIver, The Modern State, S. 351.
91
J.-W. Müller, Furcht und Freiheit, S. 126. Siehe auch ders., Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit, S. 18.
92
Aus historischer Perspektive A. Thiele, Der konstituierte Staat, 2021.
93
Siehe auch T. Ö. Yildiz, Die Metaphorik des Neuen Autoritarismus, PVS 62 (2021), 253 (274): Die Türkei habe mit der neuen Verfassung „die Schwelle des full authoritarianism“ übertreten.
94
Gewöhnlich wird Allgemeine Staatslehre als „General Theory of State“ übersetzt.
95
Vgl. C. Möllers/L. Schneider, Demokratiesicherung in der Europäischen Union, S. 1: „Fast scheint es, als ginge eine Ära zu Ende.“ Siehe dazu auch A. Thiele (Hrsg.), Legitimität in unsicheren Zeiten. Der demokratische Verfassungsstaat in der Krise?, 2019; A. Voßkuhle, Europa, Demokratie, Verfassungsgerichte, S. 8 ff. Relativierend indes H. Richter, Moderne Wahlen, S. 571: „Missverstehen die Untergangsgesänge auf die Demokratie, die Postdemokraten und andere Vertreter einer reinen Lehre anstimmen, nicht schlicht den (notwendig) fiktionalen Charakter der Demokratie?“ Daran ist richtig, dass die Bewertung des Zustands der Demokratie nicht von einem idealisierten, sondern stets von einem realistischen Referenzmodell ausgehen sollte. Auch dann zeigen sich meiner Ansicht nach aber gewisse Krisensymptome, vgl. A. Thiele, Verlustdemokratie, S. 31 ff.
96
Vgl. A. Schäfer/M. Zürn, Die demokratische Regression, 2021. Allgemein zum (Begriff des) Populismus J.-W. Müller, Was ist Populismus?, 2016.
97
Dazu allgemein S. van Dyk/S. Graefe, Wer ist schuld am Rechtspopulismus?, Leviathan 47 (2019), 405 ff.; J. Zielonka, Counterrevolution. Liberal Europe in Retreat, 2018; S. Issacharoff, The corruption of popular sovereignty, ICON 18 (2020), 1109 ff. Speziell zu Ungarn und Polen siehe T. Drinóczi/A. Bień-Kacała, Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland, German Law Journal 20 (2019), 1140 ff.
98
A. Przeworski, Krisen der Demokratie, S. 10.
99
Dazu ausführlich auch A. Thiele, Verlustdemokratie, 2. Auflage 2018. Siehe auch M. Nussbaum, Königreich der Angst, 2019 sowie W. Streeck, Zwischen Globalismus und Demokratie, S. 22 f.
100
H. A. Winkler, Zerbricht der Westen?, S. 403.
101
A. Schäfer/M. Zürn, Die demokratische Regression, S. 12.
102
A. Bogner, Die Epistemisierung des Politischen, S. 37.
103
J.-W. Müller, Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit, S. 7. Müller zieht diese pauschale Aussage anschließend allerdings wenigstens partiell in Zweifel.
104
C. Lafont, Unverkürzte Demokratie, S. 415.
105
Vgl. auch A. Reckwitz, Das Ende der Illusionen, S. 239.
106
Siehe dazu etwa den von H. Geiselberger herausgegebenen Band „Die große Regression“ (2. Auflage 2017); E. Hillebrand (Hrsg.), Rechtpopulismus in Europa, 2017; Y. Mounk, Der Zerfall der Demokratie, 2018; S. Levitsky/D. Ziblatt, How Democracies Die, 2018; Z. Bauman, Retrotopia, 2017; C. Koppetsch, Die Gesellschaft des Zorns, 2019; A. Thiele (Hrsg.), Legitimität in unsicheren Zeiten, 2019; U. Volkmann, Krise der konstitutionellen Demokratie?, Der Staat 58 (2019), 643 ff.; A Przeworski, Krisen der Demokratie, 2020; P. Manow, (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, 2020; A. Schäfer/M. Zürn, Die demokratische Regression, 2021.
107
M. G. Schmidt, Über die Demokratie in Europa, ZSE 2017, 529 (548).
108
Vgl. A. Bogner, Die Epistemisierung des Politischen, S. 37.
109
A. Schäfer/M. Zürn, Die demokratische Regression, S. 10 ff. Sie zeigen im Übrigen auch auf, dass populistische Entwicklungen sich tatsächlich negativ auf die Demokratiequalität auswirken, siehe aaO, S. 167 ff.
110
P. Manow, Die politische Ökonomie des Populismus, 2018.
111
Eine umfassende Analyse der Verfassungstheorie autoritärer Staaten findet sich bei G. Frankenberg, Autoritarismus. Verfassungstheoretische Perspektiven, 2020.
112
R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 36 f. Zu weit daher C. Starck, Allgemeine Staatslehre in Zeiten der Europäischen Union, in: ders. (Hrsg.), Woher kommt das Recht, S. 353 (354) und auch P. Mastronardi, Verfassungslehre, Rn. 128.
113
Dazu G. Balandier, Politische Anthropologie, 1976.
114
Siehe zuletzt etwa auch A. Mittnik et. al., Kinship-based social inequality in Bronze Age Europe, Science 2019, 1 ff.
115
M. Kriele, Einführung in die Allgemeine Staatslehre, S. 5.
116
H. Heller, Staatslehre, 2. Auflage, S. 3.
117
G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 22.
118
So H. H. von Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, S. 1.
119
C. Möllers, Der vermisste Leviathan, S. 116.
120
Beispielhaft sei auf Großbritannien und Deutschland verwiesen, die zwar beide als parlamentarische Regierungssysteme organisiert sind, sich in ihrer politischen Ordnung und Kultur aber erheblich unterscheiden. Das wurde sowohl bei den Brexit-Verhandlungen als auch bei der Bekämpfung der Coronapandemie sehr deutlich.
121
R. M. MacIver, The Modern State, S. 351. Siehe auch C. Möllers, Der vermisste Leviathan, S. 116: „Nur die Suche nach Unterschieden gestattet aber den Vergleich, der dann wiederum zur Entdeckung von Ähnlichkeiten führen kann – und erst ein Vergleich kann wirklich theoriefähiges Material bereitstellen.“
|20|IV. Ein Definitionsvorschlag
Versuchte man dieser beschreibenden Erläuterung eine knappe Arbeitsdefinition des Forschungsgebietes Allgemeine Staatslehre anzufügen, so könnte diese unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen folgendermaßen lauten:
Bei der Allgemeinen Staatslehre handelt es sich um eine anspruchsvolle, interdisziplinäre Seins- und Sollenswissenschaft, die deskriptiv-analytische, normative und kritische Elemente zur möglichst erschöpfenden Erfassung des Staates – insbesondere seines Handelns, seiner Steuerungsfähigkeit, seiner Steuerungstechniken, seiner Leistungsfähigkeit aber auch seiner Leistungsgrenzen und denkbarer Alternativmodelle – miteinander verknüpft. Ihr Erkenntnisinteresse reicht über einen bestimmten Staat hinaus, sie zielt ihrer Idee nach darauf ab, Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede sämtlicher bestehenden Staaten in diesem Sinne zu ergründen. Dieser universelle Anspruch führt angesichts der Vielfalt an modernen Staaten sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf die tatsächlich untersuchten Staaten zu einer notwendigen Beschränkung auf den demokratischen Verfassungsstaat, die letztlich nur begrenzt vorgegeben ist und von den Vorlieben des jeweiligen Akteurs abhängt.
[Zum Inhalt]
|21|B. Zur Möglichkeit einer Allgemeinen Staatslehre
im 21. Jahrhundert
„Für das Staatsrecht bedeutet das: Nachfragen bei Nachbardisziplinen sind erforderlich, sie verdichten sich aber kaum zu einer neuen wissenschaftlichen Form, der Staatslehre, die den Staat als Ganzes erfassen kann.“
Christoph Möllers [122]
„Staatstheorie sollte nicht so sehr als konturenscharfe Subdisziplin angelegt werden, sie muss eher netzwerkartig institutionalisiert werden, als Unternehmen mit ausgefransten Rändern.“
Thomas Vesting [123]
Ist eine Allgemeine Staatslehre im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß? Ist sie überhaupt möglich? In den letzten Jahren mehren sich die Stimmen, die diese Fragen vorsichtig, bisweilen auch sehr deutlich verneinen. Wer sich daran macht, eine weitere (neue) Allgemeine Staatslehre vorzulegen oder in diesem Gebiet zu forschen, wird sich dieser Kritik stellen und darlegen müssen, warum er sie für nicht überzeugend hält (oder jedenfalls für nicht überzeugend genug, um sie oder ihn von dem Vorhaben abzuhalten). Die Kritikpunkte setzen an allen beschriebenen Merkmalen einer Allgemeinen Staatslehre an: Bei ihrem Gegenstand (I), der Interdisziplinarität und (fehlenden) Methode (II) sowie ihrem universellen Anspruch (III).
Fußnoten
122
C. Möllers, Staat als Argument, S. 419.
123
T. Vesting, Staatstheorie, Rn. 39.
I. Verliert die Allgemeine Staatslehre ihren Gegenstand?
Der erste Einwand betrifft den Untersuchungsgegenstand: Den modernen Staat der Neuzeit. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung, Supranationalisierung[124] und Individualisierung im Zeitalter der |22|Postmoderne[125] handele es sich bei diesem um ein Auslaufmodell.[126] Zur Lösung globalisierungsbedingter Problemlagen – zu nennen wären beispielhaft Klimaschutz, Migration, aber auch Fragen der internationalen ökonomischen Ordnung[127] – sei der moderne Staat nicht mehr in der Lage, weil die erforderliche Kongruenzbedingung nicht mehr erfüllt sei: Der zu regelnde Handlungsraum gehe über den demokratisch regelbaren (politischen) Raum hinaus.[128] Der moderne Staat habe damit die ihn bisher prägende Souveränität[129] verloren,[130] auch weil die Organisationsmacht gesellschaftlicher Herrschaftsverbünde (nicht zuletzt multinationale Großunternehmen) diese nicht mehr zulasse,[131] kurz: Der moderne Staat befinde sich „in Auflösung“.[132] Zygmunt Bauman behauptete schon im Jahr 1992, dass sich analytische Modelle der Postmoderne und im Zeitalter der „Globalität“[133] nicht mehr am Staat ausrichten ließen.[134] Dieser sei als Analyserahmen nicht mehr ausreichend zur angemessenen Beschreibung der entscheidenden Faktoren des vielfältigen, interaktiven und dynamischen postmodernen sozialen Lebens.[135] Ähnlich hat unlängst Udo Di Fabio argumentiert, und dafür plädiert, „politische Herrschaft wieder staatsfrei zu denken“.[136] Erste Verfallserscheinungen |23|diagnostizierten zuvor bereits Carl Schmitt und Ernst Forsthoff (was allerdings vornehmlich mit ihrem Staatsverständnis zusammenhing). Wird man heute damit von einer „poststaatlichen“ Ära sprechen müssen? Wird der moderne Staat zu einem Akteur unter vielen? Und wird dem Projekt einer Allgemeinen Staatslehre dadurch die Legitimation entzogen, da deren Perspektive als zu eng angesehen werden muss?[137] Ist moderne Staatlichkeit, ist der Staat am Ende?
Die besseren Gründe sprechen dafür, diese Fragen zu verneinen.[138] Die beobachteten Auflösungserscheinungen dürften vielmehr (auch zeitbedingt)[139] in ihrer Bedeutung überzeichnet und mit einem tatsächlich nicht eingetretenen Souveränitätsverlust verwechselt worden sein. Mit anderen Worten: Der (souveräne) moderne Staat lebt und es gibt wenige Anzeichen dafür, dass sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ändern würde.[140] Eine stets auf die Gegenwart bezogene Allgemeine Staatslehre verliert deshalb nicht ihre Berechtigung.
Zur Zurückweisung der Auflösungsthese reicht es nicht aus, allein auf die entgegenstehende Alltagserfahrung[141] und die große Zahl an Staaten zu verweisen, die Mitglied der Vereinten Nationen sind – eine Zahl, die in den nächsten Jahren eher steigen denn fallen dürfte, wenn man vereinzelte Sezessionsbestrebungen (Katalonien, Baskenland, Schottland, Kurdenbewegung, Québec) berücksichtigt. Zwar wird man daraus auf eine fortbestehende Attraktivität des bisherigen Modells „Staat“ schließen können; das Ziel der Sezessionsbemühungen ist stets die Errichtung eines neuen Staates in Form eines modernen Staatswesens. Jedoch behauptete die Auflösungsthese nie ernsthaft, dass Staatlichkeit schon in naher Zukunft gänzlich aufhören würde. Es ging ihr nie um eine formelle, sondern stets um eine materielle Auf- beziehungsweise Ablösung des modernen Staates durch schleichenden Aufgaben- und Steuerungsverlust und zunehmende globalisierungsbedingte Komplexität: „Als heutige Symptome der schleichenden Krankheit des |24|Staates zum Tode werden die Globalisierung und Europäisierung (hier), die Regionalisierung oder Transnationalisierung (anderswo), im Innern die noch schwieriger zu fassenden Prozesse der Individualisierung, Pluralisierung und De-Institutionalisierung diagnostiziert.“[142]
Solche Verlusterscheinungen und damit einhergehende „Enthierarchisierungstendenzen“[143] wird man der Sache nach nicht leugnen können. Ein einfaches „Durchregieren“ des modernen Staates ist in vielen Bereichen, vor allem aber im Wettbewerb der internationalen Wirtschaftsordnung nur noch schwer möglich. Der Staat ist eingebettet in ein vielschichtiges, verzweigtes und im Detail auch undurchsichtiges Herrschaftsgefüge aus formellen und informellen Institutionen und Akteuren.[144] Entscheidungen, die in manch informellem Gremium getroffen werden, haben nicht selten größere Auswirkungen auf den Einzelnen als im parlamentarischen Raum in transparenter Form verabschiedete formelle Gesetze (man denke an die vielfältigen informellen Gremien der internationalen Wirtschaftsordnung wie den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht).[145] Gerade den modernen Staat, der seit jeher „Steuerstaat“ ist, stellt es zudem vor enorme Herausforderungen, wenn Unternehmen ihre Steuerlast durch Konzernverlagerungen ins Ausland oder durch komplexe Steuersparmodelle (mehr oder weniger legal) zu reduzieren vermögen.[146] Es zeigt sich, dass die seit dem Ende des Kalten Krieges weltweit propagierte Liberalisierung und Deregulierung[147] mit einem staatlichen Steuerungsverlust einhergeht – nicht zuletzt wenn es um sozialstaatlich motivierte Umverteilungen geht. Gleiches gilt dort, wo staatliche Aufgaben privatisiert oder über PPP-Projekte[148] auf die vermeintlich effizienteren Strukturen „der Märkte“ übertragen werden: Wenn dem Staat Aufgaben genommen werden, |25|verringert sich sein Einfluss auf das ökonomische, soziale und kulturelle Zusammenleben.
Dennoch ist es nicht überzeugend, von dieser Entwicklung auf das Ende des modernen und souveränen Staates schließen zu wollen. Schon der Blick in die Geschichte zeigt, dass es den vollständig souveränen Staat im Bodin’schen Sinne – also einen in jeder Hinsicht freien und von äußeren Einflüssen autarken „Leviathan“ – zu keinem Zeitpunkt gegeben hat.[149] Staatliche Souveränität (ohnehin ein nur schwer zu greifender und weiterhin umstrittener Begriff)[150] war schon immer eine Fiktion,[151] die der „reale“ moderne Staat nie umfassend erfüllte und die bei den einzelnen Staaten zudem unterschiedlich ausgeprägt war – ein Befund, der auch heute noch Geltung beanspruchen dürfte.[152] Auch Formen der Überstaatlichkeit lassen sich, wie zuletzt Ferdinand Weber gezeigt hat, schon für das frühe 19. Jahrhundert als der vermeintlichen Hochzeit des modernen Staates nachweisen.[153] Die modernen Staaten kennzeichnete mithin seit jeher eine variable oder schwankende Souveränität; sie waren mal stärker mal schwächer, mal dominanter mal abhängiger, aber stets: Staaten. Die vermeintlichen Souveränitätseinbußen erschienen womöglich gerade in den 90er Jahren mit dem Erstarken multinationaler Konzerne und den damit einhergehenden politischen („staatlichen“) Steuerungsverlusten gravierend – die Konsequenzen hat Colin Crouch in seiner unlängst aktualisierten „Postdemokratie“ prominent beschrieben.[154] Gleichwohl handelte es sich um kein prinzipiell neues Phänomen, keinen qualitativen, sondern allenfalls um einen quantitativen Sprung, der nicht automatisch mit dem Ende des modernen Staates gleichgesetzt werden sollte.[155]