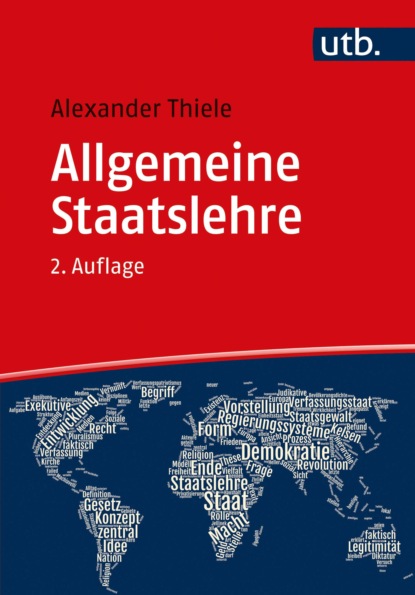- -
- 100%
- +
Entscheidender sind aber zwei Einwände. So zeigt sich erstens die fortbestehende Bedeutung und Notwendigkeit staatlicher Strukturen dort, wo diese mehr oder weniger fehlen, wo der Staat also entweder im Zerfallen |26|begriffen oder sogar bereits zerfallen ist. In Staaten wie Somalia, dem Jemen, Simbabwe oder Libyen herrschen so prekäre und zum Teil kriegsähnliche Zustände, weil mit dem Untergang des Staates keine anderen Herrschaftsstrukturen an dessen Stelle getreten sind, die für die notwendige Ordnung hätten sorgen können.[156] Welche hätten das in diesen Fällen auch sein können? Das Völkerrecht hat solchen Entwicklungen nichts oder nur wenig entgegenzusetzen und kann aus sich heraus keine ordnende Struktur gestalten. Ähnliches gilt in Sierra Leone oder Afghanistan, wo nach dem Abzug der Alliierten Mitte 2021 die Taliban innerhalb weniger Wochen wieder die Macht an sich reißen konnten. Staatenlosigkeit bleibt damit „für jedermann auch weiterhin eine beängstigende Vorstellung“.[157] Die Auflösungserscheinungen staatlicher Souveränität sind nur bis zu einem gewissen Grade ertragbar und setzen voraus, dass der sich auflösende Staat in seinen Kernfunktionen (Friedenssicherung und Bereitstellung der fundamentalen Infrastruktur) funktionsfähig bleibt. Wo der Staat aufhört, hört auch die Freiheit auf. Die Auflösung des Staates findet damit im funktionsfähigen Staat Grundlage und Grenze. Paradoxerweise wird die Diskussion und wissenschaftliche Auseinandersetzung über das Ende des Staates und seine Auflösung auch ausschließlich in Staaten geführt, in denen die grundlegenden staatlichen Strukturen die erforderliche Funktionsfähigkeit zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Freiheit aufweisen. Überspitzt formuliert: Über die langsame Auflösung des Staates und sein Aufgehen in überstaatlichen Strukturen (nicht zuletzt die Europäische Union) nachzudenken, kann sich nur erlauben, wer in einem halbwegs funktionierenden Staatswesen lebt. Dieser Befund bestätigt zugleich, dass wir auf ein solches zumindest aktuell (noch) nicht verzichten können und nicht verzichten wollen. Das zeigten auch die Debatten, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise seit 2015 aufkamen. Wo staatliche Strukturen tatsächlich oder vermeintlich bedroht wurden, wurde versucht, entsprechende Bedrohungen umgehend abzuwehren und Staatlichkeit (und Staatsgrenzen) zu sichern.[158]
Mit dieser weiterhin ordnenden Funktion des Staates hängt der zweite Einwand zusammen. In den letzten Jahren zeigt sich, dass ein beachtlicher Teil der skizzierten Steuerungsverluste auf einem freiwilligen Rückzug des Staates beruhte:[159] Es war der Staat, der Zuständigkeiten und |27|Steuerungsmöglichkeiten abgab, nicht die Globalisierung, die sie sich nahm. Es handelte sich um keinen natürlichen, passiven und unumkehrbaren Erosionsprozess, sondern um eine vornehmlich auf neoliberalen Vorstellungen beruhende, bewusste, aktive politische Entscheidung – getroffen von im Grundsatz voll funktionsfähigen (souveränen) Staaten.[160] Es erscheint damit schon im Ansatz fraglich, ob es sich als sinnvoll erweist, von Souveränitätsverlusten zu sprechen, wo es häufig nur um die möglicherweise extern motivierte, aber formal gleichwohl freiwillige Abgabe von Hoheitsrechten geht und es an den Staaten selbst liegt, diese – sofern erwünscht – wieder rückgängig zu machen.[161] „Sie [die Globalisierung, A. T.] ist vor allem auch politisch gestaltbar, zähmbar“[162] und zwar, so wäre zu ergänzen, durch den stets vorhandenen Staat selbst.[163] „Deglobalisierung“ ist möglich, da der Staat im Hintergrund weiterhin latent vorhanden ist (was im Übrigen auch von den neoliberalen Akteuren nicht geleugnet wird, wenn sie „bei jedem auffälligen Marktversagen, wie eben den einstürzenden Finanzmärkten, nach staatlicher Unterstützung“[164] rufen). Dass eine solche Rückgängigmachung nicht nur eine theoretische Option, sondern auch praktisch durchführbar ist, zeigte sich seit 2016 gleich mehrfach: Die USA verkündeten nicht nur den Austritt aus dem Klimaabkommen, sondern kündigten zudem Freihandelsabkommen oder stellten diese in Frage und setzten mit Donald Trump vermehrt auf unilaterale Entscheidungen und weniger auf internationale Kooperation. Das Vorgehen Großbritanniens offenbarte, dass nicht einmal vermeintlich „auf Ewigkeit errichtete“ supranationale Organisationen vor dem (souveränen) Staat sicher |28|sind.[165] Es hat mit Ablauf des 31. Januar 2020 (gefolgt von einer zum 1.1.2021 abgelaufenen Übergangsphase)[166] die Europäische Union verlassen – einen im weltweiten Maßstab ohnehin rein regionalen Zusammenschluss:[167] „Taking back Control“, Wiedererlangung der abgegebenen Hoheitsrechte (nicht aber der im Hintergrund stets vorhandenen Souveränität), bildete in beiden Fällen das Leitmotiv. Die Vorgänge in anderen Staaten zeigen, dass diese Beispiele Nachahmer finden könnten, da die sozialen Auswirkungen der Globalisierung zunehmend skeptisch gesehen und bisweilen heftig kritisiert werden. Hier wird man einen wesentlichen Grund für das Erstarken rechtspopulistischer Strömungen in den meisten demokratischen Verfassungsstaaten finden können. Ohnehin dürfte es kein Zufall sein, dass entsprechende Renationalisierungstendenzen gerade zu einem Zeitpunkt auftreten, in denen das international globalisierte (wirtschaftliche) System dem Versprechen weltweiter Prosperität bei sozialer Gerechtigkeit nicht in ausreichender Form nachkommt.[168] Große Teile der Bevölkerung wenden sich dann wieder zum Staat, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit – allerdings unter heute nicht mehr gültigen Rahmenbedingungen[169] – mit einer ausgewogenen Balance zwischen Markt und Sozialstaat schon einmal bewiesen hat, dass er diese Aufgabe zu bewerkstelligen vermag.[170] Diese bereits seit einigen Jahren zu konstatierende Rückkehr des Staates hängt insofern eng mit der defizitären (sozialen) Leistungsfähigkeit der sich seit den 90er Jahren entwickelnden internationalen Ordnung zusammen und hat damit (bei allem unseriösen, verstörenden und mittlerweile beendeten[171] „Getwittere“ eines Donald Trump) einen rationalen und nachvollziehbaren Ausgangspunkt. Die Legitimität jeder Herrschaftsordnung hängt unter anderem von (sozialen) Output-Elementen, von der Verwirklichung materieller Gerechtigkeit ab.[172] Es verwundert daher nicht, wenn der lange so vehement propagierte Rückzug des Staates auch „staatsintern“ |29|zunehmend kritisch gesehen wird, da der Rückgriff auf die „effizienten Märkte“ auch hier nicht zu den Ergebnissen geführt hat, die man sich in sozialer Sicht möglicherweise erhofft hat – die Stichworte „Rekommunalisierung“ und „sozialer Wohnungsbau“ sollen an dieser Stelle genügen. In den Jahren 2020/2021 war es schließlich die Coronapandemie, die verdeutlicht hat, welche Einflussmöglichkeiten der moderne Staat weiterhin hat:[173] Milliarden von Menschen wurden in den Lockdown geschickt, das kulturelle und soziale Leben kam mehr oder weniger zum Stillstand, Grenzen wurden geschlossen. Auch Steffen Mau hält daher zutreffend fest: „Der Staat ist kein Statist der Globalisierung, kein schwacher, ohnmächtiger Akteur, der den Phänomenen der Grenzüberschreitung nur unbehelligt zuschauen kann. Ganz im Gegenteil: Seine oft verborgene und zurückgenommene Macht trat in der Pandemie unübersehbar hervor.“[174] Von diesem pandemiebedingten staatlichen Zugriff blieb auch die internationale Wirtschaftsordnung nicht verschont – auch diese beruht nicht auf Naturgesetzlichkeiten, sondern auf politischen und damit umkehrbaren Entscheidungen.[175] Wer sie erhalten will, muss sich auf die politische Debatte einlassen; die Ausgestaltung der Handelsbeziehungen versteht sich nicht von selbst, die Staaten können frei entscheiden, inwieweit sie an ihnen partizipieren oder ihnen gar eine völlig andere Struktur geben wollen.
Man mag diese Wiederbelebung des (souveränen) Staates aufgrund der neuartigen und zweifellos sozial ungerecht ausgestalteten Abschottungstendenzen[176] ablehnen – der späte Zygmunt Baumann sprach kritisch von einem „Zeitalter der Nostalgie“[177] in das wir eingetreten sind – und daher für dessen Überwindung eintreten.[178] Allein gegenwärtig ist der Staat weiterhin auch im Innern der bedeutendste politische Akteur,[179] oder mit Erhard Eppler: „Das nächstbessere Modell hat noch niemand entworfen“.[180] Die Vorstellung, dass die Globalisierung mit der umfassenden Aufhebung nationaler Grenzen |30|einhergehen würde, war ohnehin zu pauschal und richtete den Blick zu einseitig-idealistisch auf wenige privilegierte Bevölkerungsgruppen des globalen Nordens.[181] Es geht aktuell damit also weniger um die Überwindung des modernen Staates als um die Einhegung eines destruktiven und autoritären Nationalismus,[182] der mit dem modernen Staat zwar zusammengehen kann, aber nicht zusammengehen muss[183] – das beweist der Blick in die Historie. Der Nationalismus ist wie der Nationalstaat eine Idee des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, als der moderne Staat längst etabliert war.[184] Gerade dem demokratischen Verfassungsstaat ist es zuzutrauen, die Geißel des feindseligen Nationalismus, dessen zerstörerische Kraft sich in zwei Weltkriegen und zahlreichen weiteren Auseinandersetzungen auf so schreckliche Weise offenbart hat,[185] dauerhaft zu zähmen. Unlängst hat Yascha Mounk dazu die Etablierung eines „inklusiven Patriotismus“ vorgeschlagen.[186] An anderer Stelle habe ich das Konzept des denationalisierten demokratischen Verfassungsstaates entworfen, einen „Staat ohne Nation“, in dem Nation und Nationalismus als letzte sakrale Elemente von der staatlichen in die private Sphäre verbannt werden.[187] Die (wissenschaftliche und praktische) Überzeugungskraft dieser und anderer Konzepte wird sich zeigen. Erinnert sei aber daran, dass auch der säkulare demokratische Verfassungsstaat, der „Staat ohne Gott“,[188] über Jahrhunderte reifen musste. An dieser Stelle war allein darzulegen, dass die Überwindung des modernen Staates (wenn überhaupt) ein Zukunfts- und jedenfalls kein Gegenwartsthema ist, das gegen eine im Jetzt ruhende Allgemeine Staatslehre vorgebracht werden könnte. Der moderne Staat hat seine Bedeutung als weltweiter politischer Primärraum noch nicht verloren und |31|wird sie auf absehbare Zeit nicht verlieren. Wer sich schon Anfang der 90er Jahre auf dem Weg in eine friedvolle „post-hobbesianische“ politische Ordnung wähnte,[189] sieht sich getäuscht: „From the surge of populist discontent to the backlash against supranational courts and challenges to the multilateral architecture of the post-war international order, the demise of the state prophesied by earlier literature appears to have been, like the rumours about Mark Twain’s death, greatly exaggerated.“[190] So wie das vielzitierte „Ende der Geschichte“[191] ist auch das „Ende des modernen Staates“[192] zu früh ausgerufen worden[193] – dass beide Thesen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges in einer Zeit der weitverbreiteten (aber mit Jan-Werner Müller keineswegs allgemein-umfassenden)[194] Hoffnung artikuliert und vertreten wurden, dürfte im Übrigen kein Zufall sein.
Eine moderne Allgemeine Staatslehre muss die geschilderten transformatorischen Veränderungen und den damit einhergehenden Wandel von Staatlichkeit,[195] den „Staat als Prozess“[196] selbstverständlich aufnehmen und verarbeiten.[197] Sie kommt nicht ohne Abschnitte zur Internationalisierung, zur Supranationalisierung[198] und zu gesellschaftlichen Machtverschiebungen aus[199] – in der Coronapandemie kam zuletzt verstärkt die Frage auf, welche Rolle ExpertInnen in einer Demokratie zukommen sollte (beziehungsweise |32|darf)[200] – und muss sich zudem zu (vermeintlichen) globalisierungsbedingten Steuerungsverlusten verhalten:[201] Bedarf es als Antwort möglicherweise mehr Supranationalisierung? Wie verhält sich die Abgabe von Befugnissen an entsprechende Organisationen zur Legitimität der staatlichen Ordnung? Wie können Verlierer der Globalisierung ansprechend entschädigt werden? Festzuhalten aber bleibt: Ihren Gegenstand als solchen hat die Allgemeine Staatslehre bisher nicht verloren,[202] die räumlich-fundierte Staatsgewalt hat ihre zentrale Bedeutung nicht eingebüßt.[203] Es geht mithin darum „den evidenten Wandel von Staatsaufgaben, des Staatsverständnisses, der Staatsfinanzierung und einzelner Staatsfunktionen usw. näher zu beschreiben und zu analysieren“[204] und, so wäre zu ergänzen, auch zu kritisieren. Welche Rolle kann ein gewandelter, „offener“ moderner Staat im Zeitalter der Globalisierung spielen und welche Rolle sollte er – auch und gerade für die Gestaltung der Wirtschaftsordnung[205] – spielen? Diese Aufgabe kann der Allgemeinen Staatslehre schon deshalb gut gelingen, weil ihr zu keinem Zeitpunkt ein einheitlicher, abgeschlossener und Veränderungen nicht zugänglicher Staatsbegriff zugrunde lag. Wie Andreas Voßkuhle festgestellt hat, hätten weder Hermann Heller (Staat als organisierte Entscheidungs- und Wirkungseinheit) noch Hans Kelsen (Staat als Rechtsordnung) größere Probleme damit gehabt, die geschilderten Entwicklungen in ihre Staatslehre zu integrieren.[206] Für Carl Schmitt oder auch Ernst Forsthoff gilt das freilich nicht.
Fußnoten
124
Das gilt natürlich im Besonderen für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
125
Dazu etwa A. Reckwitz, Gesellschaft der Singularitäten, 2017.
126
Vgl. S. Breuer, Der Staat, S. 10: „Im Zuge seiner Eingliederung in internationale Ordnungen und Vertragswerke hat der souveräne Nationalstaat darüber hinaus so viele seiner Kompetenzen abgeben müssen, dass manche Beobachter sein Ende einläuten.“ Historisch ist die These vom Ende des Staates freilich keine neue, vgl. A. Benz, Der moderne Staat, S. 259 ff.
127
Vgl. auch S. Hobe, Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und Interdependenz, S. 25.
128
Vgl. M. Zürn, Schwarz-Rot-Grün-Braun: Reaktionsweisen auf Denationalisierung, in: U. Beck, Politik der Globalisierung, S. 297 (298, 326). Siehe auch C. Crouch, Postdemokratie revisited, S. 25.
129
Zum Konzept der Souveränität knapp H. Zapf, Souveränität – Ideengeschichtliche Genese, Krisendiagnosen und Herausforderungen, in: L. Bahmer u.a., Staatliche Souveränität im 21. Jahrhundert, S. 1 ff.
130
Siehe auch die Hinweise auf Literatur bei R. Hirschl/A. Shachar, Spatial Statism, ICON 17 (2019), 387 (387 f.).
131
Vgl. dazu auch S. Oeter, Souveränität ein überholtes Konzept, in: Festschrift für Helmut Steinberger, S. 259 (259 f.). Oeter sieht in der Idee der Souveränität im Ergebnis allerdings gerade aus der Perspektive des Völkerrechtlers kein überholtes Konzept. Siehe auch C. Crouch, Postdemokratie revisited, S. 26.
132
E. Grande, in: Auflösung, Modernisierung oder Transformation? Zum Wandel des modernen Staates in Europa, in: E. Grande/R. Prätorius (Hrsg.), Modernisierung des Staates?, S. 45 (58). Siehe auch C. Starck, Allgemeine Staatslehre in Zeiten der Europäischen Union, in: ders. (Hrsg.), Woher kommt das Recht, S. 353 (353).
133
M. Albrow, Abschied vom Nationalstaat, S. 14.
134
Z. Bauman, Intimations of Postmodernity, S. 65. Zustimmend M. Albrow, Abschied vom Nationalstaat, S. 14.
135
Z. Bauman, Intimations of Postmodernity, S. 65.
136
U. Di Fabio, Herrschaft und Gesellschaft, S. 3. Kritische Besprechung bei W. Knöbl, Besprechung von Udo Di Fabio, Herrschaft und Gesellschaft, Der Staat 58 (2019), 485 ff.
137
In diese Richtung zuletzt auch U. Di Fabio, Herrschaft und Gesellschaft, 2018, wo er darlegt, warum der Staat zwar wichtig, aber nicht immer das Zentrum politischer Herrschaft sei. Siehe andererseits T. Vesting, Staatstheorie, 2018.
138
Wie hier im Ergebnis auch A. Benz, Der moderne Staat, S. 266, der der These des Niedergangs des modernen Staates diejenige des Strukturwandels des Staates entgegensetzt sowie Q. Skinner, Thomas Hobbes und die Person des Staates, S. 12. Siehe auch R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 417; M. Payandeh, Allgemeine Staatslehre, in: J. Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, § 4, Rn. 30.
139
Vgl. A. Bogner, Die Epistemisierung des Politischen, S. 38.
140
Vgl. auch Q. Skinner, Thomas Hobbes und die Person des Staates, S. 13 sowie R. Hirschl/A. Shachar, Spatial Statism, ICON 17 (2019), 387 ff.
141
Diese Feststellung bildet denn auch bei Q. Skinner, Thomas Hobbes und die Person des Staates, S. 12 nur den Ausgangspunkt für seine Widerlegung der These vom Ende des Staates.
142
G. Frankenberg, Staatstechnik, S. 62 f. Ernst Forsthoff sah dadurch zwar den klassischen souveränen Staat am Ende, sprach sich aber zugleich für die Entwicklung eines realitätsnahen, neuen Staatsbegriffs aus, vgl. E. Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft, S. 25.
143
A. Voßkuhle, Die Renaissance der Allgemeinen Staatslehre im Zeitalter der Europäisierung und Internationalisierung, JuS 2004, 2 (3).
144
Siehe auch Q. Skinner, Thomas Hobbes und die Person des Staates, S. 12. Zur allgemeinen Überforderung moderner, arbeitsteiliger und pluralistischer Gesellschaften A. Nassehi, Unbehagen, 2021.
145
Zu diesem und anderen International Standard Setting Bodies (ISSB) im Überblick A. Thiele, Finanzaufsicht, S. 552 ff.
146
Vgl. auch Q. Skinner, Thomas Hobbes und die Person des Staates, S. 10 f. Siehe auch R. Hirschl/A. Shachar, Spatial Statism, ICON 17 (2019), 387 (436). Umfassend auch E. Saez/G. Zucman, The Triumph of Injustice. How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay, 2019.
147
Vgl. kritisch E. Eppler, Auslaufmodell Staat?, S. 88 ff.
148
PPP steht für „Public-Private-Partnership“ und meint Kooperationen des Staates mit der Privatwirtschaft (etwa bei großen Infrastrukturprojekten).
149
Siehe auch J. Finke, Was heißt es, souverän zu sein?, in: L. Bahmer u.a. (Hrsg.), Staatliche Souveränität im 21. Jahrhundert, S. 89 (101): „Souveränität als faktische Unabhängigkeit und Autonomie – ob nun von anderen Staaten, Unternehmen oder internationalen Organisationen – hat es nie gegeben.“
150
Vgl. dazu U. Di Fabio, Der Verfassungsstaat in der Weltgesellschaft, S. 89 ff.
151
Vgl. auch H. Dreier, Idee und Gestalt des freiheitlichen Verfassungsstaates, S. 115.
152
Schon innerhalb der Europäischen Union bestehen diesbezüglich gewiss erhebliche Differenzen, wenn man an Staaten wie Deutschland oder Frankreich einerseits und Malta oder Luxemburg andererseits denkt.
153
F. Weber, Überstaatlichkeit als Kontinuität und Identitätszumutung, JÖR 66 (2018), 237 ff. Siehe auch dessen Fazit, aaO, S. 296: „Fragt man beim derzeitigen Mitgliederbestand nach der Finalität des Integrationsprozesses, spricht viel dafür, Überstaatlichkeit nicht als Zwischenstadium zur Überwindung vorhandener, sondern als Ergänzung und Vitalisierung kooperativer, offener Staatlichkeit zu sehen.“
154
C. Crouch, Postdemokratie, 2008; ders., Postdemokratie revisited, 2021.
155
Siehe auch G. Frankenberg, Staatstechnik, S. 43 ff.
156
Vgl. auch E. Eppler, Auslaufmodell Staat?, S. 75.
157
Q. Skinner, Thomas Hobbes und die Person des Staates, S. 13.
158
Und auch in solchen Staaten wird über eine solche Auflösung nur selten, wenn überhaupt jemals, diskutiert, vgl. E. Eppler, Auslaufmodell Staat?, S. 211: „Der Traum von einem Europa, in dem die Nationalstaaten aufgehen wie Zucker im Kaffee, haben ohnehin fast nur Deutsche geträumt. Für Briten, Franzosen, Italiener oder Spanier kam dies nie in Frage.“
159
Vgl. M. van Creveld, Aufstieg und Untergang des Staates, S. 459.
160
Siehe auch J. Reifenberger, Neoliberalismus, Krise und Zukunft des demokratischen Sozialstaats, S. 95: „Durch den gewollten und freiwilligen Verzicht auf sozialstaatliche, fiskalische und ordnungspolitische Machtinstrumente wurde der ‚Zwang zur Anpassung an die Gewinnerwartungen globaler Märkte‘ erst erzeugt. Die ‚Globalisierung, die etwas erzwingt‘ ist ebenso wenig naturgegeben, wie ein ‚Krieg der ausbricht‘.“ Ähnlich auch W. Streeck, Zwischen Globalismus und Demokratie, S. 396: Globalisierung ist „kein Natur-, sondern ein politisches Ereignis.“
161
Vgl. auch U. Di Fabio, Der Verfassungsstaat in der Weltgesellschaft, S. 92: „Doch mit der konzeptionellen Selbstbindung ist nicht die Souveränität übertragen worden.“
162
U. Beck, Wie wird Demokratie im Zeitalter der Demokratie möglich? – Eine Einleitung, in: ders., Politik der Globalisierung, S. 7 (22).
163
W. Streeck, Zwischen Globalismus und Demokratie, S. 397.
164
G. Frankenberg, Staatstechnik, S. 44. Vgl. auch C. Crouch, Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus, S. 11.
165
Zu weitgehend insofern die These von W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 525: „Unter den besonderen Bedingungen Europas nach 1945 ist darüber hinaus mit der Europäischen Union ein neuartiges Gebilde entstanden, das den souveränen Nationalstaat in noch weit höherem Maße obsolet werden lässt.“ Zutreffend dürfte vielmehr sein, dass auch die EU auf starke Mitgliedstaaten geradezu angewiesen ist, vgl. A. Thiele, Verlustdemokratie, S. 23 ff. Siehe auch E. Eppler, Auslaufmodell Staat?, S. 211: „Die Nationalstaaten werden nicht aufgelöst, sondern aufgehoben, also auch aufbewahrt.“
166
Der nunmehr erreichte Status quo erscheint gleichwohl noch nicht gesichert. Insbesondere die Grenzsituation zwischen Nordirland und der Republik Irland bleibt prekär, zudem erstrebt die politische Führung Schottlands ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Der Brexit könnte mittelfristig also auch einen „Scexit“ zur Folge haben. Allerdings wäre ein solcher Schritt nur mit Zustimmung der Londoner Regierung möglich.
167
Dazu nur A. Thiele, Der Austritt aus der EU, EuR 2016, 281 ff.
168
Dazu auch C. Koppetsch, Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter, 2019.
169
A. Reckwitz, Das Ende der Illusionen, S. 252 ff.
170
Es ist insofern keineswegs ausgemacht, dass sich der Staat den globalisierungsbedingten Kräften nur „um den Preis der Rückständigkeit widersetzen“ kann, wie es M. v. Creveld, Aufstieg und Untergang des Staates, S. 459 meint. Das mag allenfalls für den Fall einer vollständigen Abkopplung gelten (wie etwa in Nordkorea).
171
Der Twitter-Account Donald Trumps wurde nach der Erstürmung des Kapitols am 6.1.2021 dauerhaft gesperrt.
172
Zu den Legitimitätsanforderungen im Einzelnen unten bei Frage III.
173
Vgl. auch M. Schularick, Der entzauberte Staat, S. 15 ff. zur besonderen Rolle des Staates gerade in der Krise. Allgemein auch U. Di Fabio, Coronabilanz, 2021.
174
S. Mau, Sortiermaschinen, S. 17 f.
175
Vgl. A. Tooze, Welt im Lockdown, S. 23: „Es bestätigte die grundlegende Aussage des Green New Deal, dass demokratische Staaten, wenn der Wille vorhanden ist, über die nötigen Instrumente verfügen, um Kontrolle auszuüben.“
176