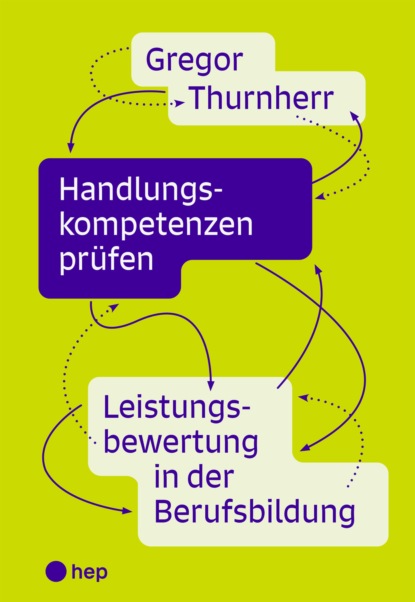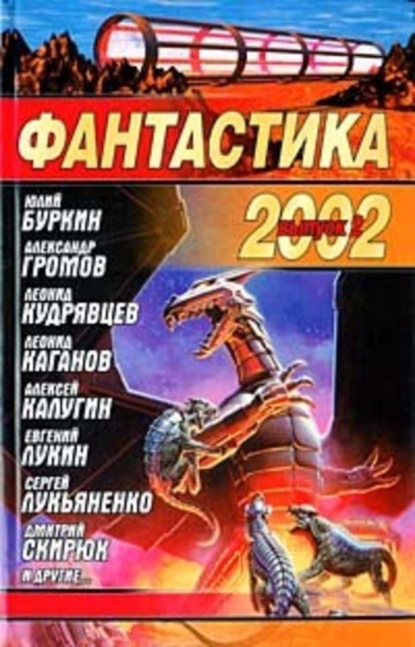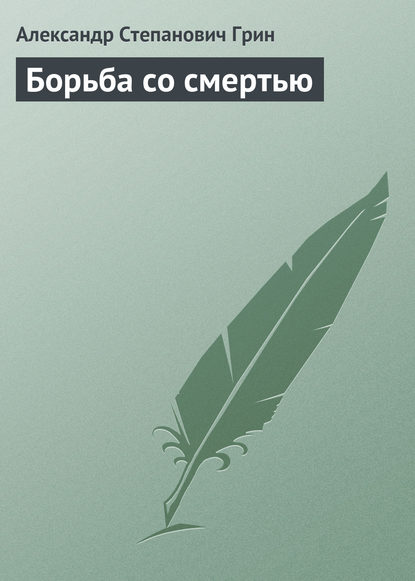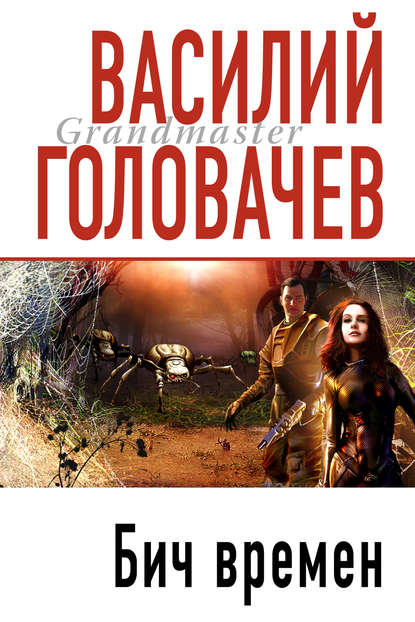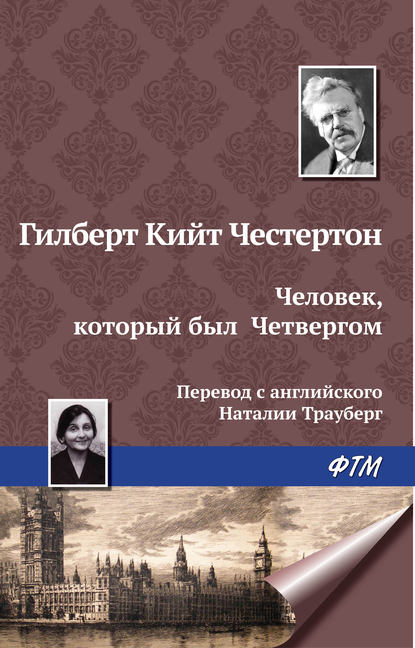- -
- 100%
- +
Feedback für Lernende
Feedback für Ausbildende
Lernen fördern
Leistungsbestätigung
Vorbereitung auf Stress
Vergleichbarkeit, Selektion und Qualitätssicherung
Motivation
Daraus lassen sich drei Funktionen von Prüfungen ableiten (vgl. AfH Uni ZH 2006): Diagnose, Prognose und Eignung (Selektion).
Prüfungen können Hinweise zur Entwicklung von Lernenden geben. Diese Erwartung verbindet sich beispielsweise mit Aufnahmeprüfungen an weiterführenden Schulen, die eine Prognose liefern sollen, ob jemand die Ausbildung, zum Beispiel das Gymnasium, erfolgreich absolvieren wird. Dabei dienen sie als Instrument zur Auswahl beziehungsweise als Grenzwert zwischen «genügt den Anforderungen» und «genügt den Anforderungen nicht» [Selektion]. Neben diesen prognostischen und selektiven Komponenten schaffen Prüfungen idealerweise Vergleichsmöglichkeiten und überprüfen den (verlangten) Stand der Handlungskompetenzentwicklung [Diagnose]. Sie geben Lernenden und Ausbildenden Hinweise zum Stand des individuellen Lernprozesses. Zudem können sie sowohl motivierend und lernfördernd als auch gegenteilig wirken. So übernehmen Prüfungen häufig die Rolle einer Lebensschule. Kandidatinnen und Kandidaten lernen, hartnäckig, ausdauernd, fleißig, fokussiert und zielstrebig zu sein. Sie halten Druck aus und bereiten sich so auf spätere Anforderungen und Situationen vor, in denen sie sich beweisen oder unter Zeitdruck hohe Erwartungen erfüllen müssen.
2.2 Handlungskompetenzorientiert prüfen
Das Prüfen von Fachwissen lässt sich mit den weit verbreiteten Methoden wie mündliche und schriftliche Abfragen von Definitionen, Merkmalen, Aspekten etc. durchführen. Dazu eignen sich beispielsweise offene und geschlossene Fragen sowie Multiple- oder Single-Choice-Aufgaben. Bei handlungskompetenzorientierten Prüfungen rücken das Bewältigen von Arbeitssituationen und somit berufsbezogene Handlungen, das Anwenden von Fertigkeiten sowie das Einhalten von definierten Prozessen ins Zentrum des Interesses. Traditionelle Prüfungsformen, wie sie sich für das Prüfen von reinem Fachwissen eignen, stoßen bei der Prüfung von Handlungskompetenzen an Grenzen (vgl. Euler 2011). Sie eignen sich nur bedingt. So müssen Prüfungsmethoden und Aufgabenstellungen entwickelt und praktisch eingesetzt werden, die Rückschlüsse auf die drei Kompetenzdimensionen (Wissen, Können, Wollen, siehe Abschnitt 1.1.3) ermöglichen. Handlungskompetenzorientierte Prüfungen sind umfassender im Sinne von mehrdimensionaler als konventionelle Prüfungen für Faktenwissen. Gute handlungskompetenzorientierte Prüfungen weisen eine hohe Orientierung an der beruflichen Realität sowie mehrere, vielfältige Aufgabenstellungen und Prüfungsmethoden auf. Prüfungen oder Qualifikationsverfahren im Umfeld der Berufspraxis sowie Sprachprüfungen können diesen hohen Ansprüchen weitgehend genügen, wobei auch sie lediglich die Performanz und nicht die vollständigen Handlungskompetenzen prüfen können (siehe Abschnitt 1.5). In Kapitel 3 wird vertieft auf geeignete Prüfungsmethoden eingegangen.
2.3 Grundlagen zur Prüfungserstellung
Bei der Konzeption und Erstellung von Prüfungen sind folgende klassische Qualitätsstandards zu beachten (vgl. Metzger & Nüesch 2004). Eine gute Prüfung ist:
gültig
zuverlässig
chancengerecht
ökonomisch
Gültig oder valide ist eine Prüfung, wenn sie das beurteilt, was auch tatsächlich verlangt wird beziehungsweise geprüft werden soll. Sie orientiert sich an übergeordneten Dokumenten wie zum Beispiel (Rahmen-)Lehrplänen, Wegleitungen, Bildungsplänen. Die Prüfungsaufgaben sind auf die verlangten, repräsentativen und zu beurteilenden Handlungskompetenzen ausgerichtet.
Was mit Gültigkeit gemeint ist, verdeutlicht das folgende Beispiel: Mathematische Berechnungsaufgaben in Form von Textaufgaben bergen die Gefahr, nicht valide zu sein. Eine komplizierte und unübersichtlich formulierte Situationsbeschreibung prüft zu weiten Teilen die Lese-, Verständnis- und Textanalysekompetenz der Geprüften und nicht wie vielleicht gewünscht die Berechnungskompetenz.
Zuverlässig, reliabel oder objektiv ist eine Prüfung, wenn keine Messfehler oder Verfälschungen auftreten. Es besteht der idealisierte Anspruch, dass verschiedene Prüfende bei der Prüfungsdurchführung die gezeigten Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten gleich bewerten. Bei mündlichen Prüfungen ist es unmöglich, eine vollständig objektive Beurteilung durch verschiedene Prüfende sicherzustellen. Es müssen darum möglichst eindeutig beurteilbare (operationalisierte) Kriterien für Leistungsmerkmale geschaffen werden. Dies erhöht die Vergleichbarkeit. Aber auch bei schriftlichen Prüfungen mit exakten Resultaten (z.B. Berechnungsaufgaben) kann es zu Verzerrungen in der Bewertung kommen, besonders wenn für die Korrigierenden keine verbindlichen Vorgaben zur Vergabe von Teilpunkten für Teillösungen, dem Umgang mit Folgefehlern und Lösungsschritten bestehen oder sich die Korrigierenden nicht peinlichst genau an die Bewertungsvorgaben halten.
Chancengerechte Prüfungen bieten allen Kandidatinnen und Kandidaten gleichwertige, also vergleichbare Bedingungen. Dienlich ist dafür eine möglichst hohe Transparenz im Hinblick auf die zu prüfenden Handlungskompetenzen, den Ablauf der Prüfung sowie die beteiligten Prüfenden. Dazu gehört der bewusste Umgang mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen wie Zeitpunkt und Örtlichkeit. Es ist zu beachten, ob und wie sich Kandidatinnen und Kandidaten zu absolvierten beziehungsweise bevorstehenden Prüfungen austauschen können. Damit sind zum Beispiel bei größeren, länger dauernden Prüfungen Pausengespräche oder Diskussionsmöglichkeiten nach beziehungsweise vor Prüfungsteilen gemeint.
Zu berücksichtigen ist bei der Prüfungskonzeption der Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen. Menschen mit einer anerkannten Behinderung haben gemäß Behindertengleichstellungsgesetz5 (Art. 2 Abs. 5 lit. b) Anspruch auf angepasste Prüfungsverfahren. Es sind Maßnahmen verlangt, um Benachteiligungen in Prüfungen zu beseitigen und somit die Chancengleichheit zu gewährleisten (vgl. SBFI 2013).
Ökonomisch ist eine Prüfung, wenn der Nutzen des Prüfungsergebnisses den Aufwand für Durchführung und Bewertung rechtfertigt. Der Gesamtaufwand seitens der Durchführenden soll vertretbar beziehungsweise möglichst optimiert sein. Für Kandidatinnen und Kandidaten sollen der Vorbereitungsaufwand und das Absolvieren der Prüfung zumutbar sein. Dies schließt physische, psychische sowie finanzielle, materialbezogene und geografische Aspekte ein. Handlungskompetenzorientierte Prüfungen generieren bei einer konsequenten Ausrichtung auf die berufliche Praxis häufig Mehraufwand im Hinblick auf Organisation, Finanzierung, Infrastruktur und Bewertungsverfahren. So sollten Aufgaben gestellt, Situationen geschaffen beziehungsweise simuliert werden, wie sie in der Praxis vorkommen. Das kann deutlich aufwendiger sein als die Entwicklung von einfachen schriftlichen Prüfungen.
Es ist ein sehr hoher Anspruch, dass eine Prüfung die vier Kriterien (gültig, zuverlässig, chancengerecht, ökonomisch) gleichzeitig und maximal erfüllt. Die Anzahl der Kandidatinnen und Experten, die räumliche und materielle Infrastruktur, gegenseitige Sympathie und Antipathie von Prüfenden und Geprüften beeinflussen die Durchführung. Aus diesen Gründen besteht die Herausforderung darin, ein Optimum zu finden und diese vier Kriterien einer guten Prüfung ideal abzustimmen. Dies kann je nach Rahmenbedingungen und Zielen beziehungsweise Funktionen der Prüfung sehr unterschiedlich gewichtet erfolgen (vgl. Walzik 2012).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.