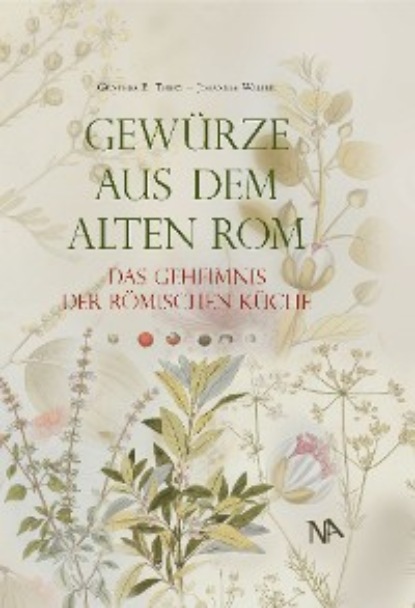- -
- 100%
- +
SÜSSEN OHNE ZUCKER:
DIE SÜSSSTOFFE DER RÖMISCHEN KÜCHE
In Tab. 1 vermisst der moderne Betrachter den Zucker. Er war dem antiken Koch noch unbekannt. Zwar wusste man schon seit den Feldzügen Alexanders des Großen in Asien, dass die Inder – wie sich der Geograph Strabon um die Zeitenwende ausdrückt – ihren „Honig“ aus einer Rohrpflanze gewinnen konnten, ohne dass sie dafür auf die Hilfe der Bienen angewiesen seien (Strabon 15, 1, 20). Dieser „Honig“ (griechisch bzw. lateinisch saccharon bzw. saccarum) war natürlich der Saft des Zuckerrohrs, der Grundstoff des Rohrzuckers. Rohrzucker wurde auch in römischer Zeit bereits aus Indien importiert; er diente in Rom aber nur medizinischen Zwecken. In der europäischen Küche hat er erst im Mittelalter Einzug gehalten.33
Dass Strabon den Rohrzucker mit dem Honig verglich, zeigt schon: Honig war in der klassisch-antiken Küche das Hauptmittel zum Süßen von Gerichten. Entsprechend liegt er auf Platz 5 der Tab. 1. Er wurde aber auch zum Konservieren von Obst, Gemüse und Fleisch gebraucht. Vermischt mit Wein, ergab er außerdem ein beliebtes Getränk: den Honigwein (mulsum), der seinerseits aber wieder als Würzmittel dienen konnte (Tab. 1, 38). In Anbetracht dessen, was wir über die kontrastliebende römische Würztechnik sagten, wird dabei nicht verwundern, dass er sehr gern – als Getränk wie als Würzprodukt – mit Pfeffer vermischt wurde. Man nannte ihn dann conditum oder „Würzwein“. Gleich das erste Rezept im ganzen sogenannten Apiciuskochbuch (Abb. 5) gibt die Anleitung für die Produktion eines solchen „wunderbaren Würzweins“ (conditum paradoxum).34
Neben purem oder mit Wein vermischtem Honig waren weitere Süßstoffe der römischen Küche auch noch Datteln bzw. Dattelwein oder Dattelsirup; Feigen und Feigensirup; Pflaumen und Rosinen; und süße Weine, wie der Rosinenwein (passum) – ein auch zum Würzen viel verwendetes Getränk, das aus im Freien getrockneten Trauben gepresst wurde (Tab. 1, 17, 20 f., 23, 31, 34, 44 und 80). Die moderne Entsprechung wären der Strohwein oder die Trockenbeerenauslese.35
Für die römische Küche besonders wichtig ist schließlich eine Gruppe zum Süßen verwendeter Präparate, die man als „Mostsüßstoffe“ bezeichnen könnte. Das sind Traubenmoste, deren Süße bzw. Zuckergehalt durch verschieden starkes Einkochen erhöht wurde. Ihr Verwendungszweck war vielseitig: sie wurden getrunken; zum Verschneiden von Wein gebraucht; als Konservierungsmittel für Früchte eingesetzt; und eben zum Süßen von Gerichten benützt.36
In den überlieferten Nachrichten über die Fabrikation und die Namen der Mostsüßstoffe herrscht leider einige Verwirrung. Unsere Tab. 2 stellt die einschlägigen Quellen und ihre widersprüchlichen Angaben zusammen. Die Präparate danach im modernen Haushalt zuzubereiten, ist zwar kein Problem. Probleme ergeben sich aber, wenn ein erhaltenes Kochrezept die Verwendung eines Stoffes fordert, dessen Herstellung die Quellen widersprüchlich beschreiben. Dann bleibt nichts anderes übrig, als sich für eine bestimmte überlieferte Zubereitungsart (wie zum Beispiel für „sapa à la Columella und Varro“ – siehe Tab. 2) zu entscheiden.
Tab. 2 Namen und Definitionen der römischen Mostsüßstoffe
Name des Produkts: Definition bei: Nach dieser Definition hergestellt durch: caroenum Isidor, Origines 20, 3, 15; Palladius 11, 18 Einkochen auf zwei Drittel des Volumens defrutum (auch defretum/ defrictum/ defritum) Plinius, Naturalis historia 14, 80 Einkochen auf die Hälfte des Volumens Columella 12, 21, 1; Varro bei Nonius 551 M. Einkochen auf ein Drittel des Volumens Palladius 11, 18 Einkochen bis zur Dickflüssigkeit sapa (auch hepsema/ mellacium/ siraeum) Columella 12, 19, 1; Varro bei Nonius 551 M. Einkochen auf die Hälfte des Volumens Geoponica 8, 32; Isidor, Origines 20, 3, 16; Palladius 11, 18; Plinius, Naturalis historia 14, 80 Einkochen auf ein Drittel des VolumensFLÜSSIGSALZ MIT FISCHGESCHMACK: SALZ IN DER RÖMISCHEN KÜCHE
In der Ernährung des „Kleinen Mannes“ spielte Salz zum Teil die Rolle unserer Brotaufstriche. Freilich darf man daraus nicht schließen, dass Salz schlechthin billig gewesen wäre. Salz war nämlich keineswegs gleich Salz. Das einfache Volk benützte nur eine nicht raffinierte Qualitätsklasse – das „Volkssalz“ (sal popularis), das wegen seiner grauen Farbe auch „dunkles Salz“ (sal niger) hieß. Das raffinierte weiße Produkt (sal candidus = „weißes Salz“) war den Vermögenderen vorbehalten. Das gleiche galt auch für das „Würzsalz“ (sal conditus), bei dem es sich um Würzmischungen aus Salz und pflanzlichen Gewürzen handelte.37
In der Küche der erhaltenen römischen Rezepte wurde Salz – das aber auch zum Nachwürzen bei Tisch diente – weniger zum Kochen als zum Konservieren von Lebensmitteln verwendet.38 Seine relative Seltenheit gehört zu den auffälligsten Ergebnissen der Tab. 1 (siehe Position 13). Das Phänomen wird dadurch verursacht, dass die Rezepte zum Salzen in erster Linie die schon einmal erwähnte Würzzubereitung garum oder liquamen vorschreiben (Tab. 1, 2; Abb. 11 und 15). Das Wort liquamen (deutsch eigentlich: „Flüssigkeit“) ist – genauer betrachtet – ein zusammenfassender Begriff für zwei unterschiedliche Fischprodukte: für die muria (das war Salzlake, die den Geschmack darin eingelegter Fische angenommen hatte); und für das garum – eine stark salzhaltige Flüssigwürze, die aus dem Fleisch mariner Fische und anderer Meerestiere gewonnen wurde.39 Man könnte sie als ein „Flüssigsalz mit Fischgeschmack“ charakterisieren. In garum-Fabriken wurde sie im Süden des Römischen Reiches in verschiedenen Qualitätsklassen industriell erzeugt und war im antiken Handel erhältlich.40 Sie ließ und lässt sich aber – in einem vereinfachten Verfahren – auch im Haushalt zubereiten. Bei der industriellen Produktionsmethode sorgte ein länger währender Fermentationsprozess für eine Zersetzung der massiv in Salz eingelegten Tierkörper. Die dabei entstehende und abgeseihte Flüssigkeit war das garum. Das vereinfachte Verfahren für den Hausgebrauch ersetzt die Fermentation dagegen durch einen Kochvorgang. Das Rezept dieser „Hausmacher-Variante“ (M. Junkelmann) ist sehr einfach und eignet sich bestens auch für die garum-Herstellung in der heutigen Küche.41 In der Art moderner Kochbücher formuliert, lässt es sich so wiedergeben:
REZEPT FÜR DIE ZUBEREITUNG VON GARUM
QUELLE: GEOPONICA 20, 46, 542
ZUTATEN
(DIE NICHT ÜBERLIEFERTEN MENGENANGABEN
NACH ERPROBUNG DURCH DEN VERFASSER):
350 G SARDINEN, SARDELLEN ODER ANDERE KLEINFISCHE
(NICHT GESÄUBERT, MIT KÖPFEN)
1½ L WASSER
400 G SALZ
1 EL OREGANO, GEREBELT
ZUBEREITUNG:
EINEN TOPF MIT WASSER FÜLLEN UND SO VIEL SALZ BEIGEBEN, DASS EIN HINEINGEWORFENES EI OBENAUF SCHWIMMT. DIE FISCHE IN DIE SALZLAKE LEGEN UND OREGANO HINZUFÜGEN. DANN SO LANGE KOCHEN, BIS DER FLÜSSIGKEITSSPIEGEL BEGINNT, ETWAS ABZUSINKEN. ABKÜHLEN LASSEN UND DURCHSEIHEN; AM BESTEN DURCH EIN TUCH. DABEI WIRD EINE HELLGELBE BIS HELLBRAUNE, BIS AUF FEINE SCHWEBSTOFFE KLARE FLÜSSIGKEIT GEWONNEN. SIE IST DAS GARUM (ABB. 15). IN FLASCHEN ABGEFÜLLT, HÄLT SIE SICH SEHR LANGE. SIE RIECHT FÜR EIN FISCHPRODUKT NICHT ALLZU AUFDRINGLICH UND EIGNET SICH GUT ZUM WÜRZEN.
Der beim Abseihen des garum im Tuch verbleibende Rückstand (aber offenbar auch schon die Fischmasse vor dem Filtrieren) hieß (h)allec oder (h) allex. Im Gegensatz zum klaren garum besteht das allec hauptsächlich aus den Tierkörpern, die allerdings – abgesehen vom Skelett – bei der Herstellungsprozedur weitgehend zerfallen sind (Abb. 16). Auch nach dem Abseihen des garum sondern sie immer noch etwas Flüssigkeit ab. Verwendet wurde allec ebenfalls als Würzstoff (Tab. 1, 51). Außerdem diente es aber als selbständiger Speiseartikel, der freilich sehr salzig schmeckt und eine reichliche Menge Gräten enthält. Sie sind jedoch weich und ebenso essbar wie die zarten Knöchelchen im heutigen Couscous.

Abb. 15 Nach antikem Rezept hergestelltes garum.
Selten gibt es ein Thema, bei dem auch noch der neuesten wissenschaftlichen Literatur so viele offenkundige Fehler unterlaufen wie bei garum und allec. Ein Teil dieser Irrtümer betrifft schon die Natur der beiden Produkte. Beispielsweise werden Fischrestchen aus antiken Gefäßfunden immer wieder als garum-Rückstände erklärt (obwohl ja garum keine Fischteile enthielt); garum wird für „probably quite thick“ gehalten (während es in Wahrheit dünnflüssig ist); oder eine Autorin nennt garum unzutreffend „ein Fäulnisprodukt aus Abfällen“.43
Krasse Fehlurteile betreffen aber auch Geschmack und Bekömmlichkeit von garum. Während die einen schreiben, man kenne seinen Geschmack nicht, versichern andere etwa, es ließe „unsere Mägen wahrscheinlich revoltieren“, sei ihnen „wohl kaum zuträglich“ und würde uns „die römische Küche vermutlich schnell verleiden“. Eine amerikanische Autorin formulierte, garum sei „wahrscheinlich eine genau so gute monokausale Erklärung für den Untergang Griechenlands und Roms wie jede andere“; und der britische Schriftsteller und Politiker Boris Johnson verstieg sich sogar dazu zu behaupten: garum sei „wirklich ekelhaft, fast radioaktiv … Jeder im Imperium aß dieses Zeug, obwohl es hochgiftig war“. Kulinarischer und medizinischer Überprüfung hält keine dieser Aussagen stand.44
Warum sich so viele Autoren falschen, ja unsinnigen, Spekulationen hingeben, obwohl die überlieferte „Hausmacher-Variante“ des garum doch mit nur „etwas Liebe und Geduld“ (G. und M. Faltner) leicht zuzubereiten ist und Klarheit schaffen kann, bleibt unerfindlich. Aber nicht einmal derjenige Forscher, dem wir die grundlegende Untersuchung über garum verdanken – nämlich Robert Irvin Curtis – hat zum archäologischen Experiment gegriffen und das Produkt, über das er schrieb, selbst hergestellt. Selbst er macht sich über den vermutlichen Geruch der Fischsauce unnötige Gedanken und siedelt ihn im Zweifel, je nach Qualität des Erzeugnisses, zwischen Limburgerkäse und Schlimmerem an.45 In Wahrheit hat aber garum mit Limburgerkäse nichts gemein. Es duftet überhaupt nur recht dezent; und der Fischgeruch, der bei seiner Zubereitung in der Küche entsteht, hat sich rasch verzogen.
Berechtigte Vorbehalte gegenüber garum und allec ergeben sich allenfalls auf einem Hintergrund, der von der Forschung bisher noch kaum gesehen wurde. Dieser Hintergrund ist die Produktqualität antiker Industrie-Fischwürzen, die nicht immer zufriedenstellend war. Wir wissen das durch den bisher einzigen genau untersuchten Fund eines allec-Restes aus Mitteleuropa.46 Diese von Johannes Lepiksaar analysierte Fischkonserve kam in einer römischen Amphore aus Salzburg zutage. Der Rückstand ihres Inhalts setzte sich hauptsächlich aus den Relikten von 24 mediterranen Fischarten zusammen (darunter überwiegend Sardinen und Sardellen). Daneben fanden sich aber auch Reste der kulinarisch uninteressanten Seenadeln, ein verirrter Laubfrosch, Muschelstückchen und viel Strandkies. Das stellt zwar der Geschäftstüchtigkeit des antiken Produzenten ein gutes Zeugnis aus; nicht aber seinem Qualitätssinn.
NAHRUNGSFETTE ALS WÜRZSTOFF
Wenigstens noch kurz gestreift sei hier das Thema der Speisefette (Tab. 1, 4). Auch sie geben ja Küchenprodukten ihr spezielles Aroma mit. Wie sehr sie dadurch zum Charakter der Gerichte beitragen, darf man nicht unterschätzen. Ein spanischer Bekannter gestand dem Verfasser, er vermisse bei typischen Hauptgerichten und Salaten unserer Breiten „den Ölgeschmack“; und er kenne auch andere Spanier, denen es genauso gehe. Umgekehrt schrieb Victor Hehn einmal, dass „ein deutscher Bauer mit Behagen große Mengen Speck verzehrt, sich aber schwer entschließt, Öl zum Gemüse hinzuzugießen oder sein Fleisch mit Öl zu braten.“

Abb. 16 Nach antikem Rezept hergestelltes allec.
Die gleiche grundsätzliche Zweiteilung der kulinarischen Welt in eine mediterrane Küche des Olivenöls und in eine mitteleuropäische der tierischen Speisefette hat – wie schon einmal gesagt – bereits die Antike gekannt. Auch wenn es damals Versuche gegeben haben mag, den Ölbaum (Abb. 13) im Norden zu pflanzen, ist ja diese Zweiteilung durch die Klimageographie schon vorgegeben: nämlich durch die nördliche Verbreitungsgrenze, die sie dem wirklich gedeihenden und fruchtenden Ölbaum gezogen hat. Auch im Altertum prägte die Geographie damit kulinarische Vorlieben: nach einem Bericht des Poseidonios wussten die Kelten den Geschmack von Olivenöl nicht zu schätzen (Poseidonios Fragm. 15 Jacoby); und umgekehrt beschwert sich der aus dem römischen Kleinasien stammende Historiker Cassius Dio einmal, dass er als Gouverneur der Donauprovinz Pannonien in einer Landschaft leben musste, in der kein Ölbaum wuchs (Cassius Dio 49, 36, 2).
Dabei hat Dio in Pannonien auf sein Olivenöl wohl kaum verzichtet, sondern es gewiss aus dem Süden importieren lassen. Nicht anders als heute, machten ja Geschmack und Fernhandel die Grenze zwischen den Konsumgebieten von Öl und von tierischen Speisefetten durchlässig. Und so beliebt das Öl im Süden war und so gesund es im Übrigen ist, verraten uns Quellen aus dem mediterranen Raum gelegentlich doch, dass man auch dort hin und wieder tierisches Fett verwendet hat. Im sogenannten Apiciuskochbuch kommt es freilich nur in zwei Rezepten (61 und 64 André) vor.47
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.