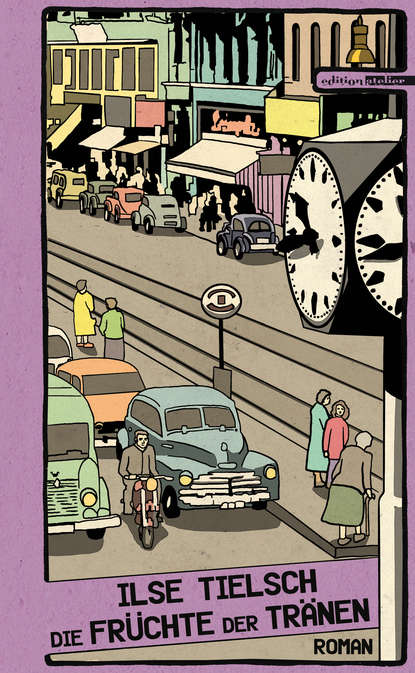- -
- 100%
- +
Die Leute, die meine Koje besuchen, sagte Plotzner, wissen sehr gut, daß das mit dem Blasen ein Trick ist, sie sind ja nicht blöd. Aber wie dieser Trick funktioniert, das können sie nicht so leicht herausbekommen, das Nylonseil ist ja beinahe unsichtbar, und außerdem ist es unter dem Teppich versteckt, und die Leute achten nur auf das Bett, sie kommen nicht dahinter, wie es gemacht wird, wenn nicht jemand daherkommt wie Sie und den Wandschirm umwirft. Die Leute stehen da und sehen, wie das Bett aufgeht, ohne daß jemand es auch nur anrührt, sie versuchen, dahinterzukommen, wie das funktioniert, aber normalerweise kommen sie nicht dahinter, das freut sie, das bringt Spannung in die Sache. Sie sind dankbar für den gut gemachten Trick, die Leute, das ist fast wie wenn sie im Zirkus gewesen wären, aber sie mußten dazu nicht in den Zirkus gehen und Geld ausgeben, sie haben den Trick ganz umsonst mit dem Eintrittsgeld für die Messe mitgekauft. Und wenn sie dann wieder zu Hause sind, erinnern sie sich daran und reden davon.
Zum Glück ist ja ein ständiges Kommen und Gehen auf dieser Messe, sagte Plotzner, also einmal ist keinmal, die Sache ist nicht so schlimm.
Da bin ich aber beruhigt, sagte Bernhard.
Komm, sagte er zu Anni, wir gehen.
Plotzner packte ihn am Arm. Nein, sagte er, so ist das nicht gemeint. Sie haben mir versprochen, mich abzulösen, ich brauche eine Pause bei diesem Betrieb und bei dieser Hitze, auch meine Frau braucht eine Pause. Wir haben einen Preis für die Stunde ausgemacht. Wo soll ich jetzt, mitten im Messebetrieb, jemand anderen herbekommen?
Sie haben doch einen Sohn, sagte Bernhard.
Der Peter ist im Geschäft, sagte Plotzner. Einer muß im Geschäft sein, sonst machen die Angestellten, was sie wollen. Kommen Sie, sagte er, ich gebe Ihnen einen Schilling mehr für die Stunde.
Das Angebot würde ich annehmen, sagte Judith.
Na ja, meinte Anni.
Also gut, sagte Bernhard, gehen wir.
Ich komme mit, sagte Judith.
Sie schoben sich wieder durch das Gedränge, an dem Mann mit dem Milchtopf vorbei, der Erfinder des Schraubenziehers drehte immer noch Schrauben in ein Stück Holz, die Dame mit dem Strumpfhalter ohne Knöpfe schob ihren Rock hoch und wies auf ihr Bein, der Student, der die Dachziegel anpries, warf ihnen einen vielsagenden Blick zu, er deutete auf die Koje, vor der sich schon wieder die Menge staute. Auf dem Patentbett, das jetzt aufgeschlagen war, lag ein junger Mann, die Arme unter dem Kopf verschränkt, und täuschte laute Schnarchtöne vor.
Plotzner zog sein Taschentuch aus der Rocktasche, wischte damit über die Stirn und steckte es wieder ein. Wünsche wohl geruht zu haben auf Plotzners Patentbett, sagte er scharf.
Plotzner junior öffnete die Augen und gähnte. Die Menge brach in Gelächter aus. Plotzner senior tat, als wäre die Sache mit Absicht so arrangiert worden, er vermied im Hinblick auf die drohende Blamage einen Familienstreit und nützte die Situation.
Peter Plotzner schüttelte Bernhard und Anni die Hand und entfernte sich, er hatte den beiden den Nebenverdienst in der Möbelkoje seines Vaters vermittelt. Viel Spaß und überarbeitet euch nicht, rief er ihnen noch zu, dann war er verschwunden.
Diesmal lief alles zu Karl Plotzners Zufriedenheit ab. Bernhard hielt seinen Vortrag über die Qualitäten der raumsparenden Möbel, vor allem der Polsterbank, Anni zog im richtigen Augenblick kräftig am Seil, das sich nicht verklemmt hatte, sondern prompt funktionierte. Die Bank glitt lautlos nach vorne und öffnete sich zum Bett, das Publikum staunte und applaudierte.
Plotzner, hinter dem Wandschirm stehend, nickte zufrieden. So müssen Sie es machen, so ist es richtig, sagte er zu Anni, wenn Sie es jedesmal so machen, dann wird es ein Erfolg, dann lasse ich vielleicht mit mir reden und gebe Ihnen noch einen Schilling mehr.
Im selben Augenblick ereignete sich draußen auf dem Podest etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Judith, die unten im Publikum gestanden war und die Vorstellung interessiert verfolgt hatte, sprang, ihren roten Rock mit beiden Händen festhaltend, auf das Podest. Dieses prachtvolle Bett muß man aber auch ausprobieren, rief sie, ich möchte wissen, wie man darauf schläft. Ehe Bernhard es verhindern konnte, war sie, leicht wie eine Tänzerin, auf das Patentbett gesprungen, nicht ohne die Schuhe vorher abzustreifen, hatte, auf und ab hüpfend, die Federung erprobt, sich dann hingelegt, der Länge nach ausgestreckt. Nun räkelte sie sich behaglich auf den rotbraunen Polstern, ihr Rock verrutschte, eines ihrer schlanken Beine wurde bis zum Schenkel hinauf sichtbar, wofür sich vor allem der männliche Teil der Zuschauer mit lautem Beifall bedankte.
Plotzner, der mit geschärftem Ohr die zu diesem Zeitpunkt nicht erwartete Bewegung in der Menge wahrgenommen hatte, lugte durch einen Spalt im Wandschirm, erblickte zwischen den Blättern eines der Gummibäume Judiths roten Rock und Judiths nacktes Bein, wollte erst wütend aus seiner Ecke hervorbrechen, die freche Person von seinem Patentbett verjagen, besann sich dann, blieb still und wartete ab. Er vernahm, wie die Menge, nachdem Bernhard Judith endlich bewogen hatte, sich wieder aufzurichten und das Bett zu verlassen, Unmut darüber äußerte, daß die Vorstellung zu Ende war, dann lachend weiterzog. Erst dann trat er hinter dem Wandschirm hervor und auf Judith zu, die eben dabei war, ihre Schuhe wieder anzuziehen.
Fräulein, sagte Plotzner, Sie verstehen etwas vom Geschäft, Sie müssen das unbedingt wiederholen.
Judith sah ihn erschrocken an. Das fällt mir nicht ein, sagte sie zornig.
Aber Fräulein, sagte Plotzner, haben Sie nicht gesehen, was für ein Erfolg das war?
Judith hörte ihn nicht mehr, sie hatte sich schon durch die Menge gedrängt und lief durch die Halle dem Ausgang zu.
(Ich, Anna, sehe Judith mit wehendem roten Rock durch die Tür der Halle verschwinden. Ich sehe Anni und Bernhard wiederum das Podest besteigen, auf dem Plotzners Patentmöbel stehen. Sie werden, indem sie diese anpreisen, mithelfen, eine Epoche zu prägen. Die Verhältnisse werden sich bessern, aber die Architekten werden auf ihren Reißbrettern weiterhin kleinräumige Wohnungen entwerfen, das kleine Glück wird in kleine Räume gedrängt bleiben, auch dann noch, wenn keine Patentbetten mehr nötig sind. Manches wird überflüssig werden, weil es in den zu kleinen Zimmern keinen Platz mehr dafür geben wird, zum Beispiel Klaviere. Die Kinder werden nicht mehr Klavier spielen lernen wie Anni, wie Heinrich, wie auch Valerie, sie werden auf Knöpfe drücken, Knöpfe erfordern nur wenig Platz. Die Knopffabriken werden erweitern, in großen Hallen werden kleine Knöpfe erzeugt werden, die Knöpfe werden an kleinen Apparaten angebracht werden, die Apparate werden in den kleinen Wohnzimmern die Klaviere ersetzen. Die Zeit wird anbrechen, in der man Klaviere nachts heimlich von den Brücken in die Donau kippt, weil niemand sie mehr braucht und niemand sie mehr haben will, vielleicht auch in andere Flüsse von einiger Breite und Tiefe, Architektur und Technik werden den heimlichen Tod der Klaviere verursacht haben, das Ertrinken der Klaviere, das Verstummen der Klaviere. Niemand wird mehr Klavierauszüge von Opern oder Operetten auf Notenpulte legen und daraus Opern- oder Operettenmusik spielen.
Anni vor dem schwarzen Flügel, auf dem in Goldbuchstaben HANSMANN geschrieben steht, Valerie vor dem braunen Flügel im Bauernhaus ihrer Eltern in B., Heinrich vor dem Flügel in Mährisch Trübau, Friederike vor dem Flügel in Sankt Ägyd, Kinder, die Musik durch Klavierspiel erzeugen, nur der Musik zuliebe, dies alles wird Vergangenheit sein.
Heinrich ging, im Ersten Weltkrieg in Polen, auf ein fremdes Klavier zu, das in einem polnischen Herrenhaus stand, er spielte Musik von Lehár und Strauß. Klaviermusik, spontan auf fremden Klavieren gespielt, wird es kaum noch geben, was bleiben wird, werden die Kriege sein. Der Tod der Klaviere, das Verschwinden der Klaviere wird nicht dazu beitragen, die Welt friedlicher werden zu lassen, die Knöpfe werden eine furchtbare Bedeutung erlangen. Dies aber sind Entwicklungen, die Plotzners Patentbett nicht direkt verursacht hat.)
4
Der fünfte Winter nach dem Ende des Krieges war kalt. Eine böse Zeit für jene, die noch in Notunterkünften saßen, keine warme Kleidung, keine festen Schuhe hatten, kaum Brennmaterial und die nötigsten Lebensmittel kaufen konnten. Zwei Jahre nach der Währungsreform war im Westen Deutschlands die Rationalisierung der Lebensmittel zum großen Teil aufgehoben worden, trotzdem spürte man den Mangel überall, denn es fehlte an Arbeitsplätzen und damit auch an Geld. Ein Ei kostete achtzehn Pfennig, die Butter konnte man um zwei Mark fünfzig für das halbe Kilo kaufen, ein Kilo Brot kostete eine Mark. Hedwig hatte mit hundertvierzig Mark im Monat für die Familie auszukommen. Sie war eine der 469.000 Kriegerwitwen, die zu versorgen waren.
Obwohl man den Flüchtlingen und Vertriebenen in Deutschland Renten und Unterstützung gewährte, konnten diese, bei den herrschenden Verhältnissen, nur niedrig sein. Auch die Arbeitslosigkeit war im Steigen begriffen. Im deutschen Bundesgebiet erreichte die Zahl der Menschen, die ohne Beschäftigung waren, die Zweimillionengrenze, in Nürnberg allein waren 13.180 Arbeitslose gezählt worden, die Schlangen vor den Arbeitsämtern wurden von Tag zu Tag länger. Von den Unternehmern wurden nur voll einsatzfähige Arbeitskräfte beschäftigt, Angestellte, die auf Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes den Anforderungen nicht entsprechen konnten, wurden in den meisten Fällen entlassen. Ständig kamen neue Arbeitsuchende hinzu, Heimkehrer, illegale Grenzgänger, auf verschiedenen Wegen Zugezogene. Die allgemeine Not war groß, beinahe katastrophal. Trotzdem schrieb die New York Times, sich auf Berichte aus Frankfurt berufend, die Deutschen äßen jetzt besser, als sie je nach dem Krieg gegessen hätten, und sie hätten vor, IM NEUEN JAHR ZU GUT ZU LEBEN. Die Administratoren, hieß es, seien besorgt, daß die deutsche Bevölkerung sich AN EIN ZU UMFANGREICHES MENU GEWÖHNEN könnte und daß es eines Tages zu neuerlichen Einschränkungen kommen würde, etwa dann, wenn die mögliche Einstellung der amerikanischen Hilfe mit einer schlechten Ernte zusammenfiele. Dies würde dann EINE RÜCKKEHR ZUM MAGEREN TISCH bedeuten.
(Hier ist daran zu erinnern, daß Annis Großeltern, Josef und Anna, mit ihrer Tochter Hedwig und deren beiden Kindern Heidi und Günter nach ihrer Vertreibung von Haus und Hof und einer Zwischenstation im nördlichen Niederösterreich in ein sehr kleines Dorf bei Erlangen gebracht wurden, wo sie in einem Häuschen zwei Dachkammern bewohnten. Heidi und Günter erklären, daß der Tisch der Familie in jenen Jahren mehr als mager gedeckt gewesen sei. Sie waren zu diesem Zeitpunkt, von dem hier die Rede ist, sieben und zehn Jahre alt und können sich nicht daran erinnern, damals GUT UND REICHLICH gegessen zu haben.
Präsente, die man den Großen machte, spiegeln die Lage der Zeit deutlicher als der zitierte Zeitungsbericht. Zum vierundsiebzigsten Geburtstag des Bundeskanzlers Adenauer stellten sich die Länder mit Lebensmittelgeschenken ein. Bayern soll sechs Hühnereier, Schleswig-Holstein ein halbes Pfund Butter gespendet haben.)
Der Winter also war kalt, und die Familie fror, obwohl Großvater Josef Holz aus dem Wald heranbrachte und der kleine eiserne Ofen, der in einer der beiden Kammern stand, geheizt werden konnte. Die Wände blieben kalt, und durch die Fugen der klapprigen Fenster pfiff ein eisiger Wind.
Großmutter Anna war schon mehrmals schwer krank gewesen, sie war über siebzig Jahre alt und geschwächt. Hedwig hatte die Sorge um die tägliche Nahrung für die fünfköpfige Familie und zu ihrem Kummer um den in Rußland verschollenen Mann Richard auch noch jene um die kranke Mutter zu tragen.
Die Schwägerin in Wien versuchte zu helfen, sie stellte ein Weihnachtspaket zusammen und gab es einer Frau mit, die zu Verwandten nach Nürnberg fuhr. Irgendwann um die Weihnachtszeit kam dann der von der Zensurstelle geöffnete und wieder verklebte Brief, in dem Hedwig mitgeteilt wurde, daß das Paket unter einer genannten Adresse in Nürnberg zu holen sei.
Hedwig war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in der nahen Stadt Nürnberg gewesen, die Gelegenheit hatte sich nicht ergeben, jetzt mußte sie diese Fahrt unternehmen, obwohl die Mutter wieder erkrankt war und sie dringend gebraucht hätte. Das Paket und sein Inhalt waren wichtig, und sie entschloß sich zur Reise.
Sie zog den Mantel an, den eine befreundete Frau ihr aus einem alten Männerrock und einer Jacke genäht hatte. Nein, einen richtigen Mantel habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehabt.
(Wenig später wurde in Nürnberg ein Winterschlußverkauf eröffnet, in den zwischen den Ruinen errichteten Behelfsläden gab es Damenwintermäntel aus umgearbeiteter US-Ware, BESTE, STRAPAZIERFÄHIGE QUALITÄT, mit Webpelzfutter, sie kosteten fünfundzwanzig bis dreißig Mark.
Das hätte mir auch nichts genützt, auch wenn ich es gewußt hätte, sagt Hedwig. Soviel Geld habe ich für mich nicht ausgeben können, soviel Geld habe ich gar nicht gehabt.
Arbeitsjacken aus Wolle kosteten drei Mark fünfundsechzig, Gummiüberschuhe drei Mark fünfzehn bis vier Mark fünfzig. Die Ware war liegengeblieben, die Leute hatten sie nicht gekauft. Überall machte sich Geldnot bemerkbar.
Mit der Währungsreform, heißt es allgemein, habe der Konsum begonnen. Die Leute hätten die Geschäfte gestürmt und gekauft, was kaufbar gewesen sei.
Das ist ein Märchen, sagt Hedwig, davon sind nur sehr wenige betroffen gewesen. Die meisten Leute sind vor den Geschäften gestanden und haben in die Auslagen geschaut und die Sachen bestaunt, die es schon wieder gegeben hat. Wirklich kaufen konnten die wenigsten. Alles spricht von dem Aufschwung, sagt ein Geschäftsmann, der Ende der fünfziger Jahre nach Amerika ausgewandert ist, niemand spricht von der FLAUTE nach der Währungsreform.
Das zu Unrecht erworbene Geld der Schwarzhändler und Schieber war abgeschöpft worden, das durch Schwarzhandel und Betrug erworbene Geld, Haufen von Papiergeld waren zu wenigen Scheinen geschmolzen oder zu einem Häuflein Münzen, die Währungsreform hatte die neuen Reichen wieder arm gemacht, aber die Armen waren dadurch nicht reicher geworden.)
Hedwig bestieg den ungeheizten Zug, der sie nach Forchheim bringen würde, sie hockte frierend auf der Holzbank und sah die Landschaft vorüberziehen, die sie kannte. Vier Jahre lebte sie mit den Ihren nun schon in dieser Gegend, in Forchheim war sie wiederholt gewesen, auch Erlangen kannte sie schon, Nürnberg noch nicht. Ein Jahr hatte sie in Österreich verbracht, hatte dann weiterziehen müssen, zum zweitenmal vertrieben, zum zweitenmal gezwungen, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen, schon Gewohntes aufgeben zu müssen, eine junge Frau, die Kinder geboren und wieder begraben hatte. Ein kleines Grab war auf einem niederösterreichischen Dorffriedhof zurückgeblieben. Ihr Mann Richard war aus Rußland nicht wiedergekommen, sie hatte sich dazu entschließen müssen, die Todeserklärung zu beantragen, Kriegerwitwen stand eine zusätzliche Rente zu, sie hatte das Geld gebraucht, um die beiden ihr noch verbliebenen Kinder und die alten Eltern ernähren zu können, obwohl sie insgeheim immer noch hoffte, Richard würde eines Tages wiederkommen, über das Rote Kreuz oder über die in Wien lebende Schwester ihren Aufenthaltsort erfahren. Immer wieder hatte sie sich in Tagträumen ausgedacht, wie er eines Tages vor der Tür stehen, wie sie ihm öffnen würde, wie die Kinder auf ihn zustürzen würden, wie er sie, Hedwig, in die Arme schließen würde. Immer wieder hatte sie in den Nächten von ihm geträumt, eine junge Frau, die ohne ihren Mann zu leben gezwungen war, die sich sehnte und wach lag, wenn die Alten und die Kinder schon in ihren Betten schliefen, eine immer noch schöne junge Frau, die trotz ihrer Armut nicht hätte allein bleiben müssen, es jedoch blieb, weil sie nicht aufhören konnte, auf ein Wunder zu hoffen.
In Forchheim hielt der Zug, Hedwig stand längere Zeit frierend auf dem Bahnsteig, stieg dann in einen anderen Zug um, saß wieder auf einer Holzbank im ungeheizten Abteil, kam endlich in Nürnberg an.
Hatte sie sich vor der Fahrt in die Stadt, von der sie schon so viel gehört hatte, die sie von Bildern und Büchern her kannte, gefürchtet oder hatte sie sich darauf gefreut? Sollte sie diese Fahrt mit dem Gefühl angetreten haben, vom Dorf in eine große Stadt zu fahren, in eine stark zerstörte, aber immerhin von Leben erfüllte Stadt, sollte sie sich, trotz der quälenden Sorgen, auf eine Abwechslung gefreut haben, dann jedenfalls wurde sie grausam enttäuscht.
Als sie den Zug verlassen hatte, sah sie Ruinen, wohin sie auch blickte, sauber zur Seite geräumten, aber in hohen Haufen liegenden Schutt. Aus den Trümmern ragten bizarre Reste von Türmen, Mauern, Gewölben. Nackte Fensterbogen sah sie, mit schwarz verkohlten Stuckrosetten, einzelne, noch erhalten gebliebene Schornsteine ragten wie Nadeln empor, von Fensterlöchern durchbrochenes Mauerwerk hob sich gegen den Winterhimmel ab. Hedwig hatte viel über die zerstörten Städte Deutschlands gehört und gelesen, überall war darüber geschrieben und auch gesprochen worden, so aber hatte sie sich die Wirklichkeit doch nicht vorgestellt. Auch in B. waren zu Kriegsende Bomben gefallen, auch dort hatten Häuser gebrannt, auch die Stadt Wien hatte furchtbare Zerstörungen aufzuweisen gehabt. Aber das, sagt sie, muß man erlebt haben, man muß es gesehen haben, um zu wissen, wie es wirklich gewesen ist.
Sie sei, sagt Hedwig, immer weitergegangen, wie von selbst hätten sich ihre Füße bewegt. Auf einem freien Platz, mitten unter den Trümmern, sei auf einem Sockel eine dunkle Figur in wallendem Umhang gesessen, in der einen Hand einen Schreibblock, in der anderen eine Feder, als sie nahe genug herangekommen sei, habe sie das Denkmal von Hans Sachs erkannt. Ob es unversehrt geblieben war oder ob man es inzwischen wieder aufgestellt hatte, kann sie nicht sagen. Der Anblick aber habe sie verstört und traurig gemacht. Eine ganze Weile stand Hedwig vor dem Denkmal, dann ging sie weiter. Aus den Kellern der zerstörten Häuser lugten Ofenrohre hervor, sie schloß daraus, daß in den erhalten gebliebenen Kellerräumen Menschen lebten, wohnten und schliefen. Da und dort sah sie einen Mann, eine Frau aus einer dieser unterirdischen Höhlen hervorkommen oder darin verschwinden, die Vorstellung HÖHLENBEWOHNER drängte sich ihr auf, sonst begegneten ihr nur wenige, in der Hauptsache ältere Leute. Mühsam fragte sie sich zu der von der Schwägerin angegebenen Adresse durch, stand schließlich vor einem zur Hälfte zerstörten Haus, konnte sich nicht vorstellen, daß in der erhalten gebliebenen Hälfte noch Menschen lebten, betrat dann doch zögernd den Flur und ging die Treppe hinauf, fand schließlich die Tür, an der ein Schild mit dem angegebenen Namen befestigt war. Die Wohnung, die sie betreten habe, sagt Hedwig, habe aus einem einzigen Zimmer bestanden, das nur von der Mauer des Treppenhauses und von den Außenmauern gestützt worden sei, die weiteren Räume hätten gefehlt. Sie habe in diesem Zimmer das Gefühl gehabt, in der nächsten Minute durch den Fußboden durchzubrechen, abzustürzen und in die Tiefe gerissen zu werden. Sie habe Angst gehabt. Sie habe das Paket in Empfang genommen, sich bedankt, sei dann sehr rasch wieder gegangen, sei mit dem Paket in der Hand, das ziemlich schwer gewesen sei, ziellos durch die Straßen gelaufen und habe nach der Innenstadt gesucht, irgendwo zwischen den Ruinen habe sie einen Polizisten getroffen und ihn nach dem Weg gefragt.
Können Sie mir den Weg in die Innenstadt zeigen, fragte Hedwig.
Der Polizist sah sie erstaunt an. Sie sind ja hier mitten in der Innenstadt, sagte er. Das hier ist die Nürnberger Innenstadt.
Er beschrieb mit dem Arm einen Kreis und wies auf die umliegenden Ruinenfelder. Sie befinden sich, sagte er, mitten im Zentrum von Nürnberg. Oder, setzte er hinzu, in dem, was das Zentrum von Nürnberg einmal gewesen ist.
Sie habe, sagt Hedwig, plötzlich furchtbar gefroren. Das war eine Kirche, sagte der Polizist und wies mit der Hand auf einen Trümmerhaufen, aus dessen Mitte ein Steinblock ragte, aus dem Steinblock ein großes, schwarzes Kreuz.
Nur schwarz berußte Trümmer, sagt Hedwig, darauf das Kreuz, sie habe gar nicht daran gedacht, daß dies einmal eine Kirche gewesen sei, aber der Anblick dieses einsam ragenden Kreuzes über den Trümmern habe sie mit einem furchtbaren Entsetzen erfüllt. Trotz allem, was sie selbst habe erleben müssen, was sie vorher schon gesehen und erlebt hatte, sei dies eine ihr bis dahin noch unbekannte Art des Entsetzens gewesen, von dem sie ergriffen worden sei.
Ist Ihnen schlecht? fragte der Polizist und blickte Hedwig erschrocken an.
Nein, sagte Hedwig, ihr sei nicht schlecht, nur sehr kalt.
Sie habe am ganzen Körper gezittert, aber nicht nur wegen der äußeren Kälte, eher wegen jener, die von innen gekommen sei. Sie sei sehr schnell davongegangen, sie habe das Paket fest an sich gedrückt, sie sei fast gelaufen, die kalte Nässe sei durch ihre schon schäbigen Schuhe gedrungen, sie habe noch zwei- oder dreimal nach dem Weg fragen müssen, obwohl das auch nicht leicht gewesen sei, weil sie nur so wenige Leute getroffen habe. Schließlich sei sie auf dem Bahnhof angekommen, habe sich dort auf einen Stein gesetzt und geweint. Nein, daran, was in dem Paket gewesen sei, erinnere sie sich nicht. Wahrscheinlich Lebensmittel, sagt sie, obwohl die Schwägerin in Wien ja auch nicht viel gehabt hat, und wahrscheinlich einige Kleidungs- oder Wäschestücke für die Kinder. Sie seien ja damals über jedes Stück, das man ihnen geschenkt habe, glücklich gewesen.
Aber monatelang habe sie von der zerstörten Stadt Nürnberg geträumt, in diesen Träumen, aus denen sie immer wieder aufgeschreckt sei, in Schweiß gebadet, dabei zitternd vor Kälte, sagt Hedwig, in diesen Träumen habe sich die Zerstörung jedoch später nicht mehr ausschließlich auf Nürnberg bezogen, schließlich sei der Begriff Nürnberg darin überhaupt nicht mehr vorgekommen, sie habe nur endlose Trümmerwüsten gesehen, zerstörte Häuser und Schuttberge, sie habe geträumt, daß sie zwischen diesen Trümmern und Schuttbergen hindurchlaufen müsse, sie habe sich dabei sehr allein gefühlt, von allen verlassen, sie habe zwischen den Ruinen und in den Kellerlöchern nach ihren Kindern gesucht und sie nicht gefunden, habe auch nach ihrem Mann Richard gerufen, und immer wieder habe sie diesen Steinhaufen gesehen und das große, schwarze Kreuz darauf. Immer wieder dieses Kreuz zwischen den Trümmern, sagt Hedwig, diese Träume hätten sie lange verfolgt und ganz krank gemacht.
(Fünf Jahre vorher, am 2. Jänner 1945, an einem schneefreien, diesigen Wintertag, hatte der schwerste Angriff auf die Stadt Nürnberg stattgefunden, er dauerte dreiundfünfzig Minuten und forderte zweitausend Menschenleben, Hunderttausende wurden obdachlos. Etwa tausend Flugzeuge warfen rund eine Million Stab- und Phosphorbomben, etwa hundert Minen und sechstausend Brandbomben ab. In der bis dahin schon schwer getroffenen Stadt lebten, wie man anhand der Lebensmittelkarten errechnet hatte, die ausgegeben worden waren, nur noch 259.000 Menschen, von denen allerdings auch schon viele in die umliegenden Landgebiete gezogen waren. Die Tage und Nächte seit dem Weihnachtsfest waren ruhig verlaufen, man hoffte schon auf ein baldiges Ende des Krieges, wenn es auch ein Ende mit Schrecken sein würde. Wohl hatte es am Nachmittag des 2. Jänner dreimal Voralarm gegeben, aber als die Dämmerung hereinbrach, waren die Straßen trotzdem belebt, die Straßenbahnen wegen des Schichtwechsels in den Fabriken überfüllt, auch zu den Kinos und zum Opernhaus strömten die Menschen, die Abendvorstellungen waren wegen der drohenden Alarmgefahr vorverlegt worden. Gegen achtzehn Uhr wußte man bereits, daß große Bomberverbände im Anflug auf Hamburg und Aachen waren. Dann schwebten CHRISTBÄUME über der Stadt, in der Mitte einer in grüner Farbe, die Türme von Sankt Lorenz und der Kaiserburg, die Giebel der noch unversehrten Fachwerkhäuser waren in fahles Licht getaucht, im Südosten erglänzte der grelle Blitz einer Mine, gefolgt von einem dröhnenden Donnerschlag, dann kamen die Bomber.
Anfangs sollen sie nur aus Südost gekommen sein, dann aus Ost und West, schließlich aus allen Himmelsrichtungen. Die erste Bombe fiel siebenundvierzig Minuten nach achtzehn Uhr, dreiundfünfzig Minuten später war alles vorbei. Eine riesige Wolke aus Ruß und Rauch hing über der Altstadt, die den Flammen rettungslos ausgeliefert war. Es war unmöglich, das Feuer einzudämmen, denn es herrschte totaler Wassermangel. Über hunderttausend Menschen, die das Inferno lebend überstanden hatten und obdachlos geworden waren, stürmten am nächsten Tag die wenigen intakt gebliebenen Bahnhöfe der Umgebung und versuchten, im umliegenden Land ein Obdach zu finden.