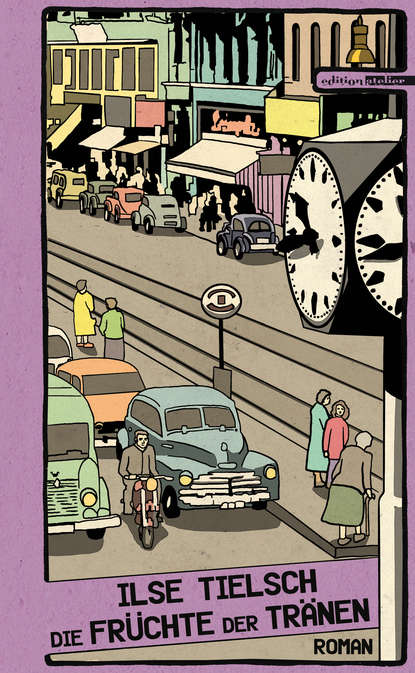- -
- 100%
- +
Vielleicht denkt sie auch vor allem, während sie ihre winzigen Teigkugeln knetet, an ihre Eltern und an die jüngere Schwester, die jetzt in ihrer Dachkammer in dem Dorf bei Erlangen ebenfalls Weihnachtsvorbereitungen treffen, fragt sich, ob die kleine Kammer auch warm genug beheizt ist, ob die Familie genügend zu essen hat, ob sie nicht friert, ob sich die Mutter nach ihrer Krankheit wieder erholt hat. Vielleicht ist sie auch ihrer Tochter wegen von Sorge erfüllt. (Ich hab es dir gleich gesagt, das kann nicht gut ausgehen, du bist nichts und hast nichts, und wir haben nichts, was wir dir geben können, warum hast du dir diese Heirat nicht aus dem Kopf geschlagen?)
Heinrich nimmt inzwischen zur Kenntnis, daß, einer Meldung der Prager Zeitung SVET PRACE zufolge, alle Hotels und Restaurants in der Tschechoslowakei verstaatlicht, die Dorfwirtshäuser den landwirtschaftlichen Genossenschaften angeschlossen worden sind. Die kommunistische Partei, liest er, habe Weisungen zur Liquidierung der DORFREICHEN und zum Zusammenschluß der Kleinbauern und der mittleren Grundbesitzer herausgegeben.
Von dem Wort LIQUIDIERUNG erschreckt, läßt Heinrich die Zeitung sinken, zögert einen Augenblick, ehe er sie wieder aufnimmt und weiterliest.
Für den Fremdenverkehr wird schon wieder geworben, die Zonengrenzen stellen jedoch, liest Heinrich, ein Hindernis dar, eine Einreise aus Deutschland ist nur mit einem Militärpermit möglich, dieses gilt nur für die westlichen Besatzungszonen (das hat Heinrich ohnedies gewußt), der mitgenommene Geldbetrag dürfe nur vierzig Mark, also etwa zweihundertvierzig Schilling, betragen (das hat er nicht gewußt, aber zweihundertvierzig Schilling sind für ihn eine Menge Geld). In Deutschland sind Tagespensionen schon ab sieben Mark zu finden, in Österreich kosten sie zwischen sechs und zwölf Mark. In Spitzenhotels sind für den Tag bis zu zwanzig Mark zu bezahlen.
Auch vor Heinrichs innerem Auge tauchen wahrscheinlich jetzt Bilder aus lange vergangenen Tagen auf.
Im Radio sind die Weihnachtslieder verklungen, es ist jetzt von Weihnachtsbräuchen die Rede, Valerie dreht am Knopf, der Sender RADIO WIEN bringt die Sendung WEIHNACHTSFEST IN EINEM USIA-BETRIEB, sie stellt das Radio ab.
Was steht denn in deiner Zeitung, sagt sie zu Heinrich, während sie nach der Teigrolle greift, lies mir etwas vor.
Heinrich, im Hinblick auf die vorweihnachtliche Stimmung, die er nicht verderben will, wählt erfreuliche Nachrichten aus. Ein wichtiger Verhandlungspunkt der Gemeinderatssitzung am Tag vorher, liest er, ist die Neugestaltung des Stephansplatzes gewesen. Dieses Problem ist in bisher insgesamt achtunddreißig Sitzungen behandelt worden, es geht die gesamte Wiener Bevölkerung an, GANZ WIEN IST DARAN INTERESSIERT.
Die PUMMERIN würde in Sankt Florian neu gegossen werden, eine Spendenaktion sei geplant, um die nötigen dreihunderttausend Schilling aufzubringen. Es bestehe der Plan einer festlichen Überführung der fertigen Glocke auf der Donau, mit Anlegepausen in allen Ufergemeinden, als eine Art Bekenntnis zu Österreich.
Wenn die Besatzungsmächte damit einverstanden sind, sagte Valerie.
In den Zeitungen jener Tage blätternd, finde ich heute, nach so vielen Jahren, Nachrichten, die Heinrich, um seine Frau nicht zu beunruhigen, wahrscheinlich nicht vorgelesen hat. Ich finde auch die Listen mit den Namen derer, die ZUM VERFAHREN DER TODESERKLÄRUNG AUFGEBOTEN waren.
AUF ANSUCHEN DER ANTRAGSTELLER WIRD DAS AMTLICHE VERFAHREN ZUR TODESERKLÄRUNG VERMISSTER EINGELEITET UND DIE AUFFORDERUNG ERLASSEN, DEM GERICHT NACHRICHT ÜBER IHREN VERBLEIB UND IHR SCHICKSAL ZU GEBEN.
Namen und Geburtsdaten, vage Angaben über letzte Aufenthalte, Angabe von Orten, an denen die Verschollenen, Vermißten, noch nicht Heimgekehrten zum letztenmal gesehen wurden oder von wo ihre letzte Nachricht gekommen ist.
Verschollen in der Weite Rußlands, bei Rückzugsgefechten, in Gefangenenlagern, aber auch aus Häusern, Wohnungen geholt, in Züge, Lastwagen gestoßen, nie mehr aufgetaucht, nie mehr zurückgekommen. Alte Männer und Kinder werden gesucht, der deutschen Wehrmacht letztes Aufgebot, Verschleppte werden gesucht, Deportierte, von denen nie mehr eine Nachricht gekommen ist, Österreicher und Deutsche jüdischer Religion. Orte werden genannt, letzte Stationen ihrer Leidenswege, SEITHER FEHLT JEDE NACHRICHT.
Reinhard S., geboren 1917, wird seit den Kämpfen bei Breslau im Jahre 1945 vermißt. Seither fehlt jede Nachricht.
Peter B., geboren 1910, wurde vorhandenen Nachrichten zufolge mit einem Kriegsgefangenentransport von Stalingrad nach Uspestipan gebracht. Seither fehlt jede Nachricht.
Henoch K., geboren 1885 als Sohn des Aron K. und der Chane, geborene D., zuletzt wohnhaft in Wien, wurde Nachrichten zufolge 1942, von Wien nach Minsk gebracht. Seither fehlt jede Nachricht.
Hedwig hatte sich nach langem Zögern und aus Gründen der Not doch dazu entschlossen, einen Antrag auf Todeserklärung für ihren in Rußland verschollenen Mann Richard zu stellen. Wie aber hätte sie dem Gericht Nachricht geben können über den Verbleib und das Schicksal Richards, da doch gerade sein Verbleib und sein Schicksal ihr unbekannt waren.
DIE VERMISSTEN WERDEN AUFGEFORDERT, VOR DEM GEFERTIGTEN GERICHTE ZU ERSCHEINEN ODER AUF ANDERE WEISE VON SICH NACHRICHT ZU GEBEN. Wie konnte einer, der für tot erklärt werden sollte, weil er seit Jahren mit unbekanntem Aufenthalt verschollen, wahrscheinlich schon irgendwo begraben lag, vor einem Gericht erscheinen oder auf andere Weise von sich hören lassen, wie konnte er Nachricht geben?
Hedwigs Antrag wurde, wie unzählige andere Anträge gleichen Inhalts, von einem deutschen Gericht erledigt, Richard wurde in Deutschland, andere wurden in Österreich für tot erklärt, amtlich aus dem Leben genommen, aus dem Leben ausgestrichen, in ein papierenes Grab gelegt. Der amtliche Totenschein bedeutete eine Witwenrente für die Not leidende Frau, eine Waisenrente für die hinterbliebenen Kinder, bedeutete häufig, wie im Fall Hedwigs, nicht das Ende der Hoffnung auf die immer noch mögliche Heimkehr des Totgesagten, amtlich für tot Erklärten.
In den meisten Fällen jedoch hat sich diese Hoffnung, wie jene Hedwigs, niemals mehr erfüllt.
Immer noch fehlten Väter, Söhne und Brüder, immer noch trafen auf Bahnhöfen Transporte mit Heimkehrern ein, mit solchen, auf deren Rückkehr man mit Sehnsucht gewartet hatte, aber auch mit solchen, die nach ihrer Rückkehr vor Gräbern oder vor verschlossenen Türen standen. Der Krieg hatte zahllose Opfer gefordert, das Leben war trotzdem weitergegangen. Nach der furchtbaren Tragödie des Krieges spielten sich in der Heimat die einzelnen privaten Tragödien ab. In der Zentrale des Internationalen Roten Kreuzes in Genf waren allein 1949 hundertzwanzigtausend Briefe mit Suchmeldungen eingegangen, hundertvierunddreißigtausend Briefe wurden abgeschickt, nur fünfzehntausend Einzelfälle konnten gelöst werden. Zwei Drittel aller Anfragen betrafen deutsche Staatsangehörige, die an der Ostfront verschollen waren, auch zahllose Kinder wurden gesucht, die man den Eltern entrissen hatte. Aus der Gefangenschaft Entlassene berichteten über andere, die in ihrem Beisein verstorben waren oder die keine Nachricht geben konnten, obwohl sie noch lebten. Zu Kriegsende verschleppte Mädchen kamen als Frauen wieder und brachten in der Gefangenschaft geborene Kinder mit. Die jüngste Heimkehrerin aus Rußland, die wenige Tage vor Weihnachten neunundvierzig auf dem Wiener Südbahnhof ankam, hieß Gertrude Noll und war drei Monate alt.
Jetzt vor Weihnachten, rief die leitende Schwester der Bahnhofsmission, JETZT VOR WEIHNACHTEN KÖNNEN WIR SO EIN KLEINES KIND NICHT BRAUCHEN!
Die junge Mutter drückte die kleine Trude an sich und brach in Tränen aus. Sie hatte schwere Jahre hinter sich, schreckliche Jahre, Verschleppung, Gefangenschaft, Zwangsarbeit, sie war nicht verweichlicht worden, sie hatte in Rußland einen Mitgefangenen zum Mann genommen, hatte ihr Kind im Gefangenenlager geboren, sie hatte vieles ertragen müssen, aber auf diesen Satz war sie nicht gefaßt gewesen. Zu Weihnachten wurde das Kind in der Krippe gefeiert, das Kind, das in einem Stall geboren worden war, die Welt kniete nieder vor diesem Kind, die Menschen beschenkten einander, die Priester in den Kirchen standen in prächtigen Gewändern vor den Altären, die Glocken läuteten, Kerzen brannten, Weihrauchwolken verströmten exotische Düfte, tausendfach ertönte das Lied von der Heiligen Nacht, die diesem Kind gewidmet war, das den Frieden in die Welt bringen sollte. An den Fronten hatten, dem Kind zuliebe, die Waffen geschwiegen. Ihr Kind aber, das ebenso in Armut geboren war wie jenes vor zweitausend Jahren, wurde nicht aufgenommen, wurde in die Kälte verstoßen. Sie stand vor verschlossener Türe mit ihrem Kind, IN DER HERBERGE WAR KEIN PLATZ FÜR SIE.
Waren die Menschen in zweitausend Jahren nicht um einen Schritt weitergekommen, hatte sich an ihrer Dummheit und Selbstsucht seither überhaupt nichts geändert?
Eine Hilfsschwester hatte Mitleid und nahm die verstörte Mutter in ihre Wohnung mit, versorgte sie dort drei Tage lang und vermittelte schließlich über die evangelische Pfarrgemeinde eine Unterkunft bei der Heilsarmee.
Wie hätte Valerie, wäre ihr diese Geschichte zu Ohren gekommen, gesagt? Immer und überall, hätte sie gesagt, kommt es auf den einzelnen Menschen an.
Die österreichische Regierung setzte sich für die noch nicht Zurückgekehrten ein. WIR WOLLEN KEINE KRIEGSVERBRECHER SCHÜTZEN, WIR WEHREN UNS ABER DAGEGEN, DASS MENSCHEN WEGEN EINER KOLLEKTIVSCHULD UNSCHULDIG VERURTEILT WERDEN, NACHDEM SIE BEREITS FÜNF JAHRE IHRER FREIHEIT BERAUBT WURDEN UND DURCH SCHWERE KÖRPERLICHE ARBEIT GENÜGEND SÜHNE GELEISTET HABEN.
Nur die Frauen, Mütter, Schwestern der Heimatvertriebenen warteten vergeblich auf eine diesbezügliche Bitte oder ein hilfreiches Wort.
In Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bedauerte der österreichische Außenminister, daß nach einer allgemein anerkannten Norm des Völkerrechts ein Staat bei einer ausländischen Regierung Interventionen nur zugunsten seiner eigenen Staatsbürger durchführen könne.
DEN ÖSTERREICHISCHEN VERTRETUNGSBEHÖRDEN FEHLT DAHER JEDE LEGITIMATION, OFFIZIELL FÜR NICHTÖSTERREICHISCHE KRIEGSGEFANGENE WEGEN ENTLASSUNG AUS DER GEFANGENSCHAFT ZU INTERVENIEREN. AUCH WENN DIE IN ÖSTERREICH BEFINDLICHEN ANGEHÖRIGEN DER KRIEGSGEFANGENEN ODER IN DER ANFRAGE GENANNTEN STAATEN ZURÜCKGEHALTENEN VOLKSDEUTSCHEN ZUM TEIL SCHON DIE ÖSTERREICHISCHE STAATSBÜRGERSCHAFT ERHALTEN HABEN, IST DIES KEINESFALLS AUTOMATISCH FÜR DIE GENANNTEN KRIEGSGEFANGENEN UND ZURÜCKGEHALTENEN GEGEBEN.
DAHER BESTEHT IN SOLCHEN FÄLLEN FÜR DEN ÖSTERREICHISCHEN STAAT KEINE VÖLKERRECHTLICHE LEGITIMATION ZU OFFIZIELLEN SCHRITTEN IM INTERESSE DIESER PERSONEN.
Wie hatte Heinrich zu dem Kind Anni gesagt, das nach seinen Vorfahren und nach deren Volkszugehörigkeit gefragt hatte?
Früher, hatte Heinrich gesagt, als du noch nicht geboren warst, sind wir alle Österreicher gewesen.
Den Leuten sind die Hände gebunden, sagte Valerie, diese Regierung darf ja nicht tun, was sie für richtig hält.
Fünf Jahre nach dem Krieg und noch immer besetzt, sagte Valerie, was das kostet.
Drei Monate später informierte die WIENER ZEITUNG ihre Leser in einem Bericht über die bisherigen Besatzungskosten.
Bis 1949 waren an die Amerikaner 407 Millionen, an die Engländer 841 Millionen, an die Franzosen 735 Millionen Schilling, an die Russen 2,5 Milliarden Schilling bezahlt worden.
1949 hatte die vierfache Besetzung Österreich 518,7 Millionen Schilling gekostet. Zusammen mit dem Umtausch alliierter Militärschillinge hatte der Betrag, der für die Besatzungsmächte ausgegeben werden mußte, über fünf Milliarden Schilling betragen. (Das monatliche Einkommen eines Beamten mit Maturastatus im gehobenen Verwaltungsdienst machte am 1. Jänner 1950 vierhundertsechsunddreißig Schilling aus.)
Fünf Jahre nach dem Krieg und noch immer kein Friedensvertrag, sagte Valerie, dabei wollen wir doch nichts als den Frieden!
Bewußt die erste Person der Mehrzahl verwendend, die eigene Person einbeziehend, engagierte sie sich für den Staat, der sie als gleichberechtigte Bürgerin angenommen hatte. Genoß sie die Rechte dieses Staates, fielen ihr auch Pflichten zu. Es gibt niemanden in diesem Land, der nicht den Frieden will, sagte sie.
Am letzten Tag des fünften Friedensjahres erwähnte der Wiener Bürgermeister diesen leidenschaftlichen Friedenswillen des Volkes, aber er sprach auch von Kriegsangst, welche die Menschen erfüllte, er äußerte sich sorgenvoll im Hinblick auf das kommende Jahr. Nur der amerikanische Sonderbotschafter Averell Harriman sagte Österreich eine hoffnungsvolle Zukunft voraus. Vergeblich warteten die Heimatvertriebenen in Österreich an ihren eigenen oder an fremden Radioapparaten auf einen Satz in den Neujahrsbotschaften und Neujahrsreden der Großen des Landes, der sich auf ihr Schicksal bezogen hätte. Niemand gedachte ihrer mit einem an sie gerichteten, tröstenden oder Hoffnung gebenden Wort.
8
Briefe kamen aus Deutschland. Die Bewirtschaftung der Butter sei aufgehoben worden, schrieb Hedwig, jetzt könne man Butter frei kaufen, das Pfund koste zwei Mark vierundfünfzig Pfennig. Man hat gefürchtet, daß es Hamsterkäufe geben wird, schrieb sie, aber das ist nicht eingetreten. Die Leute kaufen nicht mehr, als sie früher gekauft haben, sie haben ja auch nicht mehr Geld als vorher. Man kauft ja nur, was man braucht. Nur für den Zucker wird es noch eine Zeitlang Marken geben.
Nach Baden-Württemberg sollen jetzt achttausend Flüchtlinge aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen und Bayern kommen, schrieb Hedwig. Sie werden umgesiedelt, man wird für sie Wohnungen bauen. Schade, daß wir nicht auch umgesiedelt werden, dann würde man uns vielleicht eine Wohnung geben. Vielleicht wäre Mutter dann nicht immer krank, und die Kinder kämen in bessere Schulen.
Die nächsten drei Zeilen in dem Brief waren von der Zensur mit schwarzer Farbe dick durchgestrichen worden. Valerie hielt den Brief mit der durchgestrichenen Stelle gegen das Licht, aber man konnte nichts von dem erkennen, was die schwarze Farbe verdeckte. In Stuttgart soll es schon wieder herrliche Geschäfte geben, schrieb Hedwig im nächsten Absatz, abends viele Lichtreklamen. Ferdinand ist dort gewesen, er hat mir geschrieben.
Er sei in Stuttgart gewesen, schrieb Vetter Ferdinand an Hedwig, er sei über die Königsstraße gegangen, er sei WIE ERSCHLAGEN gewesen vom Anblick der Geschäfte und dem Angebot der Waren in den Auslagen, er habe geglaubt zu träumen, ein Geschäft neben dem anderen, dazwischen sogar schon Kaffeehäuser und Kinos, der Satz WIE IM FRIEDEN sei ihm eingefallen, jener Satz, den man gebraucht habe, wenn man sich während des Krieges nach unerreichbarem Luxus gesehnt habe. Seidenstoffe, Schuhe, Handtaschen, sogar Schmuck sei in den Auslagen ausgelegt, schön angeordnet und arrangiert, dann, als die Dämmerung eingefallen sei, die Lichtreklamen, er sei sich vorgekommen wie in einem Märchenland. Die Leute hätten sich vor den Schaufenstern gedrängt.
Dahinter freilich hocke das Elend noch immer wie vorher. Er sei ja ein neugieriger Mensch, er sei durch die Tore gegangen und habe die hinter den Toren liegenden Höfe betreten. Dort liege der Schutt noch herum, die Mauern seien ohne Verputz, man trete in Abfallhaufen und in Pfützen, die Leute hätten Stricke gespannt und Wäsche zum Trocknen aufgehängt, WIE IN EINEM FLÜCHTLINGSLAGER, er habe notdürftig zusammengezimmerte Bretterhütten gesehen, in denen offensichtlich Menschen wohnten.
So sei es fast auf der ganzen Königsstraße gewesen, vom Bahnhof weg bis zum Ende. Es ist mir eingefallen, schrieb Vetter Ferdinand, daß dies die beiden Seiten unserer Gegenwart sind, schon wieder Reichtum auf der einen Seite, noch immer bittere Armut auf der anderen. VORNE PRUNKFASSADEN, DAHINTER EIN NIEMANDSLAND, hinter der immer noch schönen Fassade des Kronprinzenpalais ein von Trümmern übersätes Gelände, aus dem Eisenträger hervorragten, ideal für lichtscheues Gesindel. Abseits von den schönen neuen Geschäften gäbe es, wie überall, aus Latten und Zeltplanen gezimmerte Notverkaufsstände, Behelfsläden. Und dann wieder ein Bürohaus mit großen Glasfenstern, er habe, schrieb Ferdinand, das Gefühl gehabt, die Menschen, die sich hinter den riesigen Scheiben bewegten, seien nur Puppen gewesen, von unsichtbarer Hand bewegte Marionetten.
Papa hat man das zweite Bein abgenommen, schrieb Annis Freundin Helga aus Hessen, Mama ist sehr verzagt.
Ich habe eine Lehrstelle bei der hiesigen Kleinbahn bekommen, die Leute dort sind sehr nett zu mir.
(Fast eineinhalb Millionen Vertriebene und Flüchtlinge hatte man nach dem Ende des Krieges nach Hessen gebracht, obwohl über zwanzig Prozent des vorhandenen Wohnraums zerstört oder von der Besatzungsmacht beschlagnahmt worden waren.
DIE AUS DEM GEDRÄNGTEN ZUSAMMENLEBEN DER FLÜCHTLINGE MIT DEN EINGESESSENEN RESULTIERENDEN SPANNUNGEN, DIE BESONDERS IN DEN LANDGEMEINDEN AUFTRETEN, sagte der zuständige Ministerialbeamte in einer Rede, BEHERRSCHEN HEUTE UNSER SOZIALES, WIRTSCHAFTLICHES UND POLITISCHES LEBEN.)
Nein, immer noch kein Ende der Not. Immer noch grub man Tote aus den verschütteten Kellern, immer noch lebten sehr viele in Flüchtlingsbaracken, in Bunkern und Kellerlöchern, Flüchtlinge kamen über die Grenze nach Westdeutschland, die Mittel reichten nicht aus, um das Elend zu beseitigen und sie alle menschenwürdig unterzubringen.
(Über zweieinhalbtausend Flüchtlinge aus Ostberlin kamen zu jener Zeit in den Westen der Stadt, sie konnten nicht weitertransportiert werden, da die russische Besatzungsmacht die durch die Ostzone führenden Züge streng kontrollierte. In Berlin nahm die Arbeitslosigkeit ständig zu, nur wenige der Flüchtlinge konnten ihren Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechende Arbeitsplätze bekommen.)
Über die Trümmerfelder deutscher Großstädte zogen Kinder und suchten nach Eisen, Kupfer und Blei. Für ein Kilogramm Kupfer zahlten Händler eine Mark und zehn Pfennig, für ein Kilo Blei fünfzig Pfennig, für ein Kilo Messing fünfundvierzig Pfennig, für ein Kilogramm Stahlschrott zwei Mark. Zwölfjährige schleppten Eisenträger, zogen Handwagen über den Schutt, kleine Schwerarbeiter, die zum Unterhalt der Familien beitrugen und ihre Schulaufgaben aus Müdigkeit nicht erledigen konnten. Siebenjährige handelten mit amerikanischen Zigaretten und machten Geschäfte mit Besatzungssoldaten. Waisen suchten ihre Eltern, Väter und Mütter suchten ihre verschollenen Kinder. Unter der schwarzen Bevölkerung Amerikas wurden Adoptiveltern für farbige Mischlingskinder gesucht.
ÄTSCH, MIR HAM HALT A ECHT’S NEGERLA, sagt der Anführer einer Gruppe von Sternsingern zum Sternträger einer anderen Gruppe, die Karikatur findet sich in der Zeitung NÜRNBERGER NACHRICHTEN vom 5. Jänner 1950. Ein schüchterner Versuch, die Öffentlichkeit zugunsten der kleinen Farbigen günstig zu beeinflussen.
Ein Flüchtlingssprecher ermahnte die Flüchtlinge und die Heimatvertriebenen, treu zusammenzuhalten, ABER NICHT, UM EINE REVOLUTION ZU ENTFACHEN, SONDERN UM DIE MENSCHENRECHTE ZU WAHREN.
Was das Elend der Heimatvertriebenen betrifft, sagte der österreichische Innenminister, so sei die Regierung bestrebt, das Los dieser Menschen in jeder Beziehung zu erleichtern. ALLERDINGS, ICH WARNE DAVOR, BEI DIESER HEIKLEN FRAGE MIT GROSSEN VERSPRECHUNGEN ZU ARBEITEN. WER MIT VERSPRECHUNGEN ARBEITET, WER DEN ARMEN TEUFELN HOFFNUNGEN MACHT, DIE NICHT IN ERFÜLLUNG GEHEN KÖNNEN, DER WIRD SEHEN, DASS ER DIESE LEUTE NICHT NUR SICH SELBER, SONDERN AUCH DIESEM LAND ZU FEINDEN MACHT. WIR MÜSSEN UNSER LAND NACH UNSEREN BEDÜRFNISSEN AUFBAUEN, UND WIR MÜSSEN IN ERSTER LINIE AN UNSERE EIGENEN STAATSBÜRGER DENKEN.
Valerie, die sich als Staatsbürgerin fühlte, fragte sich trotzdem in Augenblicken der Depression, ob es nicht besser gewesen wäre, mit den vielen anderen nach Deutschland zu gehen.
In Deutschland, sagte sie zu Heinrich, hätte man uns besser geholfen, dort hat man die Heimatvertriebenen als Neubürger angenommen und hat ihnen wenigstens für den Anfang etwas Geld zum Leben gegeben.
(Wäre ich nur nach Deutschland gegangen, sagte Edith K. aus Siebenbürgen, die man zu Kriegsende nach Rußland verschleppt hatte und die erst vier Jahre später nach Österreich entlassen worden war. Für jeden Tag der Gefangenschaft hätte ich acht Mark bekommen. Sie können sich ausrechnen, wie viel Geld das gewesen ist.)
Heinrich warf seiner Frau, wenn sie solches sagte, einen traurigen Blick zu. Du weißt, sagte er dann immer, warum ich nicht von hier weggegangen bin.
Valerie schwieg, sie wußte Bescheid. Schon als Student hatte Heinrich sich gewünscht, in Wien leben zu dürfen, er hatte alle seine Hoffnungen auf dieses Leben in Wien gesetzt, er hatte sich den Anfang in Wien hart, aber doch etwas anders vorgestellt.
Daß ich damals nach Deutschland gegangen bin, sagt Hedwig, Valeries jüngere Schwester, ist unser Glück gewesen. In Österreich wären wir Bettler geblieben, in Österreich hätte ich nicht gewußt, wie ich die Eltern und die Kinder ernähren soll. Auch hier, sagt sie, war der Anfang sehr schwer. Auch die Einheimischen haben Not gelitten. Aber man hat uns wenigstens anerkannt, und man hat uns geholfen, wo es möglich war.
(Deutsche Zeitungen veranstalteten 1950 eine Umfrage mit dem Ergebnis, daß die meisten Menschen über zu niedrige Einkommen und zu hohe Lebenshaltungskosten klagten. Ein Lehrer verdiente etwa vierhundert Mark, ein mittlerer Beamter zweihundertfünfzig, ein Facharbeiter zweihundert Mark. Ausgebombte Familien sahen keine Möglichkeit, die nötigsten Möbelstükke, Wäsche oder Hausgerät anzuschaffen, selbst der Kauf eines Kleides, eines Mantels für den Winter, die Anschaffung von Schuhen bedeuteten unlösbare Probleme.)
Du kannst dir vorstellen, sagt Hedwig, wie es uns und den Flüchtlingen gegangen ist, auch wenn wir kleine Unterstützungsbeiträge bekommen haben.
Dann die Arbeitslosigkeit, sagt Hedwig. Sie half bei den Bauern auf den Feldern mit, auch der alte Vater arbeitete noch schwer, später fuhr sie mit dem Fahrrad in die nahe Stadt Erlangen und wusch die Wäsche einer amerikanischen Familie.
Nie, sagt Hedwig, hat mir die Amerikanerin etwas zu essen für mich und für die Kinder mitgegeben, sie ist wahrscheinlich gar nicht auf den Gedanken gekommen, mich zu fragen, ob wir genug zu essen hätten.
Sie hat auch nicht kochen können, sie hat überhaupt keine Vorstellung von richtigem Kochen gehabt. Sie hat ein Stück gefrorenes Fleisch aus dem Kühlschrank genommen, hat mit einer Hacke ein Stück davon abgehackt, hat es in die Pfanne geworfen, rasch abgebraten und dann ihrem Mann auf den Teller gelegt. Jeden Tag hat sich das gleiche abgespielt. Der Mann hat ein kleines Stück von dem Fleisch abgeschnitten, hat daran herumgekaut, hat es wieder ausgespuckt, hat dann den Teller weggeschoben und ist gegangen. Das Fleisch hat die Frau dann in den Abfalleimer geworfen.
Wahrscheinlich ist das gar nicht böser Wille gewesen, sagt Hedwig, daß sie mich nie gefragt hat, ob ich ein kleines Stück von dem Fleisch haben will, sie hat sich vielleicht gar nicht vorstellen können, daß es Leute gibt, die Hunger haben.
Ein Stückchen von dem Fleisch, habe ich manchmal gedacht, sagt Hedwig, und ich könnte für die ganze Familie eine herrliche Suppe kochen. Vielleicht hätte sie mir etwas gegeben, wenn ich sie darum gebeten hätte, aber ich habe es nicht gewagt, sie zu bitten, und ich wollte auch nicht als Bettlerin dastehen.
Dabei sind wir doch wirklich arm wie Bettler gewesen.
(Friedl, Christians Schulkollege aus dem Gymnasium, das auch Anni besucht hat, noch mit siebzehn Jahren einberufen und an die Front geschickt, in amerikanischer Gefangenschaft beinamputiert, hatte um diese Zeit als Student in Freiburg mit siebenundfünfzig Mark monatlich auszukommen. Fünfundzwanzig Mark, sagt Friedl, habe sein Zimmer gekostet, vom Rest mußte er den Lebensunterhalt bestreiten.
Wenn ich Brot gekauft habe, sagt Friedl, dann habe ich es drei Tage lang liegen lassen, altes Brot gibt mehr aus als frisches.
Natürlich habe ich Hunger gehabt. Erst 1951 hat es hundertfünfzig Mark zusätzlich für das Semester gegeben, von diesem Geld mußten die Bücher gekauft werden.
1984 sagt ein Mann, der im Zug von München nach Berlin unterwegs ist und von der Zeit nach dem Krieg erzählt: Zum Glück ist mein Bruder gefallen, sonst hätte ich, als ich eine Anstellung bekam, nicht einmal eine passende Hose anzuziehen gehabt.)