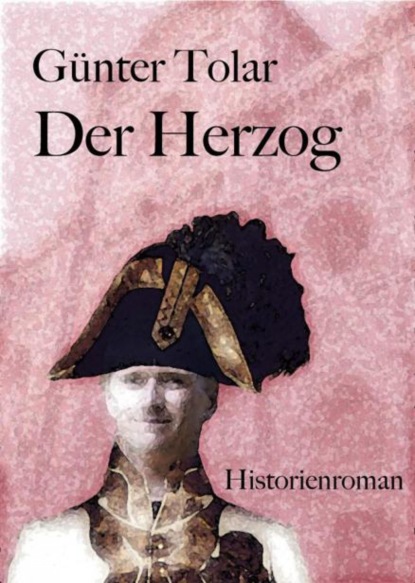- -
- 100%
- +
Anlässlich eines gemeinsamen Museumsbesuches hat Joseph Moritz dem Herzog von diesen seinen Empfindungen beim Anblick des David in Florenz erzählt. Es ist dies übrigens die einzige Erwähnung eines gemeinsamen kulturellen ‚Ausganges‘.
Die Replik des Herzogs zeigt seine wesentlich weniger von Ästhetik getragene Einstellung der Kunst und dem in ihr Dargestellten gegenüber.
... Franz fügte dem von mir als Florentinische Empfindung vorsichtig geschilderten Gedankenbild seinen eigenen Anhang hinzu: „Stell dir vor, ich, nackt auf diesem Sockel, mit meiner Gestalt und meinem langen - du weißt schon - in Florenz. Ich weiß nicht, ob die Leute mehr oder weniger hinschauen würden.“
Dann wies Franz auf eine nackte Männerstatue, die in einer Nische stand, und flüsterte: „Die Pimmel der Statuen sind alle so kurz und so fest."
Er dachte nach und fügte dann ganz ernst hinzu: „Das liegt wohl am Marmor. Der ist kalt. Und kalt zieht zusammen!“
Bei den letzten Worten stieß er mich unmerklich vertraulich an.
Ich war nicht wenig echauffiert ob der Kühnheit des Franz, so Intimes so keck in der Öffentlichkeit herauszusagen. Ich erinnerte mich aber auch der manchmal sehr mangelhaften Beheizung der Gemächer des Franz.
Diese Unterhaltung führten wir so, daß es für die anderen nach einem angeregten künstlerischen Diskurs aussehen mußte; zwei Schritte hinter uns war nämlich der Foresti; der war allerdings höchst unaufmerksam und auch gar nicht sonderlich angetan von den ausgestellten Kunstwerken, die der Franz zu besichtigen gewünscht hatte.
Es war uns halt eine Lust, öffentlich zu tändeln und niemand sieht’s.
Joseph Moritz und der Herzog trafen einander also auch manchmal offiziell und öffentlich. Es mag ihnen eine diebische Freude gemacht haben, ganz nahe an der möglichen Entdeckung ihres ‚Geheimnisses‘ zu wandeln, zu spielen, zu ‚tändeln’.
Der Herzog von Reichstadt hatte, trotz der strengen Etikette, die das Leben des Sohnes von Napoleon und Enkels Franz des I., einer hochnotpeinlichen Figur von historischer Brisanz, unterliegen musste, auch ein Privatissimum. Es wäre jetzt abgeschmackt, mit moralistisch gerunzelter Stirn die Frage zu stellen, warum sich dieses Privatissimum justament zwischen zwei Männern begab. Wie hätte die Sache denn ausgesehen, wenn anstelle des Joseph Moritz ein Mädchen gewesen wäre? Sie hätte gar nicht, wie Joseph Moritz, zehn Jahre älter als der Herzog sein müssen. Ein ‚aufgeflogenes‘ Verhältnis des Herzogs mit einer Frau, wäre einer Katastrophe gleichgekommen. Eine Männerfreundschaft hingegen war normal. Man könnte vielleicht fragen, warum niemand bemerkt hat, dass das mehr war als eine Männerfreundschaft. Damals hat niemand gefragt. Und wenn? Metternich allein hätte die Größe der ‚Katastrophe‘ festgelegt. Der Kaiser wäre vielleicht damit befasst worden; er hätte wahrscheinlich abgewunken. Skandale, die geheim bleiben, sind keine Skandale. Der junge Dietrichstein? Ein netter, begabter, tüchtiger junger Herr. Wenn der Herzog schon Gesellschaft pflegte, von der niemand wusste, dann hätte es schlechtere sein können. Der Kaiser hätte vielleicht zu höherer Aufmerksamkeit gemahnt - und hätte die Dinge laufen lassen. Die Zusammenkünfte der beiden wären dann wohl dem offiziellen Terminkalender des Herzogs einverleibt worden, hätten also das Flair des Geheimen, Privaten, Intimen verloren. Denn es waren ja die im Kalender des Herzogs vorgeschriebenen Mußestunden, in denen das Privatissimum stattfand, geheim, unter Umgehung der Wache, umgeben von dem, vom Herzog selbst zitierten, ‚Netz, das auch schützt‘.
Anders mochte die Situation auf Joseph Moritz‘ Seite aussehen. Seine Liebe zum Herzog ist sehr tief gegangen, jedenfalls tiefer, als es zwischen Männern üblich ist. Seine Liebe entspringt aus dem Romantischen, jenem Teil der Psyche also, der das Blut in Wallung bringt, zum Sieden, der Gedanken abschaltet und Körper zu einander zieht. Joseph Moritz entwickelte allerdings sehr bald auch ein, man würde heute sagen, von Sex gesteuertes Verhalten. Sex, der einmal dem rein Körperlichen diente und auch von dort gefordert wurde, und der, allerdings nur mit dem Herzog, aus der Liebe kam.
Seine eigene Rolle schildert Joseph Moritz in seinem Tagebuch mit immer mehr Offenheit, die bald jedwede Selbstschonung fallen ließ. Wie es allerdings mit dem Herzog wirklich stand, können wir nur versuchen, aus den Schilderungen des Joseph Moritz geschmackvoll und möglichst gerecht zu deuten. Wir haben, was diesen Teil des Lebens des Herzogs von Reichstadt betrifft, keine andere Quelle, als das Tagebuch des Joseph Moritz von Dietrichstein. Und der war, die vorigen Zitate haben es schon gezeigt, offensichtlich auch ein Dichter. Oft ohne es zu wissen, oft aber auch, weil er es so wollte. Er überlässt es unserer Auslegung, wo die Wirklichkeit aufhört und die Dichtung anfängt. Wenn er uns überhaupt Hinweise gibt, dann in begleitenden Worten, nie aber in der Schilderung eines Vorganges.
Der Dichter manifestiert sich ganz deutlich in der weiteren Schilderung aus Florenz.
Es mag ja vielleicht auch der rote Wein sein, dem ich hier in erhöhtem Maße zuspreche und der mich auf solche Gedanken bringt. Ich will aber nicht sagen, daß es nur der Wein sei, der mich an dich denken läßt, Franz. Ich weiß, daß du mich jetzt fragen würdest: „Denkst du immer nur dann an mich, wenn du trinkst?“
Aber vielleicht hättest du diese Frage gar nicht gestellt. Vielleicht ist es dir ganz und gar gleichgültig, ob ich an dich denke, oder nicht. Wahrscheinlich wäre es dir lieber, wenn deine Mutter mehr an dich dächte. Oder daß dein Vater noch lebte, daß er an dich denken könnte. Aber so, ohne Vater, ohne Mutter, wohin geht denn deine Liebe? Zu mir?
Du hast recht. Es mag wirklich der Wein sein, der meine Tränen und mein Denken auf solche Wege lenkt.
Napoleon ist tot, die Mutter Marie Louise regiert in Parma und treibt es dort mit dem Grafen Neipperg. Wir werden das alles noch breitest erfahren.
KAPITEL 3
Im Jahr 1831, dem Jahr, in dem Joseph Moritz seinen dreißigsten Geburtstag beging, begann er, sein Tagebuch zu ergänzen, die Zeit ‚vorher’, nachzutragen. Die Notwendigkeit hierfür hat er sich sehr genau überlegt.
Der Franz spricht immer wieder von Flucht; nicht nur zu mir, sondern auch zu anderen. Und ich sage ihm immer wieder, daß das gefährlich sei. Spreche ich aber von Gefahr, scheint er mich sogleich zu fragen: wo ist sie, die Gefahr, sag mir, wo, damit ich mich ihr stellen kann. Mir scheint, er meint, daß sein Leben viel eindrucksvoller wäre, hätte er mehr Gefahren zu bestehen. Aber ich sage immer wieder, ob er nicht meine, daß es gefährlich sei, auch mit anderen als mit mir über seine Pläne zu sprechen. Heute hat er ganz vergnügt abgewinkt: „Gefahr! Verantwortung ist immer Gefahr!“
Ich vermag ihm nicht immer mit dem gleichen Feuer zu folgen, mit dem er von seinen Plänen zu sprechen pflegt. Derzeit bewundert er sehr die Polen, deren Krone er gerne angenommen hätte: „Jomo, die Vorstellung, an der Spitze der Polen zu marschieren, beherrscht mich mehr als alles andere. Ich würde freudig mich in Polen krönen lassen...“. Falls da ein Verführer wäre, würde Franz sicher seine Schritte in diese Richtung lenken. Aber da ist kein Verführer. Und der Franz ist traurig.
Prokesch-Osten -
- wir lernen ihn später noch näher kennen -
- sagte es sehr genau: „Die Krone Frankreichs ist ja nun in schwer erreichbare Ferne gerückt, aber die Länder Griechenland, Italien, Belgien oder eben Polen brauchten nur zu winken und der Herzog würde hinreisen oder hinfliehen, um sich an die Spitze des Landes stellen zu lassen.“
Aber es ertönte kein ernsthafter Ruf. Den Joseph Moritz hat es übrigens sehr geschmerzt, dass der Herzog mit ihm kaum über seine politischen Ansichten und Absichten sprach.
Wenn der Franz so seinen Träumen nachhängt, ist er mir fremd. Da ist er nicht mein geliebter Freund, sondern ein Herrscher ohne Krone und ohne Hoffnung. Ein Mensch, der sich für Höheres, für Besseres bestimmt fühlt; für Höheres, das ihm, so meint er und so will es auch die Historie, von der Geburt an bestimmt ist. Aber die Entwicklung der Zeiten nimmt auf seine Geburtsrechte keine Rücksicht.
Vater macht sich oft seine Gedanken: „Armer Teufel! Dazu geboren, um nichts zu werden. Nichts. Wofür ihn erziehen? Sie sollten ihn lieber leben lassen!“
Dann wandte er sich mir zu und Ärger kam in sein Gesicht: „Ich sollte sowas nicht vor Ihm schwatzhaftem Buben sagen!“
Vater hält mich für einen schwatzhaften Buben.
Das Höchste, was mir der Franz zubilligt ist, daß er heute gesagt hat: „Warte nur, Jomo, mit dir will ich nur das Heitere erleben, laß mich den Ernst mit denen erörtern, die ich nicht schätze und nicht mit denen, die ich liebe.“
Ist gar nicht wahr, das hat er nicht gesagt. Aber sein Blick, und es war ja nur ein Blick, den er mir zuwarf und den er mit keinem Wort ergänzte, ihn somit meiner Übersetzung überließ, dieser Blick sagte mir... aber vielleicht ist es auch gar nicht wahr.
Ich bin viel allein gelassen. Aber es kann mich nur einer allein lassen, der Franz. Niemand außer ihm fehlt mir.
Damals, in dieser Einsamkeit, fasste Joseph Moritz den Entschluss, das Bisherige aufzuarbeiten, sein Tagebuch um die ‚Zeit davor’ zu ergänzen.
Ich hatte heute Zeit und Muße. Das Wetter war so, wie ich es am meisten verabscheue, es war ohne Farben, grau und überschattet von dem Geräusch, das ich hasse, dem Geräusch des Regens. So blätterte ich zum ersten Male in meinem Tagebuch. Ich fand mich selber in vergangenen Zeiten. Und wenn mir der Franz schon nicht persönlich seine Anwesenheit schenkt, so rief ich ihn mir wenigstens mit Hilfe meiner Notizen. Dabei komme ich nicht umhin, festzustellen, daß mein Tagebuch im Lauf der Zeit immer mehr zu einem Buch über den Franz wird. Über mich und den Franz; über den Franz und mich.
Aber wie hat es angefangen? Das Tagebuch ist unvollständig, sind doch die Jahre, in denen ich noch kein Tagebuch führte, nicht enthalten, obwohl ich damals den Franz schon gekannt habe. Kurzum, ich habe mich heute entschlossen, diese Zeit nachzutragen, in meinen Erinnerungen zu kramen und mich an die Jahre mit Franz zu erinnern, als es dieses ‚Franzensbuch’ noch nicht gab.
Der Schriftduktus zeigt uns eine Pause an, die Joseph Moritz eingelegt hat.
Da sitze ich nun seit über einer Stunde mit gezückter Feder und weiß nicht, wo beginnen. Es ist mir nämlich nicht möglich, heute, nachher, so zu tun, als würde ich es damals schreiben, als ich es erlebte. Ich kann nicht so tun, als kennte ich den Franz noch nicht so wie heute. Ich kann nicht so tun, als wäre der Franz jetzt der kleine Bub, als den ich ihn kennengelernt habe. Ich kann nicht so tun. Ich, der Franz, wir beide, unser Leben war damals mit uns im Wachsen. Das IST nicht mehr, das WAR alles. Verstehst du das?
Joseph Moritz ist hier zweifellos an die Grenzen dessen geraten, was er für Dichtung oder Dichtkunst hielt. Hier bemerken wir aber auch das völlig verstellte Bild, das er von sich selber hatte. Niemand hat damals von ihm verlangt, das, was er erlebt hat, wie Heutiges zu erzählen. Einfach niederzuschreiben, was er empfand, war dem Joseph Moritz offenbar zu wenig; das war nicht des Dichters Werk, zu empfinden und das zu notieren. Beim Dichter musste seiner Ansicht nach auch ein gewisses Maß an Umformung, an Verformung, an Neuformung stattfinden, ob sie nun passte, sich aufdrängte, sich so ergab - oder nicht. Und wenn sie sich schon nicht aufdrängte, weil sie halt nicht passte und sich daher auch nicht ergab, dann musste man den ‚Stoff’ eben zwingen. Und genau dieses ‚Zwingen’ meinte Joseph Moritz nicht zu vermögen. Er hätte lügen müssen. Er hätte das tun müssen, was allerdings viele Schriftsteller tun, die Selbsterlebtes einfach in eine so genannt überhöhte und damit künstlerische Form umgießen, und damit Kunst vorgaukeln, Dichtkunst vorgaukeln, indem sie lügen und Selbsterlebtes zum Einfall umbilden.
So ergibt sich ein für Joseph Moritz trauriger Schluss: Er hätte nur die richtigen Gesprächspartner haben müssen; dann wäre er vielleicht kein Dichter, aber seiner selbst sicher geworden. Er hätte eben geschrieben, nicht als Dichter und nicht für eine Nachwelt, sondern einfach deshalb, weil es seine Art war, sich mitzuteilen, indem er es niederschrieb und beim Schreiben noch einmal durchdachte, noch einmal erlebte, nocheinmal durchlitt, sich noch einmal freute.
‚Verstehst du das?’, war die letzte Eintragung. An ihr knüpft Joseph Moritz nach einer Pause, die möglicherweise sogar ein paar Tage gedauert haben konnte, an.
Wer sollte mich denn verstehen? Wen habe ich denn da angesprochen? Wen habe ich da angefleht? Meine Mutter? Mutter! Mein Respekt verbietet mir, mehr zu sagen. Meinen Vater? Mein Vater! Er ist schon nicht glücklich mit mir, wie er mich kennt. Lernte er gar noch die Winkel an mir kennen, die ich verheimlichen muß, was wäre denn gar dann?
Ich muß mir einen anderen Platz zur Aufbewahrung meines Tagebuches suchen. Oder nicht alles schreiben. Aber ich schreibe sowieso nicht alles. Das, was ich schreibe, errettet mich vor dem Tode des inneren Erstickens. Oder vor einem anderen baldigen Tode.
Einem Freund geben? Das Tagebuch. Einem Freund? Franz, ja, der hat Freunde. Freunde, denen er vertrauen könnte, daß er ihnen ein Tagebuch wie meines hier anvertrauen dürfte? Dem Franz sind viele treu. Treu ergeben. Stehen zu ihm, nein, sind ihm ergeben. Der Kaiser ist sein Freund, sein verläßlichster. Ihm kann ich zweifellos nicht mein Tagebuch zur Aufbewahrung übergeben. Kaiserin Karolina Augusta? Sie liebt den Franz, sagt auch heute noch ‚Fränzchen’ zu ihm. Sie ist die einzige, die sich ihm gegenüber Herzlichkeiten herausnehmen darf. Sie ist auch die einzige, deren Herzlichkeiten gegen den Franz mir keinen Stich ins Herz versetzen.
Was tun?
Ich möchte alles vom Franz erzählen, alles von früher, als ob er da säße. So säße, wie er sitzt, wenn wir allein sind: Den mageren Oberkörper etwas eingesunken, leicht nach vorne gebeugt, die langen Beine gegrätscht von sich gestreckt, mit dem linken Arm auf die Lehne des Sessels gestützt, die rechte Hand auf dem rechten Oberschenkel, knapp in der Beuge, ausruhend, mich aufmerksam betrachtend, beim Zuhören hin und wieder nickend und, wie so oft, nicht ganz bei der Sache.
Dann frage ich ihn: „Franz, hörst du mir zu?“
Und er antwortet so wunderbar lächelnd: „Jomo, es ist zu viel. Nicht nur, WAS du erzählst, ist schön, sondern auch, WIE du es erzählst.“
Dann wird mir heiß, ich spüre mich erröten, er aber lächelt weiter: „Soll ich dir nun zuhören oder zuschauen? Bei dir kann ich nur eines!“
Dann schließt er die Augen. Jetzt kann ich nicht mehr erzählen, denn wenn Franz die Augen schließt, ist er nicht mehr da. Also bitte ich ihn, die Augen zu öffnen. Er tut's und blickt so verschlafen, als wäre er eben aufgewacht. Aufgewacht nach einer Nacht. Es ist Morgen.
Es ist Nachmittag. Ich beschreibe ihn mir, weil ich ihn nicht habe. Was weiß ich, was er tut?
Joseph Moritz ist in Gedanken versunken. Dieses Grübeln, das ihn in den Jahren 1830 und 1831 immer wieder befiel, begann seinem Vater Sorgen zu machen. Schwermut, Neigung zum totalen Versinken, sich zeitweise selbst nicht finden, so erzählte es der Vater dem Doktor Johann Peter Franck. Franck behandelte sowohl den Herzog, als auch Metternichs Sohn Viktor. Auf Vaters Bitten untersuchte er Joseph Moritz einmal, stellte aber keine Krankheitssymptome fest. Damals musste man schon seine Lunge heraushusten, damit der Arzt einen nicht auf einen nicht vorhandenen Ausschlag behandelte, wie es der Doktor Malfatti so lange Zeit beim Herzog tat, bis Doktor Franck endlich die wahre Krankheit erkannte. Da war alles schon zu spät.
„Ein romantisches Gemüt“, attestierte er dem Joseph Moritz. „Hang zu Schwärmerei, Anfälligkeit für mitteltiefe Melancholie“, das waren die näheren Erläuterungen. ‚Mitteltief’, das klang nicht nach Selbstmordgefahr. „Viel gehen in frischer Luft“, war die Therapieanweisung, die Franck dem Grafen Dietrichstein für seinen Sohn mitgab. Franck hat diese Diagnose sogar in seinem Patientenbuch festgehalten. Ein schräges Kreuz am Rande der Eintragung, mehr schon ein X, kennzeichnete den Fall Joseph Moritz von Dietrichstein als harmlos und erledigt.
Heute ist der Franz auf Inspektion zu seinem Regiment gefahren.
Das schreibt Joseph Moritz als einzige Eintragung eines Tages Ende Jänner 1831.
Der Schrift nach folgt der nächste Satz um einiges später.
Heute beginne ich, die Vor-Tagebuch-Zeit aufzuarbeiten. Ich habe Zeit. Der Franz ist bei seinen Kameraden. Ich bin ja kein Kamerad.
KAPITEL 4
Joseph Moritz wusste nicht, wo und wie er mit seinem Bericht „Was vorher war“ beginnen sollte. Er brauchte für seine Überlegungen sogar einige Tage lang. Das WAS und WIE hatte ihn ja schon in einer früheren Eintragung gequält. Je mehr er sich jedoch seinem Vorhaben zu nähern vermeinte, desto mehr Unsicherheiten tauchten ihm auf.
Das Wochenende war kalt und klirrend. Wir gingen kaum aus dem Hause. Mein Vater, der auch in seinen Dienst gehen muß, wenn der Franz nicht da ist, schimpfte wie ein Rohrspatz, zumal sich Metternich noch kaum jemals um die Anwesenheit des Erziehungsstabes des Herzogs gekümmert hatte. Aber just gestern hat er vorbeischauen lassen, wie der Adjutant es ausgedrückt hatte.
„Nicht der Herzog hat mit Ihnen zu studieren, sondern Sie alle haben in Permanenz den Herzog zu studieren!“, so ließ Metternich freilich ohne gegebenen Anlaß, wie ausdrücklich betont wurde, ausrichten.
Mein Vater fluchte, wie ich ihn noch nie gehört habe.
Unser Haus ist bei der strengen Kälte nur sehr schwer zu beheizen. Wirklich warm ist es nur in der Küche, an deren großem Tisch wir auch unsere Mahlzeiten derzeit einzunehmen pflegen. Mäßig warm ist es noch im großen Salon, wo sich die Familie aufhält. Die eigenen Zimmer aufzusuchen ist nur möglich, wenn man sich dort gleich zu Bette begibt. So sind alle mißmutig und beäugen, mangels eigener Tätigkeit, jeder den anderen, wie auf der Suche nach Zerstreuung durch den anderen.
Ich lese ein wenig von Collin. Nicht von Franzens Lehrer. Der dichtet zwar auch. Versucht es halt. Wie ich. Nein, ich lese von seinem Bruder, der - seiner Verbreitung nach - sehr wohl sich zum Berufstand der Dichter zählen darf. Aber ich weiß nicht, was ich da alles gelesen habe. Ich habe leere Worte, aneinandergereihte Buchstaben eingesogen. Und irgendwo im Gehirne verloren, noch bevor ich sie verstanden habe. Wie soll ich da einen Gedanken fassen? Und wenn ich einen fasse, wie ihn niederschreiben? Ich habe so meine Gedanken, gewiß. Aber sie verflüchtigen sich wieder. Wenn ich’s nicht niederschreibe, hält es nicht. Und mir erscheint es qualvoll, daß es sicherlich die besten Gedanken sind, die ich so nicht niederschreibe.
Jetzt sitze ich in meinem Zimmer; es wird kalt und kälter. Ich werde gleich zu Bette gehen. Keiner der Gedanken des Tages ist da. Keiner zum Niederschreiben. So beschreibe ich meine Zeit ohne Gedanken. Vielleicht dann, wenn ich im Bette liege, wenn mein Körper auftaut und sich in jedem Glied füllt mit meinem Denken und Fühlen. An den Franz wohl. Ganz ohne Probleme. An den Franz. Nur schnell einschlafen.
Klamm sind die Schriftzüge. Joseph Moritz ist schlafen gegangen. Die nächste Eintragung spricht vom nächsten Tag.
Plötzlich hab’ ich’s: soll ich berichten ab der Zeit, in der der Franz lebt? Soll ich auch die Zeit vorher erzählen? Habe ich denn gelebt, bevor es den Franz gab? Doch, ich habe gelebt. Zehn Jahre lang. Und dann noch vier Jahre lang, bis ich den Franz zum ersten Male erblicken durfte. So werde ich dem Franz alles das erzählen, was ich seit seiner Geburt erlebt habe.
Ich habe gesagt, ich hab’s. Ich weiß, WAS ich erzählen werde, und ich weiß, WEM ich es erzählen werde. Und da der Franz es nie lesen wird, ist jeder, der es einmal liest, der Franz. Also niemand.
So beginne ich:
Ich weiß noch, daß es Ende März des Jahres 1811 war, als wir erfuhren, daß am 20. März, morgens um neun Uhr und fünfzehn Minuten die Glocken von Notre Dame in Paris und die Glocken aller Kirchen der Stadt mit voller Stärke dröhnten. Ein Kanonenschuß zerriß die Luft. Alle wußten, einundzwanzig Schüsse würden die Geburt einer Tochter des Franzosenkaisers Napoleon und seiner Gemahlin Marie Luise verkünden. Erzherzogin Marie Luise, deiner Mutter, Franz, die ein Jahr zuvor in der Wiener Augustinerkirche per procura mit deinem Vater vermählt wurde. Fünf Tage nach dieser getrennten Hochzeit wurde Ihre Kaiserliche Hoheit an der österreichischen Grenze an Frankreich übergeben, um in das Ehebett Napoleons geführt zu werden.
Franz schlägt die Hände vor das Gesicht. Ich weiß, die Nennung der Mutter verschafft ihm Pein. Denn mittlerweile, wenn ich dies niederschreibe, weiß er schon alles über sie. Und der Vater ist tot.
„Franz, ich will dich nicht quälen. Franz!“
Er löst langsam seine Hände vom Gesicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er geweint hat. Schatten verhüllen eine genaue Sicht in sein Antlitz.
„Sprich weiter“, sagt er fast ohne Ton.
Alle in Paris, die jetzt die Kanonenschüsse zählen, wissen, wenn es über einundzwanzig hinausgeht, dann ist er geboren, der Thronfolger, der sofort mit seiner Geburt König von Rom wird. Nun Franz, es waren mehr als einundzwanzig Schüsse es waren die einhundertein Schüsse. Und sie galten dir. Deiner Geburt. Der Geburt des Königs von Rom. Sohn des geliebten Vaters, den er, so sagte er mir, persönlich nicht in seiner Erinnerung hat. Der König von Rom ist er nun auch nicht mehr.
„Franz“, frage ich zögernd, „soll ich weitererzählen?“
Franz ist blaß, aber er bittet fast: „Sprich weiter.“
Dann erfaßt ihn ein Zorn, er schlägt mit der Faust auf die Lehne seines Sessels - man hört nichts, denn die Lehne ist gepolstert - und er zischt: „Sprich weiter. Erzähl mir vom Entstehen einer Leere.“
„Einer Leere?“, frage ich erstaunt und nicht verstehend.
„Meines Lebens“, sagt er so, als wollte er sich verbessern.
Ich wollte nicht verstehen, weil ich gerade dabei war, mich in meine eigene Geschichte zu versenken, uns so vertiefte ich mich wieder in die Erinnerung.
Es war das Jahr, in dem unsere Familie viel Geld verlor. Mein Vater schimpfte irgendwas von „unfähiger Finanzverwaltung“ und „da schmeißen sie das Geld hinaus für alles mögliche und wir dürfen zahlen“. Unsere Bankozettel, Geld aus bedrucktem Papier, waren immer wertloser geworden. In jenem Jahr mußten wir sie umtauschen gegen - ich glaube - Einlösungsscheine. Neues Papier, das keinen Wert hatte. Meine Mutter fragte damals ängstlich: „Aber unser Silber, das bleibt doch was wert, Herr Vater?“
Der Vater zischte, blickte sich um, daß ihn nur ja niemand hörte, dann maßregelte er meine Mutter: „Geh’ sie doch gleich auf die Gass’n und erzähl’ sie’s einem jeden.“
Erst später erfuhr ich, daß mein Vater das gleiche getan hatte, das viele damals taten. wenn sie’s hatten: er hatte Silbergeld gehortet, in einer Truhe im Keller.
Nun, uns hat’s ja nicht so sehr getroffen, wir haben ja unsere Güter. Aber es soll viel Elend gegeben haben draußen, wo die Leute wohnen. Nicht nur, weil das Geld weniger geworden war, sondern weil für die, die kaufen mußten, auch noch alles teurer wurde.
„Arme Leut‘“, sagte mein Vater, „an die denkt keiner!“
Meine Mutter aber war nicht weiter unruhig: „Die Polizei paßt schon auf, daß uns nichts g’schieht! Gell?“
„Die Polizei“, antwortete mein Vater, „das sind ja auch keine armen Leut’. Da schaut schon der Metternich drauf.“
Vom Metternich war damals überhaupt viel die Rede.
Ich hatte den Franz vergessen: „Verzeih’, ich will deinem Wohltäter nichts nachsagen. Aber laß’ mich dennoch, soweit es geht, bei der Wahrheit bleiben.“
Franz staunt: „Meinst du, Jomo, ich erzähl’ ihm vielleicht was?“
Ich bin verwirrt: „Ich weiß nicht. Mußt du nicht? Muß einer wie du nicht? Muß ich jetzt schweigen?“
Der Franz lacht: „Ich will es nicht auf die Probe ankommen lassen, wer wem gegenüber was muß!“
Ich fühle mich plötzlich ohne eigenen Willen. Ich brauche einen Befehl. Aus mir selber kommt keiner. Franz ist mir im Augenblick fremd. „Metternich oder ich“, das sind beinahe gotteslästerliche Reden.