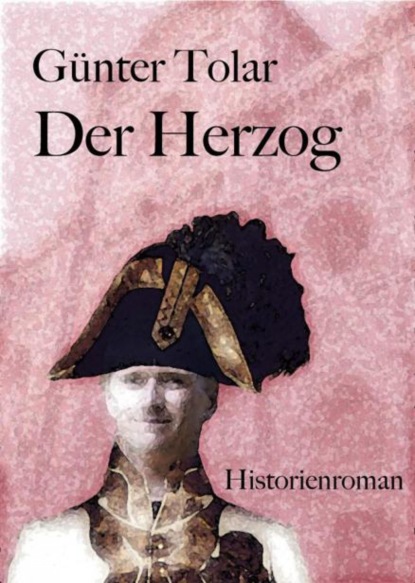- -
- 100%
- +
Jetzt seufzt er, blickt mich an, dreht sein Gesicht ganz aus dem Schatten heraus, und sagt herausfordernd: „Na?“
Ich weiß plötzlich so vieles nicht. Wir haben im selben Jahr das „Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch“ bekommen. Aber es hat auch nichts genützt, als der Hornbostel, der Seidenfabrikant, den selbstwebenden Webstuhl erfunden und auch gleich in Betrieb genommen hat. Früher hat er für jeden Webstuhl einen Weber gebraucht, für Tag und Nacht also zwei. Jetzt treibt ein Schwungrad gleich acht Webstühle an und er braucht nur noch drei Leute für die acht Webstühle.
Ja, und der Heinrich von Collin, der Dichter, der Bruder von deinem Lehrer Matthäus von Collin, der ist damals gestorben.
Ein Schatten von Trauer zieht über Franzens Gesicht, denn auch der Matthäus von Collin, sein Lehrer, ist im November 1824 gestorben.
Ich aber beschließe jetzt, die Schatten auf dem Franz nicht mehr zu berücksichtigen, indem ich jedesmal auf sie einzugehen versuchte.
Ich vertiefte mich wieder in die Vergangenheit. Der Schikaneder ist gestorben, 1812 glaube ich. „Er hat alles verjuxt!“, spottete mein Vater. „Schulden machen und dann wahnsinnig werden“, das war sein Urteil über Schikaneders Leben.
„Hat er wirklich so gedacht?“, fragt der Franz. „Ich möchte über meinen Erzieher nicht solches hören, wenn es nicht ganz exakt der Wahrheit entspricht, Jomo. Denk’ nach! Hat dein Vater das gesagt?“
Es war nicht der Funken von Verlegenheit, der mich etwa jetzt befallen hätte. Wußte ich doch, daß mein Vater Mozart über alles schätzte und liebte und der festen Meinung war, daß Schikaneder den Mozart schamlos ausgenutzt hatte und viel Geld hatte, während Mozart an manchen Tagen nicht wußte, wie weiterleben. Und der Mozart wäre nun einmal der gewesen, dem aller Reichtum zu gönnen war, nicht der Schikaneder, dieser Opportunist schlechthin, der sich ein Genie zu Diensten machte.
Franz lacht: „Liebe und Ungerechtigkeit, wie nahe liegen sie doch zusammen!“
„Ja“, antworte ich ereifert, „weil die Liebe zu dem einen so viel Liebe zu anderen ausschließt. Ausschließen muß. Liebe ist an einen - darf ich so sagen - festen Gegenstand gebunden. Und der wiederum frißt alle Liebe auf. Alle Liebe!“
„Schon gut, schon gut“, beschwichtigt mich Franz, „ich weiß schon.“
Jetzt wird sein Ton zarter, sein Blick allerdings erreicht mich aus dem Schatten, in den er sein Antlitz zurückgezogen hat: „Ich weiß schon, Jomo.“
Joseph Moritz hat dies nicht alles in einem Zuge geschrieben. Dem Schriftduktus nach dürfte es sich über einige Tage, mindestens sechs oder sieben, hingezogen haben.
An der Stelle, an der wir jetzt halten, ist die Unterbrechung allerdings besonders auffällig, da sie von starker Emotion getragen scheint. Er hat hier aufgehört. weil er einerseits von seinem Gefühl übermannt worden war, andrerseits aber mit dem Kopf gegen eine Wand gerannt war, wie er vermeinte.
Ich habe ein Stück des bisherigen gelesen. Ich hätte es nicht tun sollen. Alles, was ich bisher über früher geschrieben habe, beweist doch nur, daß ich es dem Franz gar nicht so erzählen kann, wie es war. Er korrigiert mich während des Schreibens. Er sucht aus, was wichtig und was unwichtig ist. Er läßt gar keinen anderen Satz zu, als den, der ihm nahegeht, der seine Empfindungen anspricht, der ihn interessiert.
Was bin ich für ein Dichter!
Ich versuch’s halt weiter.
Die vielen Baustellen, die wir heute in unserem Wien haben, rühren auch aus der Zeit deines ersten Lebensjahres. Dein lieber Vater Napoleon - das ‚lieber’ bezieht sich auf die Bezeichnung, die wir ihm damals gaben, als er uns 1809 zum zweiten Male heimsuchte - hatte die Burgbastei sprengen lassen. Ein paar Jahre lang wurde überlegt, ob man die Mauer wieder aufbauen solle oder nicht. Dann aber entschied man sich höchsten Ortes, die Innenstadt an der Stelle zu vergrößern, die Mauern also nicht mehr aufzubauen. Seither haben wir dort eine Baustelle. Sie haben einen Park angelegt, das Äußere Burgtor errichtet. Und wie sie aus dem Paradeplatz den Äußeren Burgplatz gemacht haben, da hat man in unseren Kreisen schon etwas gestöhnt, war doch die ‚Ochsenmühle’ plötzlich verschwunden.“
Franz lacht: „Ochsenmühle? Was ist denn das?“
„Das ist nicht mehr“, antworte ich, „das war eben. Das war der Korso. Und weil dort nicht viel Platz war, mußten wir immer im Kreis gehen. Und von dieser ‚Im Kreis Geherei’ hat unser Korso den Namen ‚Ochsenmühle’ gehabt. Du weißt, diese Mühlen, die von Ochsen angetrieben werden, die immer im Kreis gehen.“
„Kein schöner Name, alles Ochsen?“, lächelt Franz.
Keiner dachte daran, ein Ochse zu sein, wenn er dorthin ging, um sich sehen zu lassen, obwohl er daheim sagte, er ginge jetzt auf die ‚Ochsenmühle’. Ein Jahr später ist dann der Eipeldauer gestorben. Er war, pardon, vor allem durch deinen Vater, als Schreiber nationaler, patriotischer Schriften sehr beliebt. Ja, und der Schubert ist irgendwie aufgetaucht. Seine erste Symphonie wurde uraufgeführt. Ich war mit dem Vater dort, frag’ mich nicht, Franz, wie’s war, ich kann mich nicht mehr erinnern. Mein Vater aber verkündete mir damals seherisch: „Den Namen wird man sich merken müssen!“
„Auch schon tot“, murmelt der Franz.
Ja, jetzt, da ich dies schreibe, ist er schon drei Jahre tot.
„Einunddreißig Jahre ist er geworden“, sinniert der Franz. „Ich bin zwanzig. Und du dreißig!“
Der Franz sieht mich groß an: „Dreißig, Jomo!“
Ich lache: „Ich kann noch nicht sterben, ich habe noch nicht eine einzige Symphonie geschrieben!“
„Wirst du je sowas Bedeutendes schreiben?“, fragt plötzlich ganz ernst der Franz; dann fügt er leise hinzu: „Ich wohl nicht. Bei mir müßt’ es schon eine Schlacht sein. Eine Schlacht wie eine Symphonie!“
Napoleon, Cäsar, Hannibal, das sind Franzens Künstler.
Dann rafft sich der Franz auf: „Mein Vater, der hat euch damals ganz schön zugesetzt, oder?“
Ich zögere mit meiner Antwort. „Es war Krieg. Ja, in Leipzig haben wir Napoleon besiegt.“
„Wir“, gibt sich Franz plötzlich aufgebracht, als wäre er der Verteidiger seines Vaters in einem Prozess, „das waren immerhin Österreich, Preussen und Russland. Sie alle hat’s gebraucht... Dennoch“, träumt er jetzt, „eine herrliche Schlacht, ich habe sie in allen Einzelheiten studiert.“
Eine herrliche Schlacht, denke ich für mich. Allein fast fünfzehntausend Österreicher blieben im Felde. Insgesamt fünfunddreißigtausend Tote und Verwundete auf Seiten der Franzosen, die Verbündeten verlieren noch mehr.
Ach, denke ich mir, was soll denn das bedeuten. Dem Franz das alles vorrechnen, nur weil er seinen Vater bewundert und liebt? Ich spüre eine Entfernung zwischen Franz und mir. Seine Überlegungen sind dynastisch, staatsmännisch, ich scheine da doch mehr mich dem Volke verbunden zu fühlen. Aber ich will diese Entfernung nicht, also erzähle ich weiter, in der Hoffnung, die kleine Kluft, vor der ich solche Angst habe, zu schließen.
Hier hat Joseph Moritz wieder abgebrochen. Er verstrickte sich beim Versuch, das Bisherige aufzuarbeiten, zum ersten Mal in einen Konflikt mit dem Herzog. Vergessen wir nicht, der Herzog war immer noch auf Inspektion. Es war immer noch Ende Jänner 1831, vielleicht schon Anfang Februar. Joseph Moritz nannte sein Schriftwerk zwar ein Tagebuch, vergaß allerdings meistens die Datierung, so, als wollte er eigentlich einen Roman, eine fortlaufende Geschichte schreiben. Jedenfalls brachte ihn die Beschäftigung mit dem, was vor dem Herzog von Reichstadt mit ihm, Joseph Moritz, war, in gedanklichen Widerstreit mit dem Herzog. Aber was geschehen war, war nun einmal geschehen. Die damalige Realität vertrug sich nicht immer mit der heutigen Realität. Ihm gegenüber saß der Sohn Napoleons, der Sohn des Mannes, der letzten Endes mehr oder weniger das ganze Leben des Joseph Moritz und seiner Familie bestimmte.
Joseph Moritz hat da aber einen rigorosen Entschluss gefasst:
Ich werde mich ab jetzt kürzer fassen.
So schreibt er schon am nächsten Tag.
Gestern habe ich mich wohl verrannt. Ich habe deinen Einwänden und Bemerkungen mehr Gewicht geschenkt, als meiner eigenen Erzählung. Und um diese allein soll es hier ja gehen.
Verzeih mir, Franz, wenn ich dich also jetzt zum Schweigen verurteile. Wie ich allerdings auskommen werde, ohne mir deine liebe Stimme wenigstens vorzustellen, indem ich ihr in meinem jetzigen Geschreibe einige Worte zu sagen gebe, weiß ich nicht. Laß es mich versuchen. Ich weiß allerdings jetzt schon, wenn ich etwas versuche, daß mir das nie gelingt.
Ich bin ja schon bei dem Jahr angelangt, in dem - ich darf gar nicht sagen - eine glückliche Fügung es schickte, daß du nach Wien kamst.
„Warum darfst du das nicht sagen?“, mischt sich der Franz trotz meines Flehens ein. „Daß wir beide einander kennen, ist das keine glückliche Fügung?“
Dann seufzte er und - eben hatte er mich noch im Licht so klar angesehen - zieht sein Antlitz in den Schatten zurück, aus dem er leise spricht: „Vielleicht die glücklichste Fügung meines gesamten Schicksals, wer weiß?“
Ich schüttle verzweifelt den Kopf, weiß nicht, freue ich mich oder ärgere ich mich, mache also verbissen weiter.
Immerhin mußte dein Vater erst einmal abdanken und wurde auf das Fürstentum Elba geschickt. Der Bourbone Ludwig XVIII. hat den Thron Frankreichs wieder. Und deine Mutter Marie Louise kommt mit dir nach Wien zurück.
„Mit mir im Gepäck“, lächelt Franz zynisch, „denn ich war ihr sicher schon damals eine Last.“
Drei Jahre warst du damals alt, du kannst also noch keine große Last gewesen sein. Jetzt gebe ich mich zynisch.
Dann fällt mir aber ein, wie unser Kaiser, nachdem er den Frieden von Paris ausgehandelt hatte, am 16. Juni 1814 nach Wien zurückgekehrt ist.
„Ich weiß“, stöhnt Franz leise, „da kann ich mich gerade noch erinnern, daß ich da auch herumstehen habe müssen!“
Jetzt äußert er sich ganz aus der ihm zustehenden Sicht von oben her: „Was soll denn da Besond’res dran sein?“
Joseph Moritz scheint durch diese Äußerung in Verwirrung zu geraten. Immerhin hat ihm das ganze Rückkehr-Zeremoniell offensichtlich sehr gut gefallen. Durch des Herzogs herablassendes Wesen fühlt er sich in die Reihe der Plebs versetz, der Leute, denen so Etwas halt gefällt!
Was willst du? Ganz Wien hat aufgeatmet. Rund eineinhalb Jahrzehnte waren wir außenpolitisch und militärisch bedroht. Und jetzt schien endlich Ruhe, Beruhigung in Sicht. Was willst du? Einem Volk verwehren, daß es feiert? Der Kaiser wurde im Triumph empfangen.
Jetzt kennt er kein Taktgefühl mehr dem Sohn des Mannes gegenüber, dessen Untergang ganz Wien feiert.
Auf das Glacis vor dem Kärntnertor haben sie einen wunderschönen Triumphbogen hingestellt. Aber man hat es dem Kaiser auch angesehen, daß er was Gutes mitbringt. Seine dunklere, gesunde Gesichtsfarbe ist ihm gut angestanden. Meine Mutter stellte fest, daß die knappere, modisch wattierte Pariser Uniform seiner Gestalt eine Fülle und Eleganz gaben, die man sonst an ihm keineswegs gewohnt war. Und mein Vater stellte fest, daß - im Gegensatz zu seinem Äußeren - sein Wesen wohltuend gleichgeblieben sei: dieselbe Leutseligkeit, derselbe mit der tiefgefühlten Freude rückhaltende Ernst, dasselbe Gemisch von Würde und Bescheidenheit in seinen Zügen...
Weit und breit keine Zwischenrede mehr vom Herzog. Joseph Moritz konnte ihn vergessen und berichten, wie es ihm und nur ihm ums Herz war. Und gleich wurde sein Stil freier und flüssiger, wenn er sich der immerwährenden Kontrolle des Herzogs entzogen hat.
Und am Abend ist die ganze Stadt festlich beleuchtet. Ich erinnere mich da besonders an die Beleuchtung des Odescalchi’schen Palastes; er war überirdisch schön beleuchtet. Als würde er nicht fest gemauert auf dem Boden stehen, sondern schweben; nicht hoch, sondern gerade so, daß es den Boden nicht berührt und sich vielleicht gar schmutzig machen könnte.
Ach Gott, ich weiß so viele Einzelheiten gar nicht mehr; eines jagte das andere. Den Kongress haben sie veranstaltet, wo sie das Chaos, das Napoleon hinterlassen hat, neu regeln wollten. Bälle hat es gegeben, Militärfeste und Militärparaden, eine wunderschöne Schlittenfahrt, wo sie alle aus der Stadt nach Schönbrunn hinaus gefahren sind. Mein Vater mußte damals mit und regte sich fürchterlich über die Verschwendung auf. Zurückgekommen ist er mit einem recht starken Schnupfen. Mutter hat damals zu ihm gesagt: „Siehst du, das kommt von der dauernden Schimpferei. Hättst dir lieber was Warmes angezogen!“
Mein Vater antwortete nicht. Er antwortete meiner Mutter nie vor uns allen, wenn er ihr etwas Ernsthaftes zu sagen hatte. Und er hatte ihr sicherlich etwas Ernsthaftes zu sagen nach dieser respektlosen Bemerkung.
Am 5. März, ich glaube, 1815 war es -
„Ja“, sagt der Herzog.
Ich erschrecke. Der Herzog. Ganz so sieht er mich jetzt an. Der Herzog. Nicht der Franz. Der Herzog. Der zutiefst getroffene Sohn Napoleons. Ja, kommt mir in den Sinn, du schaust eben der Geschichte in das Gesicht. Ich sehe nur die Geschichte, ich habe den Menschen dahinter vergessen.
„Ja“, hat er gesagt.
Also 1815. Er wird es wohl wissen: Am 5. März. Ich weiß es noch genau, weil mein Vater am selben Tag zürnend sagte: „Und ich soll der Erzieher von seinem Buben werden. Das hat sich wohl jetzt!“
Am 1. März war nämlich Napoleon aus Elba zurückgekehrt. Alle waren sie durcheinander; auch der lustige Kongress ging nicht so recht weiter.
Mein Vater aber sagte damals: „Hat auch sein Gutes, jetzt müssen sie wenigstens zusammenhalten, weil sie einen Feind haben, vor dem sie sich alle fürchten!“
Aber dann kam ja gottlob bald Waterloo und der Spuk war endgültig vorbei.
„Eine grandiose Schlacht“, sagt Franz leise.
Für den, der Schlachten liebt, vielleicht ja. Ich erschrecke. Der Franz liebt Schlachten. Er muß Schlachten lieben. Er ist zum Staatenlenker erzogen. Ein Staatenlenker muß Kriege führen.
Aber Joseph Moritz sieht seinem Franz offenbar nicht in die Augen. Selbsterlebtes ist eben nicht Geschichte. Für ihn ist Napoleon ein Feind. Und der Herzog ist sein Freund, dem er alles erzählt. Was schert den Joseph Moritz eine verloren gegangene Dynastie? So halten auch seine auftauchenden Bedenken nur ganz kurze Zeit, dann geht er in ungewohnter Konsequenz seiner selbst gestellten Aufgabe des Erzählens nach. Hätte er sich nur selbst zuschauen können, er wäre sicher stolz auf sich gewesen. So aber sieht er gar nichts. Nicht sich selbst und nicht den anderen in seiner armseligen Situation.
Einer war übrigens damals sehr unglücklich; das war der Erzherzog Johann. Er hat sich nicht gerade Freunde gemacht, wie er verkündet hat: „Es ist ein jämmerlicher Handel mit Ländern und Menschen! Napoleon haben wir und seinem System geflucht, und mit Recht; er hat die Menschen herabgewürdigt, und eben jene Fürsten, die dagegen kämpfen, treten in seine Fußstapfen.“
„Das hat er gesagt?“, fragt leise der Franz.
Ich weiß, der Franz verehrt den Erzherzog sehr. Spricht manchmal mit ihm, ist angetan von seinen Ideen. Weiß nicht recht, der Franz, ob er auf seinem dynastischen Standpunkt bestehen soll, oder ob er rückhaltslos die Ideen des Erzherzogs für gut befinden soll. Rückhaltslos, das war es. Es ging nur rückhaltslos. Denn einen Kompromiss ließen die Ideen des Erzherzogs nicht zu.
Ja, das hat er gesagt. Habt ihr darüber nie gesprochen? Der Graf de la Garde hat allerdings die wirkliche Situation des Kongresses viel deutlicher beschrieben; nie, meinte er, sind wichtigere Fragen inmitten so vieler Festlichkeiten verhandelt worden; auf einem Balle wurden Königreiche vergrößert oder zerstückelt, eine Verfassung auf der Jagd entworfen, und bisweilen brachte ein Bonmot, ein glücklicher Einfall einen Traktat zustande, den zahlreiche Konferenzen und geschäftiger Briefwechsel nur mit Mühe zum Abschluß hätte bringen können.
„Wurde viel geschwätzt damals“, murmelt Franz, „von Schmeißfliegen. Man kennt das ja!“
Schmeißfliegen, nun gut. Der Feldmarschall Fürst von Ligne hat zwar gesagt, daß der Kongreß nicht vom Fleck komme, er tanze.
„Er hat aber auch gesagt“, wirft Franz belustigt ein, „daß jetzt nur noch das feierliche Begräbnis eines Feldmarschalles fehle. Er werde dafür sorgen...“
Und ist selbst gestorben, ja. Der rosarote Prinz. Alles rosarot an ihm und um ihn herum, Kutschen, Livrees, Briefpapier, selbst sein Haus auf der Mölkerbastei samt den Stallungen, alles rosarot.
„Was hast du gegen rosarot?“, fragt der Franz mit einer Anzüglichkeit, die mich ganz zu ihm herumwirft.
Wie der Kongress dann aus war, ist ja auch die Frage deiner Erziehung geregelt worden. Genauso, wie es vor dem Zwischenspiel der Rückkehr deines Vaters beschlossen gewesen war: mein Vater wurde dein Erzieher. Und Ende Juni wurden wir einander vorgestellt. Ein etwas über vier Jahre alter Knabe, ein sogenanntes schönes Kind, das mit ‚Königliche Hoheit’ angesprochen werden mußte und vor dem wir alle die großen Complements machen mußten. Ich mit meinen vierzehn wohlerzogenen Jahren war eigentümlich berührt.
„Joseph Moritz?“, hast du mit heller Stimme wiederholt, als mein Vater dir meinen Namen mitteilte. Und noch einmal hast du’s gesagt: „Joseph Moritz?“ Und mir kam vor, als hättest du gesagt: „Joseph Molitz?“ Als hättest du den Namen komisch empfunden.
Und ich sagte einfach: „Ja.“
Mein Vater verbesserte: „Königliche Hoheit!“
Und ich setzte schnell nach: „Königliche Hoheit!“ Und bekam einen kleinen Stoß in den Rücken, weil ich mich retirieren sollte und mich dabei zu verbeugen hatte.
Du aber, Franz, drehtest dich zur Gräfin Montesquiou um und sagtest noch einmal: „Joseph Moritz“, so, als wolltest du, daß sie den Namen aufschreibt.
Ich halte inne, denn der Franz sinkt in die Erinnerung: „Maman Quiou, Toto, Chan-Chan, die lieben Frauen...“
Ja, mein Vater hat oft genug gejammert, daß er dich von lauter Weibern übernommen hat, die dich verzogen und vergöttert haben.
Joseph Moritz hält kurz inne, vielleicht erschrocken über das, was er dem Herzog da erzählt. Und wie er es erzählt.
Das, Franz, war die Zeit, wie ich sie verlebte, als ich das Glück noch nicht hatte, dich zu kennen. Ich war in der Zeit allein. Allein sein, heißt für mich heute, ohne dich sein. Bevor ich dich kannte, war ich zwar allein. Aber nicht ohne dich. Mag sein, daß ich die Zeit daher mit anderen Augen sehe. Mit Augen, die noch ganz mir gehört haben.
Joseph Moritz hat hier abgebrochen und am nächsten Tag weiter geschrieben.
Ich habe das gestrige überflogen und bin verwundert über den klaren, rücksichtsfreien Blick, den ich auf die Ereignisse habe. Es ist so sicher gut, daß Franz dies nie lesen wird. Es ist auch sicher gut, daß ich jetzt mit meiner Erzählung von früher fertig bin und den freien Blick verliere, der wahrscheinlich ein inniges Zusammentreffen mit dem Franz unmöglich machen würde. Fünfzehn Jahre sind seit damals vergangen, seit seinem von mir vermeintlich gehören ‚Joseph Molitz’.
Einen Tag habe ich Zeit, denn übermorgen soll er wieder kommen. Aber, stünde er jetzt plötzlich vor mir, ich würde von einer Sekunde auf die andere wieder in das Heute hineinfinden. In das Heute mit dem Franz.
Jetzt muß ich mich schnell zurückhalten. Eben war ich noch froh, einen Tag Zeit zu haben, um geordnet zurückzufinden, jetzt denke ich schon in Sekunden.
KAPITEL 5
Im Jahr 1817 begann Joseph Moritz sein ‚tagtägliches’ Tagebuch zu führen. Als er es begann, war noch keineswegs festgeschrieben, dass es ein Buch über ihn, und den Herzog von Reichstadt würde. Die Beweggründe, warum er überhaupt begonnen hat, ein Tagebuch zu schreiben, erfahren wir in seinen ersten Eintragungen. Ihnen werden wir uns noch widmen, führen uns doch diese ersten Notizen mit großer Eindringlichkeit in die Problematik ein, in der sich Joseph Moritz offenbar vom Anfang seiner denkenden Existenz an befunden haben dürfte. Am 20.3.1801 geboren war er genau 10 Jahre älter als sein späterer Schicksalsmensch, der Herzog von Reichstadt. Er begann sein Tagebuch im Alter von 16 Jahren zu führen. Nach damaligen Entwicklungsphasen war er eher noch ein Kind, bestenfalls ein Jüngling. Körperlich befand er sich sicher schon tief in der Pubertät, geistig aber war er, solang nicht Mann, eben Kind. Geistig hat er alles in der Einschätzung gesehen, die einem sechzehnjährigen damals zukam. Die Tagebuchnotizen allerdings sagen aus, dass Joseph Moritz ein zutiefst empfindsamer und empfindlicher Bursche war; beileibe kein Kind mehr, das er zu sein und als das er nach Lebensjahren zu gelten hatte. Dass aber Joseph Moritz die Jahre davor schon sehr wach miterlebt hat, das wissen wir aus seinen Ergänzungen, die er dem Herzog in seinem Tagebuch, das dieser nie lesen sollte, erzählt hat. Jene Ergänzungen, die die Jahre von 1811, dem Geburtsjahr des Herzogs bis zum Beginn der regelmäßigen Eintragungen, betroffen haben.
Im ersten Jahr der Tagebuchentstehung 1817 scheint Vater Dietrichstein seinen Sohn auch zum ersten Mal mit ins Theater genommen zu haben. Joseph Morìtz knüpft jedenfalls an ein Theaterereignis die Ursache der Einführung seines Tagebuches.
1. Februar 1817
Es ist dies übrigens eine der wenigen Daten, die Joseph Moritz in solcher Deutlichkeit vermerkt hat.
Gestern waren wir im Theater an der Wien. ‚Die Ahnfrau’ von einem Franz Grillparzer erlebte ihre allererste Aufführung. Der Dichter nahm den Dank des Publikums nach der Vorstellung des Stückes selber entgegen; seine Erscheinung brachte einen allgemein günstigen Eindruck hervor; Grillparzer ist nicht gerade hübsch zu nennen, aber eine schlanke Gestalt von mehr als Mittelgröße, schöne blaue Augen, die über die blassen Züge den Ausdruck von Geistestiefe und Güte verbreiten und eine Fülle von dunkelblonden Locken machen ihn zu einer Erscheinung, die man gewiss nicht leicht vergisst.
Nach dem Theater gab es im Garten der Karoline Pichler ein kleines Fest. Der Reichtum eines höchstgebildeten Geistes und eines edlen Gemüts zeigte sich deutlich in allem, was er tat und was er sprach. Mein Vater führte ein kurzes Gespräch mit dem Dichter, dessen Inhalt mich zutiefst beeindruckte, auch wenn ich jetzt nicht im Stande mich sehe, es wiederzugeben, war es doch zu schwer für mich, zu schwer.
Der Direktor Schreyvogel jedenfalls bedeutete meinem Vater mit großem Ernst und erhobenem, komisch nach hinten gebogenem Zeigefinger: „Selten einer, wo sich die Mühe dermaßen gelohnt hat. Und es war weiß Gott mühevoll, Entstehung und Aufführung des Stückes zu bewerkstelligen!“
Mein Vater sprach etwas vom „Adlerauge des Herrn Direktors, was Begabung betrifft“, was dem Direktor nur ein müdes Lächeln entlockte und den Seufzer: „Sag er das einmal unserer Theaterverwaltung!“
Es bestand also schon damals eine Diskrepanz zwischen den Verwaltern eines Theaters und denen, die das Theater tatsächlich zu machen hatten.
Viel bemerkenswerter in unserer Sache scheint es aber, dass der junge Joseph Moritz dem Stück selbst keine Zeile widmet, wohl aber dem Aussehen des Dichters, dessen äußere Erscheinung auf ihn deutlich mehr Eindruck gemacht hat, als ‚Die Ahnfrau’. Immerhin wird Grillparzer damit schlagartig berühmt. Schon ein Jahr später bringt er - diesmal am Burgtheater – ‚Sappho’ heraus, was ihm die Ernennung zum Hoftheaterdirektor auf fünf Jahre einbringt.
Joseph Moritz aber erklärt uns schon am nächsten Tag, wofür mit dieser ersten Notiz gleichsam der Grundstein gelegt war.
Ich habe das, was ich mir gestern auf mehreren Zetteln aufgeschrieben habe, heute in ein Heft übertragen. Ich wollte zuerst das eine oder das andere heute etwas anders exprimieren, habe aber dann doch alles so belassen, wie ich es gestern niedergeschrieben habe. Ich dachte für mich, daß es so, wie ich es gestern geschrieben habe und wie ich es heute lese, gestern eben so empfunden habe.
Überdies hat es mir eine Freude gemacht, heute zu lesen, was ich gestern gedacht und empfunden habe. Und wenn ich es heute da und dort vielleicht etwas anders empfinde, nun gut, dann hat sich eben von gestern auf heute was geändert. Und wer weiß, wie es morgen sein wird, wenn ich morgen das von vorgestern und das von heute, also von gestern lese?
Eine Zeitlang möchte ich das beobachten. Ist es doch das erste mal, daß ich eine Bewegung in mir und an mir sehe. Ein Weiterschreiten, ein Verändern. Das, wo ich hineinwachsen soll, ist ja schon vorgegeben, das haben andere schon bestimmt. Langeweile bedroht mich und meine Gedanken. Langeweile, die unsere Bestimmung zu sein scheint. Die wir jetzt sechzehn Jahre alt sind dürfen nur zuhören; kaum reden; nur wenn wir gefragt werden; und wenn wir gefragt werden, dann kommt es immer noch darauf an, was man gefragt wird; und wenn man Glück hat, dann kann man das, was man gefragt wird, auch beantworten; wenn man es aber nicht beantworten kann, dann wird einem mit einem milden Lächeln gedankt, das einem sagt: ‚Ich weiß, es ist zu früh, das Kind schon zu fragen!’ Und Scham und Zerknirschung macht sich in uns breit; Zerknirschung, die wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Zerknirschung ist überhaupt der beste Ausdruck, um ihn aufzusetzen, wenn man nicht gefragt werden will.