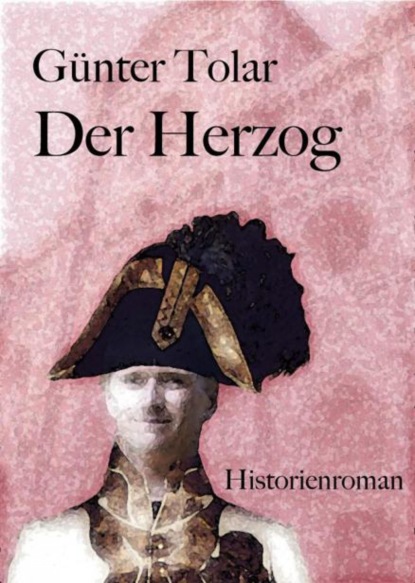- -
- 100%
- +
Joseph Moritz schreibt hier von ‚wir’. So klingt es wie eine verdrängte Jugend-Revolte, wie ein Konsens mit Freunden, zumindest aber mit Gleichgesinnten; von solchen ist aber keine Rede. Er spricht nur von sich weiter, verliert auch jetzt das ‚wir’.
Ich habe eine Pause gemacht im Schreiben. Mir geht der Gedanke aus. Mir reißt der Faden. Es drängt sich alles in die Feder. Es ist das Zwiegespräch, das ich nicht habe, das mich jetzt so zum Schreiben drängt.
Wieder muss eine Pause gewesen sein, der Schriftduktus sagt es deutlich aus. Aber immer ist es noch derselbe Tag.
Gewissenserforschung nennt es der Pfarrer. Genaues Nachdenken über sich selber. Ist es das, was ich hier tue? Habe ich den Weg zu meiner Wahrheit gefunden? Ist das alles wahr, was ich hier schreibe? Ist es nur jetzt wahr und morgen nicht mehr? Oder ist es immer wahr, wenn es einmal wahr war? Wer beantwortet mir die Fragen. Werden sie mir morgen beantwortet? Oder irgendwann einmal? Ich muß mir die Fragen merken, sonst kann ich einmal mit den Antworten nichts anfangen.
Also schreiben. Alles aufschreiben. Jetzt hab’ ich’s. Das ist mein neuer Weg. Mein eigener Weg. Da mag mir niemand dreinreden und mich in Zerknirschung treiben.
‚Alles aufschreiben’, das war die Devise der Joseph Moritz in den ersten Wochen nach der Geburt seines Tagebuches in peinlicher Genauigkeit folgte. Schon Mitte Februar, also etwa vierzehn Tage nach der Eröffnung seiner „Gewissenserforschung“ jubelt er:
Endlich, endlich nicht mehr allein. Endlich einen Partner. Einen geduldigen, der mich anhört, bis ich zuende bin. Der mich versteht. Der mich Fehler machen läßt, ohne sie gleich zu ahnden. Oh, es ist nicht stumm, mein Buch. Es spricht zu mir indem es nicht widerspricht.
‚Widerspruch’ ist ihm ein Problem, das ihn beschäftigt.
Alles an mir scheint Widerspruch hervorzurufen. Mein Vater findet alles an meiner Kleidung auszusetzen. Wenn ich es wage, dem Schneider ein paar Details anzugeben, die er an meiner Kleidung modischer machen könnte, dann fährt mein Vater dazwischen: „Soll man meinen Sohn an seinen Mäschelchen und Bändelchen erkennen?“
Und er befiehlt, alles wieder abmachen zu lassen. Mein Schneider findet es schade und sein allerliebster Sohn, der exakt in meinem Alter ist, auch. Mein Vater hat heute dem Schneider verboten, mir französische Journale zu zeigen: „Dieses weichliche Geschmeiß bringt den Joseph Moritz nur auf Bändelchen und Mäschelchen!“
Bändelchen und Mäschelchen, so spottet mein Vater meiner.
Joseph Moritz hat also eine Neigung zu der stark verzierten, etwas zur Zierlichkeit neigenden, französischen Mode. Die Informationen darüber lieferte der Sohn des Schneiders, den wir schon als ‚allerliebst’ kennen gelernt haben und der gleich alt wie Joseph Moritz ist. Bleiben wir darum noch ein wenig beim Thema Schneider und Mode; es finden sich noch einige Sequenzen in Joseph Moritz' plauderndem Buch.
Ein richtiger erster Aprillentag. Als ich eben beschlossen hatte, den Schneider aufzusuchen und mich für den Zu-Fuß-Weg entschieden hatte, da schien noch die Sonne. Als ich aber eben das Haus verlassen wollte, da regnete es schon wieder. Ich habe also anspannen lassen und wie wir auf die Herrengasse hinausfahren und eben in die Schauflergasse einbiegen, da sehe ich auf der anderen Straßenseite den Hans sich unterstellen.
Dieser Hans ist der ‚allerliebste’ Sohn des Schneiders.
Ich lasse also anhalten und winke ihm. Er eilt eilfertig herbei und erkennt mich erst in dem Augenblicke, in dem er gerade vor mir steht. Er reißt die Augen auf und höchste Verwirrung zeigt sich in seinem Gesichte, über das soeben die ersten, von seinem pitschnassen Hut überlaufenden Wassertropfen laufen, sodaß er einen Moment aussieht, als würde er weinen. Ich öffnete rasch den Schlag und sage: „Steig er schon ein, Hans. Oder will er ersaufen da draußen?“
Er springt herein und bleibt gebückt stehen. Ich muß ihm erlauben, sich zu setzen. Er setzt sich neben mich auf die Bank, aber ganz vorne: „Daß ich nicht alles naß mach’!“, sagt er leise.
Ich aber gebe ihm einen kräftigen Schubs, daß er nach hinten in die Polster kippt: „Ist noch nichts naß geworden, was nicht wieder trocken geworden wär’!“, lache ich. Er ist gegen mich geplumpst, lehnt jetzt an mir, starr und ängstlich und respektvoll.
„Der Herr Graf sind sehr gütig“, sagt er leise.
Ich aber bin höchst vergnügt: „Und was glaubt er, wo ich gerad’ hinfahr?“
Er sieht mich unwissend an, wobei er sich vorsichtig aufrichtet und sich von mir loslöst.
„Zu seinem Herrn Vater. Trifft sich das nicht gut?“
„Da wollt’ ich eben auch hin, ja“, sagte der Hans leise und nickend.
Sein Wams begann etwas zu dunsten, es riecht muffig. Es riecht nach feuchtem Stoff und feuchtem Körper. Schweiß, Achselschweiß, aufgewärmter, mischt sich auch dazu. Aufregend ist das so.
„Es gibt wieder neue Journale“, sagt er. „Wenn der Herr Graf wünschen...“
Selbstverständlich wünsche ich.
Er fährt fort: „Die Margarethe hat eines angezeichnet, das wär’ was für den Herrn Grafen, hat sie gesagt!“
„Die Margarethe?“, frage ich.
„Ach“, antwortet er, „ich dachte, der Herr Graf wüßten. Das ist mein Mädel. Die Tochter von der einen Weißnäherin.“ Er lacht: „Die andere, die wär’ wohl schon zu alt für eine so junge Tochter!“
Ab dem Moment finde ich sein Gered’ als Geplapper. Sechzehn Jahr’ alt und ein eigenes Mädel!
An diesem Tag hat Joseph Moritz nicht mehr weiter geschrieben. Zu tief scheint der Ärger gesessen zu sein, dass dieser junge, unstandesgemäße, ‚allerliebste’ Bursche, der sich erlaubte, mit ihm gleich alt zu sein, sich ein eigenes Mädel leistete. Der Hans hat ihn aber noch ein paar Tage später weiter beschäftigt. Ebenso die Margarethe, Tochter der einen, der jüngeren, Weißnäherin.
Ich weilte heute wieder beim Schneider. Der Hans zeigte mir einige wunderhübsche französische Modezeichnungen. Wunderhübsch. Eines davon wollte er mir unbedingt einreden. Es war genauso gestaltet, wie es mein Vater ‚Mäschchen und Rüschchen’ genannt hätte.
Um mich vollends zu überzeugen, rief er aus: „Die Margarethe hat auch gesagt: das wär’ was für den Herrn Grafen!“
Das war nun sicherlich nicht das Argument, mit dem Joseph Moritz unbedingt überzeugt werden wollte. Aus seiner niedergeschriebenen Antwort aber ist die plötzliche Kälte förmlich herauszuhören.
„Die Margarethe, so?“, antwortete ich.
Ich überlegte, was ich mit diesem Urteil wohl anfangen könne, da sprach er weiter: „Darf sie hereinkommen, dem Herren Grafen ihre Aufwartung machen?“
„Wer?“, fragte ich verwundert.
„Die Margarethe. Sie muß es dem Herren Grafen selber sagen.“
„Was denn?“
„Das mit diesem französischen Modell. Ich habe die Worte nicht. Darf sie, Herr Graf?“
Der Hans blickte mich so lieb an. Dabei sah ich zum ersten mal, daß er aus der Nähe besehen mit seinen wunderschönen, kugelrunden braunen Augen ganz leicht schielte; aber nur, wenn unsere Gesichter einander ganz nahe waren. Und das waren sie jetzt, wie wir über die Zeichnungen gebeugt waren. Er flehte mich an, als ob ich ihm was Liebes tun möchte. Ich tat es also.
„Soll sie kommen“, sagte ich jovial, „wenn ihr und ihm so viel daran liegt!“
Der Hans rief sie herein. Sie war so schnell da, als ob sie schon hinter der Türe gelauert hätte. Sicher hat sie hinter der Tür gelauert nach Weiberart. Sie blieb unter der Türe stehen, machte einen Knicks und blickte den Hans verlegen an.
„Nun komm sie schon her“, ermunterte ich sie.
Sie kam näher und stellte sich mit gesenkten Augen rechts neben den Tisch, auf den der Hans und ich über den Zeichnungen hingelümmelt lehnten.
Ich schob ihr die besagte Zeichnung hin und fragte sie: „Sie meint also, Mamsell Margarethe, daß mir das besonders gut stünde?“
Als ich ihren Namen nannte, errötete sie; ihr Gesicht hatte jetzt das Aussehen eines, nein gleich zweier rotbäckiger Äpfel. Wie sie überhaupt fast nur aus Kugeln zu bestehen schien. Ihre Schultern, rund, wie Teile von Kugeln; ihre Brüste, rund, Vollkugeln; ihre Hüften, rund, wie große Kugelhälften. Alles weitere verdeckte der weite Rock, ließ aber ebenfalls allerhand Kugeliges darunter vermuten. Ich trat einen Schritt zurück, um sie ganz zu sehen. Sie hatte sich mittlerweile über die Zeichnung gebeugt, sodaß der lange Rock hinten etwas hochkam; und ich hätte es mir doch denken können: unter dem Rock lugten Kugelwaden hervor.
Aber wir hatten ja die Zeichnung noch nicht begutachtet.
„Also?“, ermunterte ich die Margarethe.
„Ja“, begann sie zögernd, „Herr Graf“, wieder zögerte sie, „der Herr Graf hätt’ halt genau die Gestalt für sowas; die Grazie; den Adel; die Lustigkeit; die Gesichtsfarb’, alles, was man halt braucht, um sowas exzellent tragen zu können.“
Nett, wie sie das gesagt hatte.
„Findet sie, Mamsell?“, fragte ich, als ob ich es noch einmal hören wollte; oder als wollte ich noch mehr solcher Schmeicheleien hören. Oh, ich war eitel in dem Augenblicke, sehr eitel, Gott möge mir verzeihen.
Joseph Moritz benützte sein Tagebuch wirklich als Beichtstuhl. Und er genoss die Befreiungen, die ihm diese schriftliche Beichte schuf.
„Ja“, antwortete das Mädel einfach, anstatt fortzufahren, wie ich es so gerne gehört hätte.
„Jetzt müßt’ ich’s mir ja eigentlich machen lassen“, sagte ich, wobei ich ihr tief in die Augen blickte, „wenn eine so schöne Mamsell mich so überredet, da kann selbst unsereiner nicht widerstehen!“
‚Selbst unsereiner’ - man höre, wie der eitle Geck selbst dort, wo er sich kokett gibt, den Standesunterschied unfein herausarbeitet.
Die Margarethe füllte ihre soeben erst etwas erblaßten Wangen wieder mit Blut, sodaß wieder die zwei Äpfel dastanden. Sie sah mir erst ins Gesicht, erschrak, schlug die Augen nieder, schlug sie wieder auf, sah den Hans gleichsam hilfesuchend an, nickte plötzlich eifrig und sprach eilig: „Der Hans mahnt mich zurecht. Ich muß wieder an die Arbeit!“
Sie machte einen schnellen Knicks und rannte zur Türe hinaus. Ich mußte lachen und schlug den Hans auf die Schulter.
„Bei der brauchst du keine Angst zu haben, die ist dir sicher!“
Der Hans aber antwortete leise: „Ich bin trotzdem froh, daß der Herr Graf nicht weiter charmiert hat - man weiß nie bei einem so jungen Mädel...“
„So“, antwortete ich gedehnt, „er meint also, daß ich ihm bei der Margarethe könnt’ gefährlich werden?“
„Wenn der Herr Graf wollt’...“
„Wenn ich wollt’, ja. Aber sei er beruhigt, ich will ja gar nicht!“
Dann deutete ich auf die Zeichnung: „Und das da will ich auch nicht. In Wien braucht das Jahre, bis sich sowas durchsetzt. Und wenn man der erste ist, kommt man leicht in einen Ruf in unseren Kreisen. Aber das weiß er ja nicht. Braucht er auch nicht zu wissen.“
Wieder der Standesunterschied, auf den der Joseph Moritz deutlichen Wert legt. Es fällt allerdings auf, dass er die Betonung des Standesunterschiedes erst ab dem Zeitpunkt beginnt, als die Margarethe auftaucht. Solang er mit dem Hans allein verkehrt ist, war von diesem Unterschied keine Rede. Da waren sie einfach ‚Männer unter sich’.
Der „Störfaktor“ Margarethe wich aber bald neuen Komplikationen.
Eine Woche habe ich den Hans nicht gesehen gehabt. Heute aber war ich wieder dort, da hat er mich ganz schön erschreckt.
„Herr Graf“, begann er zögernd, „ich muß Ihm was sagen, was Ihm vielleicht einen Zorn auf mich macht.“
„Aber Hans“, lachte ich, weil ich ja noch nicht wußte, was da daher kommen sollte, „hat leicht die Margarethe wieder was ausgesucht für mich?“
Er aber blieb ernst: „Nein, Herr Graf. Es ist nur, vor zwei, drei Tagen waren zwei Herren bei meinem Herrn Vater. Ich wurde hinausgeschickt. Aber ich habe dennoch gehört, wie sie ihn gefragt haben, was für hohe Kundschaft bei uns verkehre. Und weil doch die einzige hohe Kundschaft, die unser Haus betritt, der Herr Graf sind, habe ich mir gedacht, ich muß es dem Herrn Grafen sagen.“
Ich mag wohl blaß geworden sein. Ich habe auch nicht gleich etwas gesagt.
Der Hans wurde sehr unruhig und ängstlich: „Ist das bös’, Herr Graf?“
„Der Sedlnitzky!“, mag ich wohl vor mich hingeflüstert haben.
Der Hans schlug die Hand vor seinen Mund. Und über der vorgehaltenen Hand schielte er mich leicht an mit seinen wunderschönen, kugelrunden Augen.
So habe ich also erfahren, so mußte ich es also erfahren, daß der Graf Sedlnitzky einen Verdacht geschöpft hat.
Der Graf Sedlnitzky - wir werden ihn noch näher beschreiben – ließ sehr schnell arbeiten.
Habe heute einen fürchterlichen Disput mit meinem Herrn Vater gehabt. Er kam wie immer an diesem Tag früher von Seiner Kaiserlichen Hoheit heim.
Es muss ein Montag gewesen sein, denn nur am Montag kam Vater Dietrichstein früher aus seinem Dienst. Und diesen Dienst versah er bei Seiner Kaiserlichen Hoheit, die der Herzog von Reichstadt damals ja noch war, als legitimer Thronfolger Napoleons mit dem Namen Napoleon II.
„Mein Herr Sohn lassen also den Schneider nicht kommen, sondern bemühen sich selber zum Schneider.“
Das schrie mein Herr Vater ganz ohne vorherige Ankündigung.
„Welch eine Herablassung: Kann er mir die vielleicht erklären?“
Ich war so sprachlos, daß ich sicherlich nicht fähig war, sogleich zu antworten. Das war aber auch gar nicht notwendig, denn mein Herr Vater schrie sogleich weiter: „Oder muß ich das wieder von der geheimen Polizei erfahren? Vielleicht erkundig’ ich mich überhaupt gleich beim Sedlnitzky, was in meiner Familie so alles vorgeht, ha?“
Erst jetzt verstummte mein Herr Vater. Er setzte sich brüsk in seinen Lehnstuhl und sah mich so herausfordernd an, daß ich wußte, jetzt war es an der Zeit, mir eine gute Antwort auszudenken.
Aber immer ging’s mir im Kopf herum, der Sedlnitzky. Wie vor einer Woche beim Schneider-Hans: der Sedlnitzky kümmert sich um uns, um mich; um den Sohn des Erziehers Napoleon des II. Na freilich, wir waren hochnotpeinliche Personen.
Joseph Graf Sedlnitzky war zu Anfang des Jahres ‚Präsident der Obersten Polizei- und Zensurbehörde’ geworden. Er hat, wohl ganz im Sinne Metternichs, den ‚Polizeistaat’ zu höchster Perfektion geführt. Das Spitzelsystem war nahezu lückenlos. Die Wiener nannten das Heer der ‚nebenberuflichen’ Spitzel ‚Naderer’. Damals wie auch später war es eine der Charaktereigenschaften des Wieners, über den anderen etwas zu wissen und aus diesem Wissen Kapital zu schlagen zu versuchen. Dieses Kapital war bis dato lediglich in Triumphe, Schadenfreude und heimliches Händereiben umsetzbar. Seit Sedlnitzky aber wurde bar bezahlt. Zudem schaffte der geheime Graf es auch, alle Druck-Erzeugnisse und Briefe fast lückenlos von seiner Zensur erfassen zu lassen.
Es war also nur zu klar, dass der Erzieher von Napoleons Sohn und dessen Familie strengstens observiert wurden. Völlig folgerichtig hatte der Joseph Moritz jetzt also Angst, Vater Dietrichstein war verärgert und im Hause Dietrichstein somit Krach angesagt.
„Darf ich also von ihm erfahren, was ihn dazu treibt, den Schneider aufzusuchen wie eine hergelaufene Straßenkundschaft?“
Mein Vater hat mit mir geschrien, seine an sich starke und eher sonore Stimme drohte fast überzuschnappen.
Ich kam aber gar nicht zum Antworten, da schrie er schon weiter: „Ich darf doch annehmen, daß mein Herr Sohn weiß, daß sein Vater eine Vertrauensstellung hat und somit ein Vertrauen genießt, das ihm sowohl Seine Kaiserliche Majestät als auch seine Durchlaucht der Staatskanzler entgegenbringen. Oder vielmehr entgegengebracht haben. Denn jetzt gilt es ja zu klären, was mein Herr Sohn beim Schneider zu suchen hat, anstatt ihn, wie es immer war, kommen zu lassen.“
Ich schickte mich jetzt zu gar keiner Antwort an; mich beschlich nämlich der Verdacht, daß mein Herr Vater nur erpicht darauf war, mir einen Vortrag zu halten. Vielleicht hatte er sogar Angst; und versuchte sich dieser Angst nun klar zu werden, indem er sie, wenn auch schreiend, so doch, formulierte.
„Ist ihm das klar?“, schrie mich der Vater plötzlich an.
„Ja“, antwortete ich schnell. „ich darf anfügen, daß es mir auch nie unklar gewesen ist.“
Plötzlich war er beruhigt: „Dann ist es ja gut. Darum möchte ich aber auch in aller Zukunft gebeten haben.“
Er wollte den Salon, in dem sich die Szene abgespielt hatte, eben verlassen, da drehte er sich unter der Türe noch einmal um und warnte mich mit wackelndem Zeigefinger: „Übrigens, der Rüschchen- und Bändchenschnickschnack hört jetzt auf. Das einzig Französische in unserer Familie ist Seine Kaiserliche Hoheit. Der macht mir wenigstens Freude.“
Den speziellen Anlass zur Freude hat uns Graf Dietrichstein nicht hinterlassen. ‚Kaiserliche Hoheit’ war gerade sechs Jahre alt, die Beziehung, der Joseph Moritz’ Tagebuch später fast ausschließlich gewidmet ist, hat noch nicht begonnen, wenn sich auch Voraus - Spuren jetzt schon finden. Es ist allerdings hinterher immer verführerisch, in Kenntnis des Endes rückschauend so manches zur Spur zu erklären, was möglicherweise noch gar keine war. Jedenfalls sind die paar Notizen im Tagebuch, die zum Thema ‚Napoleons Sohn’ aufzufinden waren noch in keiner Weise Hinweise, wenn man sie auch später doch als solche identifizieren könnte. Aber hier offenbart sich die Zweifelhaftigkeit historisch hergestellter Zusammenhänge, die ja immer rückschauend und somit viel gescheiter sind, als es die, die es erlebt haben, jemals sein hatten können. Rückschauend weiß man dann immer das, was man, zur besseren Bewältigung der Situation, besser vorher gewusst hätte. Aber in der Kluft zwischen Hinterher-Besser-Wissen und Vorher-Nicht-Gewußt-Haben, aber vielleicht Vorher-Wissen-Hätte-Sollen liegt wohl das, was man Geschichtsschreibung nennt.
Aber zitieren wir doch die vermeintlichen Spuren. Da findet sich inmitten einer belanglosen Alltagsschilderung über ein Missgeschick, das eine Köchin des Hauses mit einem Kuchen gehabt hatte, ein den Tag abschließender Hinweis.
Vater lobte den Mehlspeisenkoch seines Zöglings über die Maßen, was Mama in gelinde Scham trieb, da sie wahrscheinlich annahm, daß Vater das nur deshalb tat, um die blamable Sache mit der Mehlspeis’ in unserer Küche, vielmehr in der von meiner Mutter geleiteten Küche, nur ja nicht gleich wieder auf sich beruhen zu lassen.
„Aber wir werden ja selbst Gelegenheit haben, das bald zu kosten“, kündigte er an.
„Warum denn?“ und „Wann denn?“, waren die Fragen, die wir ihm jetzt stellten.
„Heute in einer Woche, ja, genau heute in einer Woche.“
Dieser exakte Hinweis des Vaters erlaubt uns, das Datum der Notiz ganz genau festzulegen, es ist der 13. März 1817.
„Heute in einer Woche hat seine Kaiserliche Hoheit seinen sechsten Geburtstag. Und ich habe die Ehre, meine Familie mitbringen zu dürfen.“
„Zur Feier?“, fragten alle ungläubig; wir wußten doch, daß diese Feier auf allerhöchster Ebene stattzufinden hatte, zumal ja eben doch eine Kaiserliche Hoheit Geburtstag feierte; das war eine Feier wie bei einem Erzherzog; und da waren wir auch nie geladen.
„Nein, nein“, lächelte Vater milde, „zur Feier erscheinen nur wir.“
„Wir?“, riefen alle wieder entzückt.
Vater setzt eine tadelnde Miene auf: „Ihr spielt eine schlechte Posse mit mir! Wir, das sind wir, seine Erzieher.“
„Aha“, ging es in der Runde.
Irgendjemand aber erlaubte sich doch zu fragen, ich glaube, es war Mutter: „Und wir?“
Leises Gekicher war die Folge, das jedoch von Vater mit einem Rundumblick beruhigt wurde.
„Zum Kaffee, am Nachmittag“, erlöste er endlich gnädig die Fragerunde.
„Der Kleine trinkt Kaffee?“, fragte Mutter erstaunt.
Wieder der tadelnde Erzieherblick des Vaters: „Seine Kaiserliche Hoheit lädt zum Kaffee. Die Familien seiner Erzieher. Er selbst wird vermutlich keinen Kaffee trinken.“
Vater dachte angestrengt nach und stellte dann nachdrücklich nickend fest: „Also das wäre mir doch aufgefallen. Nein, nein!“
Damit schien er beruhigt.
Mutter scheint sich auf den Tag zu freuen.
Ich fühle mich in Gegenwart seiner Kaiserlichen Hoheit nicht wohl. Zumal ich es einfach zu drollig finde, daß wir Großen vor diesem Buben die großen Complements machen müssen und er das auch noch huldvoll entgegennimmt. Der Kleine weiß genau, was ihm zusteht, das macht ihn unsympathisch und uns klein. Immerhin gut, daß niemand sieht, wenn wir Standspersonen, die wir von anderen selber Respekt einfordern, plötzlich Kotaus vor einem Kind machen müssen.
Wieder einmal der Hinweis auf den Stand, in dem sich Joseph Moritz sehr stark fühlt. Und wieder das Angerührt-Sein, wenn er gezwungen ist, sich vor anderen, in diesem Fall Höheren, zu beugen.
In dieser Woche vor dem Geburtstagsfest, widmet er ein paar Zeilen der Kaiserlichen Hoheit.
Was ich wohl mit ihm sprechen werd’? Oder, was wird er mit mir sprechen? Ob er wohl weiß, daß seine Mutter in Parma mit einem Bastard trächtig ist? Ob ich ihm das wohl erzählen werd’?
Aber nein, Vater hat nur Themen erlaubt, die Seine Kaiserliche Hoheit selbst, oder er, mein Vater, anschneidet. Sonst wird nichts geredet? Das kann ja heiter werden.
Aber schön wär’s, wenn ich...
Gute Nacht, träum’ süß, Joseph Moritz!
Boshaftigkeit und hin und wieder gute Laune, das lernen wir hier an Joseph Moritz kennenz. Abgesehen davon spricht er hier ein höchst heikles Thema an. Marie Louise, Herzogin von Parma, war zu dem Zeitpunkt schon im 7. Monat schwanger. Am 11. Mai des Jahres 1817 wurde ihr ein Mädchen geboren, das ihr der Graf Neipperg in den Leib gesetzt hatte. Napoleon lebte noch, so konnte Marie Louise ihren Begatter nicht heiraten. Das Mädchen musste getarnt werden als Albertine Montenuovo.
Es ist an sich schwer zu erklären, wieso Joseph Moritz das überhaupt gewusst hat: Er gibt keine Quelle an, schreibt nicht, wo er doch sonst so geschwätzig ist, wer ihm das erzählt hat, aber er weiß es. Es ist auch nicht herauszufinden, wer es noch aller gewusst haben mag. Sicher der Kaiser, sicher Metternich, sicher - denn von denen wusste es ja Metternich - Sedlnitzkys Geheimpolizei; die hatten bestimmt jedes Detail von der Zeugung bis zur Geburt archiviert.
Klar war aber, dass darüber vor der Kaiserlichen Hoheit nicht gesprochen werden durfte. Der Sohn hat die Details über seine Mutter überhaupt erst im März 1829, also zwölf Jahre später, erfahren. Da gab es aber auch schon mehr zu erfahren, denn da waren dann schon mehrere Kinder da. Da hatte Marie Louise auch ihren Neipperg schon geheiratet und da war Neipperg auch schon gestorben.
Später, viel später, wurde Metternich vorgeworfen, er hätte die Mutter des Herzogs von Reichstadt, zur Zeit noch Kaiserliche Hoheit, in die Hände des Grafen Neipperg getrieben. Die Wahrheit aber verhält sich ganz anders. Sicherlich, Marie Louise sollte ein ‚Ehrengeleit’ bekommen, um ihren gefangenen Mann zu vergessen. Juni/Juli 1814 stand die Ernennung dieses Ehrengeleits an. Juni/Juli 1814 bekam Marie Louise beim ‚Frieden von Paris’ den folgenden Passus verpasst:
‚Die Herzogtümer Parma, Piacenza und Guastalla werden der Souveränität Ihrer Kaiserlichen Majestät Marie Louise unterstellt und ihr als Besitz übergeben. Sie gehen auf ihren Sohn und dessen Nachfolger in direkter Linie über. Der Prinz, ihr Sohn, wird ab jetzt den Titel Prinz von Parma, Piacenza und Guastalla führen.’
Vorher aber waren da viele Reisen über Rambouillet, Schweiz, Schönbrunn, Aix le Bains - und dort lernte sie Neipperg kennen.
Metternich hatte den Hauptmann Graf Karaczai als ‚Ehrengeleit’ für Ihre Hoheit, die Herzogin von Parma, vorgeschlagen. Der Kaiser selbst aber ernannte Neipperg. Und vorgeschlagen wurde Neipperg vom Botschafter Schwarzenberg. Das alles konnte nur deshalb ohne Wissen Metternichs passieren, weil er in London weilte. Noch aber war nichts Bedenkliches an der Ernennung Neippergs; der Kaiser soll zunächst erklärt haben: „Gott sei Dank! Ich habe Glück gehabt in der Wahl dieses caballero!“
Wer hätte denn auch vorhersehen können, daß sich die Exkaiserin mit diesem einäugigen Offizier einlassen werde; schließlich war er sechzehn Jahre älter als sie, verheiratet und Familienvater. Neipperg war Feldmarschallleutnant und hatte sich in kriegerischer als auch in diplomatischer Hinsicht durchaus verdienstvoll hervorgetan. So war es fast ein Ehrendienst, als er eingeteilt wurde, der Herzogin von Parma nicht nur Ehrengeleit zu geben, sondern auch ihre Interessen zu vertreten, was im Wiener Kongress Marie Louise durchaus zum Nutzen gereichte. Im Juli 1814 stellte er sich erstmals der Herzogin von Parma vor, in Aix le Bains. Sie schrieb damals noch an Napoleon: ‚Glaube, mein teurer Freund, an meine zärtliche Liebe! Niemand liebt dich so und wird dich je mehr lieben als ich. Ich küsse dich und liebe dich von ganzem Herzen.’