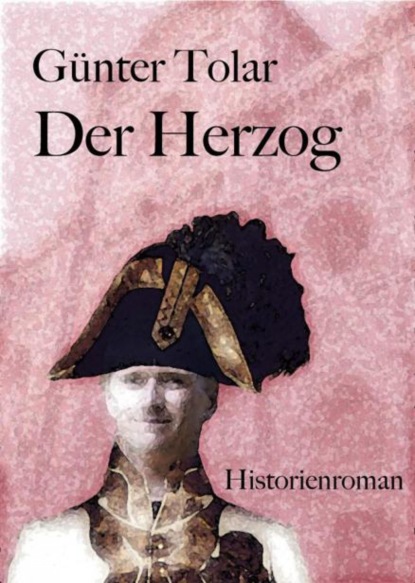- -
- 100%
- +
Aber bald hatte sich Ihre Majestät die Erzherzogin, Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla mit ihrem Ehrenkavalier eingelassen. Ihr Schutzengel hatte schon vier Söhne, seine Frau besaß zudem die Höflichkeit, am 23. April 1815 zu verscheiden. Am 27. September 1814, auf der Rückreise von Aix le Bains nach Wien gab Marie Louise sich ihm hin, und zwar im Hotel ‚Zur Goldenen Sonne’ in der Nähe der Tellskapelle am engelsreinen Ufer des Vierwaldstättersees. Das alles wusste bis ins kleinste Detail die Wiener Geheimpolizei. Dort ist zu diesem Fall vermerkt:
‚Wien, 24. Oktober 1814. ...Man kann jetzt feststellen, daß sie (Marie Louise) sich in vollkommener Übereinstimmung und großer Intimität mit Neipperg befindet, der sehr geschickt ausgesucht worden ist...’
Und ‚Wien, 3. Januar 1815. In der Kurierpost von Elba, die über Livorno nach Parma an Marie Louise gelangt ist, macht Napoleon ihr lebhafte Vorwürfe wegen ihrer Unbeständigkeit und ihrer Haltung ihm gegenüber. Er war sehr eifersüchtig auf Neipperg.’
Allerdings, man muss Marie Louise auch ein paar Entschuldigungen zukommen lassen. Eine davon war wohl auch in einem Geheimbericht enthalten und besagte, dass ihr Gatte auf Elba von Frauen umgeben sei. Zeugen hierfür seien der Palastvorsteher Bausset und die Palastdame de Brignole.
Gründlich war sie schon, die Geheimpolizei.
Über genau diesen Themenkreis hatte Joseph Moritz bei seiner Königlichen Hoheit sechstem Geburtstag sprechen wollen? Es war wohl sicher nicht ernst gemeint. Es war das, was wir schon festgestellt haben, eine der seltenen Gelegenheiten, festzustellen, dass Joseph Moritz von Zeit zu Zeit auch guter Laune, ja fast ausgelassener Stimmung gewesen sein mag. Im Tagebuch dokumentiert er sich sonst ja eher elegisch, tragisch, schwermütig, wehleidig, selbstgefällig, selbstmitleidig und nicht recht über den Dingen stehend, mit denen ein junger Mann seiner Zeit halt in Berührung zu kommen hat.
Aber dann war er da, der Tag. Vielmehr er war da gewesen, da wir ja von Joseph Moritz nur erfahren, was gewesen ist.
Aber nun haben wir ja den Geburtstag erreicht, den 20. März 1817.
Sein Mittagmahl hatte mein Vater wie immer in der Küche seiner Kaiserlichen Hoheit eingenommen. Nicht in der Küche, sondern aus der Küche Seiner Kaiserlichen Hoheit. Dann aber war er außerhalb des Stundenplanes ins Palais gekommen und hat im ganzen Haus laut herumschreiend angekündigt, daß wir um halb zwei abfahren würden, weil uns Seine Kaiserliche Hoheit um Punkt zwei Uhr erwarte.
„Kennt er denn schon die Uhr?“, fragte meine Mutter verwundert.
Mein Vater war an Sarkasmus nicht mehr zu überbieten: „Nein, aber er kann bis zwei zählen!“
Aber Mutter ließ nicht locker: „Bis zwei?“
„Vier Schläge zur vollen Stunde...“, hier stockte Vater plötzlich, blickte Mutter böse an, die irgendwelche Bildchen auf dem Kaminsims herumschob; dann aber vollendete er großzügig: „Also gut, bis vier!“
Gleich aber schimpfte er wieder: „Keine Mißverständnisse! Der Kaffee ist um ZWEI!“
Mutter schüttelte den Kopf: „Ich bin ja neugierig!“
Vater stellte fest: „Ich auch!“, um anschließend gleich zu fragen: „Aber warum Sie, Frau Mutter?“
„Ob er wirklich Kaffee trinkt, der Kleine!“
„Der Kleine reicht der Frau Mutter immerhin fast bis zu den Schultern!“
Diese Bemerkung hatte mich neugierig gemacht. So ein großer Bube also?
Nun gut, wir fuhren hin. Fünf Minuten vor zwei standen wir im Vorzimmer. Dann schlug, wie es mein Vater angekündigt hatte, eine Uhr am Kaminsims vier Mal zur vollen Stunde, dann zweimal. Sogleich nach dem zweiten Schlag öffnete sich die Türe zu den Gemächern Seiner Kaiserlichen Hoheit. Er kam so prompt heraus, daß ich fast annehmen mußte, er ist hinter der Türe gestanden. Mutter blickte Vater kurz an, wie um ihm mitzuteilen: ‚Siehst du, er kennt wirklich die Uhr!’ Vater aber sah entzückt dem formvollendeten Auftritt seines kindischen Zöglings zu. Wahrscheinlich hatten sie das für solche Gelegenheiten eingeübt und Vater prüfte jetzt den Buben. Der Bub benahm sich auch, wie bei einer Prüfung.
Er ging schnurstracks auf meinen Vater zu, reichte ihm die Hand, verbeugte sich leicht, während mein Vater ein großes Complement machte, und sagte: „Mein verehrter Lehrer, willkommen an diesem Tag.“
Dann wandte er sich Mutter zu, die ihrerseits den tiefen Knicks machte, und sagte: „Es muß doch ein schöner Tag sein, wenn mein Lehrer seine angetraute Gemahlin uns einmal nicht vorenthält!“
‚Uns einmal nicht vorenthält’, Gott, wie geschraubt, dachte ich für mich. Da war er aber auch schon bei mir. Ich machte mein großes Complement, während er sagte: „Welch ein trefflicher Sohn muß das sein bei einem so trefflichen Vater.“
Jetzt wandte er sich meinem entzückt zuhörenden Vater zu: „Verzeih er mir, Graf, wenn heute einmal Wir die Noten ausgeben.“
Mein Vater nickte mit ziemlich blödem Blick und verbeugte sich errötend, während sich der Bub wieder zu mir wandte: „Ist er zu ihm auch so streng? Wir müssen reden, er muß mir ein paar Gedanken geben, wie ich der Strenge des Herrn Grafen ein wenig zu entrinnen vermag!“
Damit wandte er sich von mir ab und begrüßte nun ebenso wortereich die anderen - die Collins und die Forestis und so weiter. Ich mag sie nicht alle aufzählen.
Immer wenn Seine Kaiserliche Hoheit bei jemandem vorbei war, bekam der ein winziges Schälchen Kaffee gereicht. Mutter vermißte sogleich den Kuchen, worauf ihr Vater zuknurrte, daß sie sich zuhause sattessen könne. Das hier sei ein hehrer Anlaß und keine Freßveranstaltung.
Da bemerkte der Vater, daß Seine Kaiserliche Hoheit ihn benötigte und rannte stracks hin. Ich stand in einer Ecke. Seine Kaiserliche Hoheit – der lange Titel macht mich beim Schreiben direkt nerviös - konnte ich nicht sehen, er war inmitten vieler Leute. Mein Vater aber war wie die Boje in dem Gewoge; ich nahm an, daß dort, wo ich meines Vaters ansichtig wurde, SKH nicht weit sein konnte.
Ich hatte meinen Kaffee recht schnell ausgetrunken und stand mit der leeren Tasse da. Einer der jungen Kannenhalter sah das, zwinkerte mir zu und deutete mit den Augen auf seine Kanne, dann blickte er deutlich auf meine Tasse. Ich nickte. Jetzt wurde er verlegen; offensichtlich durfte er ohne ausdrücklichen Befehl seinen Platz nicht verlassen: Er drückte also totale Hilflosigkeit in seinem hübschen Gesichte aus, was zur Folge hatte, daß ich zu ihm hinging, er mir einschenkte, sofort wieder die vorige Haltung annahm und so tat, als wäre nichts gewesen: Ich hauchte ein leises „Danke“, er aber schüttelte ängstlich fast unmerklich den Kopf, als wollte er mir sagen, daß ich sofort wieder vergessen möge, was soeben geschehen war.
Plötzlich stand meine Frau Mutter neben mir und sagte zu jemandem: „Da, er hat noch den ganzen Kaffee in der Tasse. Immer läßt er ihn kalt werden!“
„Er dampft aber noch“, sagte da eine jugendliche Stimme, die mich herumriß.
Es war SKH. Er lächelte: „Hat er sich nachschenken lassen?“
Ich blickte erschrocken den jungen Kannenträger an, der seinerseits blickte starr vor sich hin.
„Ach, vom Jakob“, sagte da der Bub. „Der Jakob ist mein Bester und mein Liebster. Von ihm krieg' ich immer noch was, wenn’s schon nicht mehr erlaubt ist...“, da hielt er erschrocken inne, blickte meine Mutter an und flehte: „Das darf die Frau Mutter jetzt aber nicht ihrem Herrn Gemahl erzählen, denn das ist gegen seine Ordnung!“
Mutter beteuerte: „Aber wie wird’ ich denn! Außerdem, ich kenne meinen Mann.“
„Eben“, nickte SKH, „der bekommt alles aus einem heraus. Ach was! Ich BEFEHLE ihr, über das soeben Gehörte zu schweigen.“
Dann zeigte er spaßhaft auf mich: „Und er haftet mir dafür, daß die Geschichte verschwiegen bleibt, gell?“
Damit mischte er sich, uns in tiefer Verbeugung hinterlassend, wieder in die Menge, dort nun wieder bei den anderen Verbeugungen erzeugend. Das ist es, was ich von dem Geburtstagsfest zu berichten weiß.
Mir fallen die Augen zu. Aber ich habe es ausführlich beschreiben wollen. Beim Gehen habe ich noch den Blick Jakobs gesucht, er aber hat weggeschaut. So weggeschaut, daß ich genau weiß, daß er genau weiß, daß ich hingeschaut habe.
Das war also der erste längere Bericht, den wir von Joseph Moritz, den Herzog von Reichstadt betreffend, haben. Findet der Leser die angekündigten Spuren? Sicher, Seine Kaiserliche Hoheit hat mit dem Joseph Moritz länger gesprochen als mit anderen; er hat mit ihm gescherzt, er hat eine Art Vertraulichkeit mit ihm aufkommen lassen; er hat bemerkt, dass Joseph Moritz sich von ‚seinem liebsten’ Diener hat nachschenken lassen. Andrerseits aber scheint eben jener Jakob auf Joseph Moritz mehr Eindruck gemacht zu haben, als Seine Majestät, Napoleon II.
Den Bericht hat uns Joseph Moritz noch am selben Abend gegeben.
Schon die nächste Eintragung, sie wird wohl an einem der zwei folgenden Tage geschrieben worden sein - wie so oft, undatiert - schildert uns aber doch einige Gedanken zur Person des Buben.
Habe soeben das Vorige noch einmal gelesen. Also das mit dem Jakob ist wohl wieder so eine Blödheit von mir. So geht’s mir halt oft, daß ich mich schnell in wen verschau’. Der Jakob, ein hübsch’ Gesicht, ein schneller Eindruck, und schon wieder vergessen.
Aus den späteren Eintragungen allerdings geht hervor, dass just dieser Jakob der Mitwisser gewesen sein muss, der das heimliche Ein und Aus des Joseph Moritz beim Herzog zu bewerkstelligen geholfen hat. Es ist jenes Kürzel ***, das Joseph Moritz später geheimnistuend verwendet und das anders nicht zu deuten ist, als mit dem besagten Jakob.
Für jetzt aber hat Joseph Moritz vor, diesen Jakob zu vergessen. Er hat sich wieder in ‚wen verschaut’, schreibt er. Trotz der späteren Fixierung auf den Herzog ‚verschaut' sich Joseph Moritz immer wieder. Man denke nur daran, dass wir jetzt schon zwei kennen gelernt haben, den Schneider Hans und jetzt den Jakob. Und wir werden noch andere kennen lernen.
Nicht so schnell vergessen werd’ ich aber doch den Buben, diese unbegreifliche Majestät. Sechs Jahre alt und macht unsereinem eine Konversation vor, die von einer Gewandtheit zeugt, daß man vor Neid erblassen möcht’. Ist es wirklich die Majestät in so einem Buben? Aber das kann sich doch nicht in einer Generation aufbauen. Schließlich ist der Vater doch irgendwo am Misthaufen aufgewachsen; jedenfalls ist bei ihm von Adel weit und breit nichts. Gut, die Mutter des Buben ist eine Habsburgerin, der Großvater unser Kaiser. Aber was ist es wirklich, was ihn so gewandt macht? Das Habsburgische oder das Napoleonische? Da es unheimlich ist, wird es wohl das Napoleonische sein, das aus dem Buben spricht. Wie er meiner Mutter befohlen hat, und mich für die Einhaltung des Befehles haften läßt, das war, wenn auch im Scherz, von einem gekommen, der Befehle zu geben weiß und diese auch zu formulieren im Stande ist. Der Bub macht mich glatt klein. Da spielen die zehn Jahre, die ich älter bin, keine Rolle. Überhaupt keine Rolle.
Wie kommt das? Denn nicht der Stand ist es, nein, die Person, die dahinter steht. Die drinnen steht. Der Bub muß sich auf keinen Stand berufen, der ist es. Der ist es einfach. Der Bub.
Entweder ist mein Vater ein hervorragender Lehrer oder ein schlechter Vater.
Wieder ist es der Stand, der dem Joseph Moritz zu schaffen macht. Dieses Problem kennen wir schon an ihm. Bemerkenswert ist hier jedoch, dass er Probleme damit hat, einen Stand über sich, der nicht Metternich heißt und der nicht der Kaiser selbst ist, annehmen zu müssen; aber nicht, weil der höhere Stand des anderen ihm das gebietet. Das auch. Sicherlich musste er Napoleon II. auch von Standes wegen akzeptieren. Was ihn aber störte war, dass er ihn annehmen musste, weil die Person, weil der ‚Bub’ ihn dazu gezwungen hat. Das war nicht Stand als verbrieftes und vererbtes Privileg, auf das man sich notfalls berufen kann, sondern Stand als Eigenschaft, als Teil der Persönlichkeit, als Basis der Persönlichkeit an sich. Und das bei einem Buben, der zehn Jahre jünger war als Joseph Moritz.
Findet der Leser hier Spuren? Sicher, Joseph Moritz hat sich mit Seiner Kaiserlichen Hoheit länger beschäftigt als bisher mit einem anderen Menschen.
Joseph Moritz ist ein höchst sensibler junger Mann. Und Seine Kaiserliche Hoheit ist sechs Jahre alt. Spuren mögen hier vielleicht beginnen, weil Napoleon II., der junge Adler, wie er auch genannt wurde, in Joseph Moritz Eindrücke hinterlassen hat, die ihm immer wieder ins Gedächtnis kommen werden, wenn vom ‚jungen Adler’ die Rede sein wird. Joseph Moritz wird in Zukunft etwas empfinden, wenn die Rede auf Napoleons Sohn kommt. Vielleicht beginnen hier wirklich die Spuren?
In der Folge, zumindest in diesem Jahr, begegnen wir allerdings Napoleon II. kaum mehr. Joseph Moritz scheint ein ruhiges Leben zu führen, keine wesentlichen Probleme werden da geschildert. So widmet er sich mit Hingabe dem ihn umgebenden Alltag.
Gestern war ich auf der neu eröffneten Bastei.
Mitte des Jahres waren die Basteien mit Bäumen bepflanzt und zur Promenade freigegeben worden.
„Jetzt ist Wien endgültig keine Festung mehr“, sagte mein Vater. Er ist übrigens sehr ungehalten darüber, daß man zu den Eröffnungsfeierlichkeiten seinen Zögling auch in der Öffentlichkeit gezeigt hat.
„Warum denn eigentlich?“, fragte ich.
Vater antwortete mir, als ob er mit einem Blöden redete: „Weil sein Vater im Jahr 1809 mit dem Umbau begonnen hat.“
„Umbau?“, fragte da Mutter erstaunt, „sprengen hat er die Befestigungsanlagen lassen...“
„Und damit den Grundstein für den endgültigen Abbruch gelegt“, fiel ihr Vater barsch ins Wort.
Vater läßt noch immer über Napoleon nichts kommen. Nicht, weil er ihn so sehr verehrt, sondern weil er der Vater seines Zöglings ist. Dennoch aber schimpfte er: „Geschmacklos, den Buben, nur weil sein Vater die Hand im Spiele hat, immer hervorzuzerren!“
Kein Wort des Kommentars von Joseph Moritz. Die von seinem Vater kritisierte Geschmacklosigkeit vollzieht er nicht nach.
Noch einmal begegnet uns in diesem Jahr der junge Napoleon. Joseph Moritz machte sich seine Notizen zu den Ereignissen des 18. Oktober.
Heute ist der Jahrestag der Schlacht von Leipzig.
Am 18. Oktober 1813 wurde Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig besiegt. An der Schlacht waren auch die Österreicher unter dem Feldmarschall Schwarzenberg beteiligt.
Im großen Saal des Invalidenhauses haben sie zwei mordsmäßige Gemälde von Johann Peter Krafft ausgestellt. Die Bilder zeigen recht deutlich Szenen aus den Schlachten bei Leipzig und Aspern.
Der Kaiser hat vorbeigeschaut Schlag neun am Vormittag. Vater hat dort sein müssen, hat mich darum mitgenommen.
Vater hat dort sein müssen, weil sie dem Napoleon II. auch die Bilder gezeigt haben. Er hat wieder fürchterlich geknurrt, mein Vater, warum sie dem Buben das immer antun. Sein Vater lebt schließlich noch in St. Helena und sie zeigen grausliche Bilder, wo der Vater so recht als Metzger dargestellt ist. Und das zeigen sie dem Buben.
Ich habe weniger die Bilder angeschaut, als das Gesicht des Buben, wie er sich die Bilder angeschaut hat. Ich hab’ leider nicht können hören, was sie ihm erklärt haben, sie haben es ihm ganz nahe am Ohr erklärt. Ich habe nur gesehen, daß der Bub recht blaß war und mit großen Augen immer gerade dorthin geschaut hat, wo sein Vater abgebildet war. Das hab’ ich sehen können, wenn ich im Geiste einen Strich von seinem Blick auf die Bilder gezogen habe.
Da hat mein Vater schon recht, er ist arm, der Bub. Mitten in den Erzherzögen drinnen, die sich furchtbar aufgeputzt hervortun wollten. Der Kaiser hat dann den Buben an der Hand genommen, ihm auch was gesagt, der Bub hat genickt, zum Kaiser aufgeschaut, als wollte er danke sagen; vielleicht hat er ihm auch gedankt. Sie sind nämlich gleich darauf gegangen.
Wär’ ich an des Buben Stelle gewesen, ich hätt’ wahrscheinlich geweint. Aber der Bub hat mit großen Augen geschaut; ich habe den Eindruck gehabt, er hat fest geatmet und ein paar mal Tränen aus seinen Augen weggeblinzelt. .
Nein, ich möcht der Bub nicht sein; mit all seiner Kaiserlichen Hoheit und dem ganzen Brimborium darum herum. Ich möcht’ er nicht sein!
Die ersten Zeichen von Anteilnahme. Ansonsten aber ist auch diese Beschreibung kaum den historisch so gerne zitierten Spuren zuzuordnen, da es einfach eine Regung des Mitleides mit einem Kind war, dessen Mutter fern ist, dessen Vater gefangen ist, als wäre er der Teufel selber, der von der Gunst eines gütigen Großvaters lebt und der von geschmacklosen Höflingen immer wieder mit seinem Vater als ‚Antichrist unserer Tage’ konfrontiert wird.
Die Beurteilung ‚geschmacklos’ steht uns durchaus zu; denn schon wenige Tage später, am 1. November 1817 kam Vater Dietrichstein mit einer so epochalen Neuigkeit nach Hause, dass Joseph Moritz sie sofort notierte.
Einmal, es ist eh selten genug, ist der Vater heute frohgemut aus dem Dienst nach Hause gekommen. Er hat uns auch sogleich alle zusammengerufen und uns dann sehr glücklich, herablassend und wohlwollend verkündet: „Heute zum Allerheiligentag hat Seine Majestät der Kaiser verfügt und uns alle wissen lassen, daß man Seine Kaiserliche Hoheit Napoleon II. fürderhin mit allen Arten von Zusammentreffen mit seinem Vater fernhalten muß. MUSS, hat er gesagt, nicht MÖGE oder SOLLE. MUSS, das ist ein Befehl, auf den ich mich berufen kann und der keine Eventualitäten zulassen tut. Wir wollen heute Abend allen Heiligen danken für diese wunderbare Gnade!“
Ich hätte meinem Vater sagen können, daß mir diese Verfügung des Kaisers nicht unerwartet kommt. Ich habe noch den Blick in Erinnerung, den der Kaiser und der Bub miteinander tauschten, bevor sie die Krafft-Gemälde im Invalidenhaus verließen. Vor drei Wochen war’s.
KAPITEL 6
Im folgenden Jahr, es ist das Jahr 1818, ergeht sich Joseph Moritz in recht peniblen Schilderungen des Alltages und der besonderen Geschehnisse.
Heute früh, am letzten Jänner, haben sie auf dem Glacis vor dem Neutor die Todesurteile gegen den Räuberhauptmann Grasel und seine zwei Hauptmitangeklagten durch Erhängen vollstreckt. Ich war, gegen das Wissen der meinen, dort und hab’ geglaubt, ich werd’ nicht hinschauen können. Ich hab’ auch nicht können, hab’ aber dennoch die ganze Zeit hingeschaut. Es ist schon ein seltsam’ Gefühl, wenn man da sieht, wie drei Leben ausgelöscht werden. Daß da ein neues, ewiges Leben beginnen soll, davon sieht man nichts und ahnt man nichts. Man sieht nur drei Männer hingehen, aufrecht, männlich und stark. Und dann werden sie weggetragen wie Mehlsäck’, totes Zeug. Es schaut eher so aus, als ob’s da einfach aus wär’. Einfach aus.
Man hat mich als Standsperson nicht erkannt. Es ist bitterkalt heute, darum habe ich mich ganz vermummt in meinen grauen Mantel, den ich so liebe.
Darum habe ich aber auch gehört, wie die Leute gefragt haben: „Wissen möchte’ ich, wer jetzt die 4000 Gulden Belohnung kassiert hat.“
Stimmt, daß sie ausgesetzt waren als Belohnung, davon hat man gehört. Aber wer sie jetzt wirklich gekriegt hat, davon hat man nichts mehr gehört Wird wohl in ärarischen Tümpeln versunken sein, das viele Geld.
Und kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der das an den Tag gebracht hätte. Welche Zeiten!
Noch ein bemerkenswertes Ereignis verzeichnet Joseph Moritz am 1. März. Wir erwähnen dies hier deshalb, weil wir schon anlässlich der Uraufführung von Grillparzers ‚Ahnfrau’ erfahren durften, dass Joseph Moritz sich in künstlerischen Dingen gegenüber aufgeschlossen ist und sich ein Urteil erlaubt, das zumindest von recht untrüglichem Gefühl zeugt.
Waren heute im ‚Gasthof zum Römischen Kaiser’. Nicht essen, das wäre wohl nicht recht standesgemäß gewesen. Nein, sie haben dort einen Saal, in dem sie Musik aufführen.
„Musik, um die man sich kümmern muß“, meinte mein Vater und forderte mich auf, ihn dorthin zu begleiten.
Längere Zeit wurde nichts Auffälliges musiziert. Das Orchester spielte recht mäßig, es war Musik in Konfektionsausführung, sonst nichts. Ein einziges Stück, das mir auch aufgefallen wäre, wenn mich mein Vater nicht gestoßen hätte, das war von einem gewissen Schubert, Franz, glaube ich.
„Eigentlich ein fabelhafter Liederschreiber “, sagte Vater.
Heute aber haben sie uns eine ‚Ouvertüre im italienischen Stil’ von ihm vorgeführt. Und sie war wirklich flott, diese Ouvertüre, spritzig, voll Italianitá. Vater war recht angetan, das Publikum auch. Der Meister war selber anwesend und mußte drei Hervorrufe entgegennehmen.
Beim Anblick Schuberts fragte ich mich wieder einmal, wo der liebe Gott seine Wunder hintut; da stand ein kleiner, dicker, schwitzender, knollennasiger, kurzsichtiger, rotbackiger, gelbhäutiger Jüngling oben auf dem Podest und machte einen so unappetitlichen Eindruck, daß man meinte, man müsse den Schweiß in seinem Gewande noch meilenweit riechen.
Vater aber dachte anderes: „Wenn der so weitermacht, kann er steinreich werden!“
Auf dem Nachhauseweg in der Kutsche habe ich angefangen, den kleinen Schubert ein wenig zu beneiden. Was für eine jämmerliche menschliche Erscheinung, und was für eine wunderbare Musik. Als wollte da jemand eine Waage ins Gleichgewicht bringen.
Es ist die tiefe Empfindsamkeit des Joseph Moritz, die diese Passage seines Tagebuches bemerkenswert macht. Nicht allerdings die Bemerkung des Vaters, dass Schubert, wenn er so weitermache, steinreich werden würde. Wir wissen, dass Schubert ‚so weitergemacht’ hat, und dennoch ein ziemlich armseliges Leben hatte. Man muss dem Grafen Dietrichstein aber zur Ehre anrechnen, dass er in seiner späteren Funktion, er war nach 1831 Intendant der Hofbühne und Präfekt der Hofbibliothek, einiges für die Komponisten getan hat, um die Bezahlung ihrer Aufführungsrechte zu regeln. Kaum hatte er die Aufführungsentgelte halbwegs geregelt, schrieb er selber auch Lieder: Tänze und Menuette, von denen einige sogar recht bekannt geworden sind.
Anfang Juni des Jahres 1818 reiste Joseph Moritz nach Ragusa, dem heutigen Dubrovnik. Es dürfte dies wohl die erste jener Reisen gewesen sein, die er dann später immer wieder mit großer Genauigkeit und wohl auch Begeisterung beschreibt. Während er die späteren Reisen aber immer in gewissem Sinne dem Herzog erzählt, haben wir hier einen Bericht vorliegen, der noch gänzlich unbeeinflusst ist von der späteren Total-Ausrichtung. Es war eine jener Wirtschaftsdelegationen, die nach Ragusa reisen musste, zu Hilfe gerufen von einer ehemals blühenden Republik, die jetzt um ihre Existenz rang.
Wir haben heute über den Sinn unserer Reise gesprochen, während die Kutsche uns über die Dalmatinischen Berge schaukelte. Der Doktor Prokesch sprach dann aus, was wir alle im tiefsten Innersten schon gedacht hatten: „Was wollen die in Ragusa? In der Ecke des Reiches, im Hintergrund die Türkische Mißwirtschaft? Wozu sich da anstrengen? Das ist verlorenes Terrain. Die sind erledigt. Reines Augen-Auswischen, die ganze Reise da!“
‚Wer soll sich da anstrengen?’, war wohl der Kernsatz. Die Monarchie tat wirklich nichts, um dem vor sich hin siechenden Ragusa auf die Beine zu helfen. Ganz im Gegenteil, der altösterreichische Schlendrian trieb hier solche Blüten, dass einige der alteingesessenen Familien Ragusas ob des immerwährenden Niederganges ihrer einstmals so stolzen Republik den Beschluss fassten, ihre Dynastien zu beenden; was viele von ihnen später dann auch taten. Böse Zungen behaupten, dass Ragusa vielleicht deshalb ein kleines Homosexuellen-Paradies geworden ist. Aber das sind, wie gesagt, böse Zungen. Tatsache allerdings ist, dass Ragusaner Familien ausgestorben sind. Aus Protest. Ob sie das nur durch Enthaltsamkeit bewirkt haben, bleibe angezweifelt.
Aber wozu mache ich mir Gedanken...
schreibt Joseph Moritz noch am selben Tag, oder einige Tag später.
...ich bin ja doch nur Aufputz hier.
Tatsache ist, dass jede dieser Delegationen mit einer gewissen Menge an Adeligen ‚bestückt’ war. Und an diesem Grad der Bestückung konnte man Wichtigkeit ablesen, die man in Wien der Delegation beimaß.
Neben Moritz Graf Dietrichstein reiste noch ein junger Herberstein mit, der ein rechter Tunichtgut gewesen und für den diese Reise sogar eine Art Straf-Expedition gewesen sein soll. Dazu eben Joseph Moritz mit seinen gerade erst 17 Jahren. Alle wussten also, was diese Delegation wert sein sollte, die Ragusaner wussten es, und auch die Fachleute, die da mitreisten. Für die Ragusaner war die Besetzung der Delegation aus Wien fast einer Beleidigung gleichzusetzen.