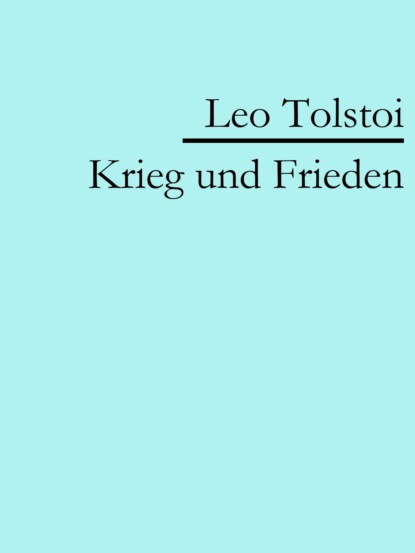- -
- 100%
- +
Er sah dem Fürsten Andrei gerade ins Gesicht und ließ auf einmal die zusammengezogene Haut von der Stirn nach unten sinken.
»Jetzt bin ich an der Reihe, Sie nach dem ›Warum?‹ zu fragen, mein Lieber«, sagte Bolkonski. »Ich bekenne Ihnen, daß ich eines nicht verstehe; vielleicht stecken da diplomatische Feinheiten dahinter, die über meinen schwachen Verstand hinausgehen; aber eines verstehe ich nicht: Mack verliert seine ganze Armee; der Erzherzog Ferdinand und der Erzherzog Karl verharren in völliger Untätigkeit und machen Fehler über Fehler; Kutusow ist der einzige, der endlich einen wirklichen Sieg erringt, den Zauber der Franzosen bricht – und der Kriegsminister interessiert sich nicht einmal dafür, die Einzelheiten zu erfahren.«
»Gerade dies ist der Grund, mein Lieber. Sehen Sie, bester Freund, ihr da beim Kutusowschen Heer ruft: ›Ein Hurra für den Zaren, für Rußland, für den Glauben!‹ Alles ganz schön und gut; aber was gehen uns, ich meine den österreichischen Hof, eure Siege an? Bringen Sie uns eine nette Nachricht von einem Sieg des Erzherzogs Karl oder des Erzherzogs Ferdinand (Sie wissen: ein Erzherzog ist gerade soviel wert wie der andere), und wäre es auch nur die Nachricht von einem Sieg über eine Feuerwehrkompanie bei Bonapartes Truppen: dann werden unsere Kanonen Viktoria schießen. Aber was Sie uns da, wie mit besonderer Absicht, melden, das kann uns nur verdrießen. Der Erzherzog Karl tut gar nichts; der Erzherzog Ferdinand bedeckt sich mit Schmach. Wien gebt ihr auf und schützt es nicht mehr, als wenn ihr zu uns sagen wolltet: ›Gott stehe uns und euch und eurer Hauptstadt bei!‹ Der einzige General, den wir alle gern hatten, war Schmidt; den führt ihr in den Kugelregen, wo er fällt, und dann beglückwünscht ihr uns zu dem Sieg! Das müssen Sie doch selbst sagen: etwas, wodurch der Hof sich schlimmer gereizt fühlen könnte als durch die Nachricht, die Sie bringen, kann man sich gar nicht ausdenken. Dieses Ereignis macht gewissermaßen den Eindruck der Absichtlichkeit. Außerdem, selbst wenn ihr einen wahrhaft glänzenden Sieg davongetragen hättet, ja selbst wenn dies dem Erzherzog Karl gelungen wäre: inwiefern würde dadurch der allgemeine Gang der Dinge beeinflußt werden? Jetzt käme das alles doch zu spät, da Wien von den französischen Truppen besetzt ist.«
»Besetzt, sagen Sie? Wien besetzt?«
»Und nicht bloß das; sondern es ist auch schon Bonaparte in Schönbrunn, und der Graf, unser lieber Graf Wrbna, begibt sich zu ihm, um seine Befehle einzuholen.«
Bolkonski merkte, daß die Reise und der Besuch beim Minister und namentlich das Diner ihn doch dermaßen ermüdet und seine geistige Kraft gelähmt hatten, daß er die ganze Bedeutung der soeben gehörten Worte nicht verstand.
»Heute morgen war Graf Lichtenfels bei mir«, fuhr Bilibin fort, »und zeigte mir einen Brief, in dem die Parade der Franzosen in Wien ausführlich beschrieben war. Prinz Murat und alles, was drum und dran hängt ... Sie sehen, daß Ihr Sieg keineswegs besonders erfreulich ist, und daß man Sie nicht als Retter empfangen kann ...«
»Wirklich, die Art des Empfanges ist mir ganz gleichgültig, völlig gleichgültig«, sagte Fürst Andrei, der zu verstehen begann, daß seine Nachricht von einem Kampf in der Nähe von Krems angesichts solcher Ereignisse, wie es die Besetzung der österreichischen Hauptstadt war, in der Tat nur eine sehr untergeordnete Bedeutung hatte. »Wie ist es denn aber zugegangen, daß Wien eingenommen wurde?« fragte er. »Und wie ist es mit der Brücke und dem berühmten Brückenkopf und dem Fürsten Auersperg? Bei uns hieß es doch, Fürst Auersperg werde Wien verteidigen.«
»Fürst Auersperg steht auf dieser Seite der Donau, auf der unsrigen, und beschützt uns; ich glaube zwar, daß er nur ein schlechter Schutz für uns ist, nun, aber er beschützt uns doch. Wien aber liegt auf der andern Seite. Sie fragen nach der Brücke; nein, die Brücke ist noch nicht genommen und wird auch, wie ich hoffe, nicht genommen werden, weil Minen darin gelegt sind und Befehl gegeben ist, sie in die Luft zu sprengen. Andernfalls wären wir schon längst in den böhmischen Gebirgen, und Sie und Ihre Armee hätten eine böse Viertelstunde zwischen zwei Feuern durchzumachen gehabt.«
»Aber das soll doch nicht heißen, daß der ganze Feldzug beendet wäre?« fragte Fürst Andrei.
»Ich meine allerdings, daß er beendet ist. Und derselben Ansicht sind auch die großen Schlafmützen hier; sie wagen nur nicht, es auszusprechen. Es tritt eben ein, was ich gleich zu Beginn des Feldzuges gesagt habe: nicht durch euer Scharmützel bei Dürrenstein wird die Sache entschieden und überhaupt nicht durch das Pulver, sondern durch die Leute, die das Pulver erfunden haben«, sagte Bilibin, eines seiner Witzworte wiederholend. Er zog die Haut auf der Stirn auseinander und hielt einen Augenblick inne. »Die Frage ist nur, was die Zusammenkunft des Kaisers Alexander mit dem König von Preußen in Berlin für einen Erfolg hat. Wenn Preußen in die Allianz eintritt, dann hat Österreich nicht mehr freie Hand, und der Krieg geht weiter. Wenn nicht, dann kommt es nur darauf an, zu verabreden, wo die Präliminarien für ein neues Campo Formio aufgestellt werden sollen.«
»Aber welch eine erstaunliche Genialität!« rief auf einmal Fürst Andrei, indem er seine kleine Hand zur Faust ballte und damit auf den Tisch schlug. »Und was für ein Glück dieser Mensch hat!«
»Buonaparte?« erwiderte Bilibin in fragendem Ton; er runzelte die Stirn und gab damit zu verstehen, daß sogleich eine pointierte Wendung kommen werde. »Buonaparte?« sagte er und legte dabei einen besonderen Nachdruck auf den Vokal u. »Ich möchte doch meinen, daß, wenn er jetzt dem österreichischen Kaiserstaat von Schönbrunn aus Gesetze vorschreibt, man ihn von seinem u befreien sollte. Ich führe entschlossenen Mutes eine Neuerung ein und nenne ihn künftig schlechtweg Bonaparte.«
»Nein, nun ohne Scherz«, sagte Fürst Andrei. »Sind Sie wirklich der Ansicht, daß der Feldzug zu Ende ist?«
»Meine Ansicht ist diese. Österreich hat die Zeche bezahlen müssen; aber daran ist dieser Staat nicht gewöhnt. Er wird es uns wiedervergelten. Die Zeche bezahlt hat Österreich insofern, als seine Provinzen verwüstet sind (man sagt, die rechtgläubigen Truppen verständen sich auf das Plündern in einer entsetzlichen Weise), seine Armee geschlagen und seine Hauptstadt vom Feind besetzt, und das alles um der schönen Augen Seiner sardinischen Majestät willen. Und daher (unter uns, mein Lieber) glaube ich zu wittern, daß Österreich uns betrügt; ich glaube zu wittern, daß es Verhandlungen mit Frankreich angeknüpft und einen Friedensschluß, den Abschluß eines geheimen Separatfriedens, ins Auge gefaßt hat.«
»Das ist nicht möglich!« rief Fürst Andrei. »Das wäre ja schändlich!«
»Qui vivra, verra«, erwiderte Bilibin und zog die Stirnhaut wieder auseinander, woraus zu ersehen war, daß er dieses Gespräch als beendet betrachtete.
Als Fürst Andrei in das für ihn zurechtgemachte Zimmer kam und sich in frischer Wäsche auf Federbetten und parfümierte, gewärmte Kissen legte, da hatte er die Empfindung, als ob das Treffen, von dem er die Nachricht hergebracht hatte, weit, weit hinter ihm läge. Das Bündnis mit Preußen, die Verräterei Österreichs, der neue Triumph Bonapartes sowie morgen die Parade und die Cour und die Audienz beim Kaiser Franz, das war's, was seine Gedanken beschäftigte.
Er schloß die Augen; aber in demselben Augenblick ging auch in seinen Ohren das Donnern der Kanonen, das Knattern des Gewehrfeuers, das Rasseln der Räder seines Postwagens los, und da stiegen wieder von dem Berg in lang ausgedehnten Linien die Musketiere herab, und die Franzosen schossen, und er fühlte, wie sein Herz zu zucken begann, und er ritt neben dem General Schmidt vorwärts, und die Kugeln pfiffen lustig um ihn herum, und er empfand das Gefühl einer verzehnfachten Lebensfreude, wie er sie seit seiner Kindheit nicht mehr gekannt hatte.
Er erwachte.
»Ja, das ist wirklich alles geschehen ...!« sagte er mit einem glücklichen, kindlichen Lächeln zu sich selbst, und dann versank er in einen festen, jugendlichen Schlaf.
XI
Am nächsten Morgen erwachte er erst spät. Indem er sich die Ereignisse des vergangenen Tages ins Gedächtnis zurückrief, erinnerte er sich vor allem daran, daß er sich heute dem Kaiser Franz vorstellen sollte, und weiter erinnerte er sich an den Kriegsminister, an den höflichen österreichischen Flügeladjutanten, an Bilibin und an das Gespräch, das er mit diesem am vorhergehenden Abend geführt hatte. Nachdem er zu der Fahrt nach dem Schloß volle Paradeuniform angelegt hatte, was bei ihm schon lange nicht mehr dagewesen war, trat er frisch und munter, eine hübsche Erscheinung, mit verbundener Hand in Bilibins Arbeitszimmer. Hier waren vier Herren vom diplomatischen Korps anwesend. Den Fürsten Ippolit Kuragin, welcher Gesandtschaftssekretär war, kannte Bolkonski bereits; mit den übrigen machte ihn Bilibin bekannt.
Diese Herren, die bei Bilibin zu Besuch waren, sämtlich lebenslustige, vornehme, reiche junge Männer, bildeten hier in Brünn, wie schon vorher in Wien, einen besonderen Zirkel, welchen Bilibin, sozusagen der Vorsitzende desselben, »die Unsrigen«, les nôtres, nannte. Dieser fast ausschließlich aus Diplomaten bestehende Klub hatte augenscheinlich seine eigenen Interessen, die mit Krieg und Politik nichts gemein hatten; diese Interessen drehten sich um Ereignisse in der höheren Gesellschaft, um Beziehungen zu gewissen Damen und um die bureaumäßige Seite des Dienstes. Diese Herren empfingen den Fürsten Andrei in ihrem Kreis allem Anschein nach gern, wie einen der Ihrigen, eine Ehre, die sie nur wenigen erwiesen. Aus Höflichkeit, und um dadurch das Gespräch in Gang zu bringen, richteten sie an ihn einige Fragen über das Heer und das Treffen; dann aber löste sich das Gespräch in Scherze und Plaudereien auf, die sich locker aneinanderreihten.
»Aber das schönste dabei war«, sagte einer, der von dem Mißgeschick eines diplomatischen Kollegen erzählte, »das schönste dabei war, daß der Kanzler ihm geradezu sagte, seine Ernennung nach London sei eine Beförderung, und als solche möge er sie auch ansehen. Können Sie sich vorstellen, was er dabei für eine Figur machte?«
»Was jedoch das allerschlimmste ist, meine Herren«, fügte ein anderer hinzu, »ich muß Kuragin vor Ihnen anklagen: jener arme Kerl sitzt in der Patsche, und dieser Don Juan hier macht sich das zunutze; so ein entsetzlicher Mensch!«
Fürst Ippolit lag auf einem bequemen Lehnstuhl und streckte die Beine über die Seitenlehne.
»Das könnte wohl zutreffen«, sagte er.
»Oh, Sie Don Juan, Sie Schlange!« riefen mehrere Herren.
»Sie wissen nicht, Bolkonski«, wandte sich Bilibin an den Fürsten Andrei, »daß alle Schreckenstaten der französischen Armee (beinahe hätte ich gesagt: der russischen) nichts sind im Vergleich mit dem Unheil, das dieser Mensch unter den Frauen angerichtet hat.«
»Das Weib ist die Genossin des Mannes«, bemerkte Fürst Ippolit und betrachtete seine hochliegenden Füße durch die Lorgnette.
Bilibin und die »Unsrigen« lachten beim Anblick seines Gesichts laut los. Fürst Andrei merkte, daß dieser Ippolit, auf den er (er konnte es nicht ableugnen) beinahe wegen seiner Frau eifersüchtig geworden wäre, in dieser Gesellschaft die Stelle eines Hansnarren einnahm.
»Nein, ich muß Ihnen Kuragin in seiner ganzen Glorie zeigen«, sagte Bilibin leise zu Bolkonski. »Er ist unbezahlbar, wenn er über Politik spricht; diese Wichtigtuerei müssen Sie sehen.«
Er setzte sich neben Ippolit, legte seine Stirn in die üblichen Falten und begann mit ihm ein Gespräch über Politik. Fürst Andrei und die andern umringten die beiden.
»Das Berliner Kabinett kann seine Ansicht über ein Bündnis nicht aussprechen«, begann Ippolit und blickte dabei alle bedeutsam an, »ohne auszusprechen ... wie in seiner letzten Note ... Sie verstehen ... Sie verstehen ... Übrigens, wenn Seine Majestät der Kaiser nicht dem Grundgedanken unseres Bündnisses untreu wird ...«
»Warten Sie, ich bin noch nicht fertig«, sagte er zum Fürsten Andrei und ergriff dessen Hand. »Ich bin der Ansicht, daß eine Intervention stärker sein wird als die Unterlassung derselben. Und ...« Er schwieg einen Augenblick. »Man kann unmöglich die Sache durch die Nichtannahme unserer Depesche vom 28. Oktober für beendet halten. So wird der Ausgang der ganzen Sache sein.«
Er ließ Bolkonskis Hand wieder los und deutete damit an, daß er nun wirklich ganz fertig sei.
»Demosthenes, ich erkenne dich an dem Kieselstein, den du in deinem goldenen Mund versteckt hältst«, sagte Bilibin, dem sich vor Vergnügen der ganze Haarschopf auf dem Kopf verschob.
Alle lachten, und Ippolit am lautesten von allen. Es machte ihm offenbar physischen Schmerz, und er konnte kaum Atem holen; aber er war nicht imstande, dieses heftige Lachen zu hemmen, bei dem sich sein sonst immer unbewegliches Gesicht in die Länge zog.
»Hören Sie einmal zu, meine Herren«, sagte Bilibin. »Bolkonski ist mein Gast sowohl in meiner Wohnung als auch hier in Brünn, und ich möchte ihn, soweit es in meinen Kräften steht, mit allen Lebensgenüssen, die hier zu haben sind, regalieren. Wenn wir in Wien wären, so wäre das eine leichte Sache; aber hier in diesem häßlichen mährischen Loch ist es schwieriger, und ich bitte Sie alle um Ihren Beistand. Wir müssen ihm Brünn von der besten Seite zeigen. Sie nehmen das Theater auf sich, ich die Gesellschaft, Sie, Ippolit, selbstverständlich die Weiber.«
»Wir müssen ihm Amélie zeigen, dieses reizende Wesen!« sagte einer der »Unsrigen«, indem er seine Fingerspitzen küßte.
»Überhaupt müssen wir diesen blutdürstigen Krieger zu einer humaneren Anschauungsweise bringen«, meinte Bilibin.
»Ich werde von Ihren gastfreundlichen Anerbietungen kaum Gebrauch machen können«, sagte Bolkonski, und mit einem Blick auf die Uhr fügte er hinzu: »Und jetzt ist es Zeit, daß ich wegfahre.«
»Wohin denn?«
»Zum Kaiser.«
»Oh! oh! oh!«
»Na, dann also auf Wiedersehen, Bolkonski! Auf Wiedersehen, Fürst. Kommen Sie ja recht früh zum Mittagessen«, redeten die Herren durcheinander. »Wir rechnen auf Sie.«
»Nehmen Sie, wenn Sie mit dem Kaiser reden, darauf Bedacht, die gute Ordnung in der Lieferung des Proviants und der Transportmittel soviel wie irgend möglich zu loben«, sagte Bilibin, während er seinen Gast bis ins Vorzimmer begleitete.
»Ich würde es gern loben; aber nach meiner Kenntnis der Verhältnisse kann ich es nicht wahrheitsgemäß tun«, antwortete Bolkonski lächelnd.
»Nun, reden Sie überhaupt soviel wie möglich. Audienz zu geben ist seine besondere Passion; aber selbst zu sprechen, das liebt er nicht und versteht er auch nicht, wie Sie sehen werden.«
XII
Bei der Cour blickte Kaiser Franz dem Fürsten Andrei, der an dem ihm angewiesenen Platz zwischen den österreichischen Offizieren stand, nur starr ins Gesicht und nickte ihm mit seinem langen Kopf zu. Aber nach der Cour teilte dem Fürsten Andrei der ihm vom vorhergehenden Tage bekannte Flügeladjutant in sehr höflicher Weise mit, daß der Kaiser den Wunsch habe, ihm Audienz zu erteilen. Kaiser Franz empfing ihn mitten im Zimmer stehend. Ehe das Gespräch begann, war Fürst Andrei überrascht, zu sehen, daß der Kaiser gewissermaßen verlegen war, nicht wußte, was er sagen sollte, und errötete.
»Sagen Sie, wann hat das Treffen angefangen?« fragte er dann hastig.
Fürst Andrei antwortete. Auf diese Frage folgten andere von ebenso einfachem Inhalt: ob Kutusow gesund sei; wie lange es her sei, daß er, Fürst Andrei, aus Krems abgefahren sei, usw. Der Kaiser sprach in einem Ton, als ob seine ganze Absicht nur darin bestände, eine gewisse Anzahl von Fragen zu stellen. Die Antworten auf diese Fragen aber vermochten (das war nur zu offensichtlich) kein Interesse bei ihm zu erwecken.
»Um welche Stunde hat das Treffen angefangen?« fragte der Kaiser.
»Ich kann Euer Majestät nicht Auskunft geben, um welche Stunde das Treffen in der Front begonnen hat; aber in Dürrenstein, wo ich mich befand, begannen unsere Truppen den Angriff zwischen fünf und sechs Uhr abends«, antwortete Bolkonski lebhafter werdend; diese Frage brachte ihn zu dem Glauben, er werde nun die Möglichkeit haben, die in seinem Kopf bereits fertige, wahrheitsgemäße Schilderung alles dessen, was er wußte und zum Teil selbst gesehen hatte, vorzutragen.
Aber der Kaiser lächelte und unterbrach ihn:
»Wieviel Meilen?«
»Von wo bis wohin, Euer Majestät?«
»Von Dürrenstein bis Krems.«
»Drei und eine halbe Meile, Euer Majestät.«
»Die Franzosen haben das linke Ufer verlassen?«
»Wie die Kundschafter meldeten, sind die letzten in der Nacht auf Flößen übergesetzt.«
»Ist genug Furage in Krems?«
»Die Furage war nicht in derjenigen Quantität geliefert ...«
Der Kaiser unterbrach ihn:
»Um wieviel Uhr ist General Schmidt gefallen?«
»Ich glaube, um sieben Uhr.«
»Um sieben Uhr. Sehr traurig! Sehr traurig!«
Der Kaiser sagte, er sei ihm dankbar und verbeugte sich. Fürst Andrei ging hinaus und sah sich sofort von allen Seiten von Hofleuten umringt. Von allen Seiten blickten ihn freundliche Augen an und wurden freundliche Worte an ihn gerichtet. Der Flügeladjutant von gestern machte ihm Vorwürfe, daß er nicht im Schloß Quartier genommen habe, und stellte ihm seine eigene Wohnung zur Verfügung. Der Kriegsminister trat zu ihm heran und beglückwünschte ihn zu dem Maria-Theresia-Orden dritter Klasse, den ihm der Kaiser verliehen hatte. Ein Kammerherr der Kaiserin brachte ihm eine Einladung zu Ihrer Majestät. Die Erzherzogin wünschte ebenfalls, ihn zu sehen. Er wußte gar nicht, wem er zuerst antworten sollte, und brauchte einige Augenblicke, um seine Gedanken zu sammeln. Der russische Gesandte faßte ihn an der Schulter, führte ihn an ein Fenster und begann ein Gespräch mit ihm.
Ganz gegen Bilibins Voraussagung wurde die Nachricht, welche Fürst Andrei gebracht hatte, sehr freudig aufgenommen. Ein Dankgottesdienst wurde angeordnet. Kutusow wurde mit dem Großkreuz des Maria-Theresia-Ordens belohnt; auch viele Offiziere und Mannschaften wurden mit Dekorationen bedacht. Bolkonski empfing von allen Seiten Einladungen und sah sich genötigt, den ganzen Vormittag über bei den höheren österreichischen Würdenträgern Visiten zu machen. Als er gegen fünf Uhr nachmittags mit seinen Besuchen fertig geworden war, machte er sich auf den Weg nach Hause, zu Bilibin, und entwarf unterwegs in Gedanken einen Brief an seinen Vater über das Treffen und über seine Reise nach Brünn. Vor der Tür des Hauses, in welchem Bilibin wohnte, stand eine bereits zur Hälfte mit Gepäck beladene Britschke, und Franz, Bilibins Diener, trat gerade, mühsam einen Koffer schleppend, aus der Haustür.
Ehe Fürst Andrei wieder zu Bilibin fuhr, war er noch in einer Buchhandlung gewesen, um sich für den Feldzug mit Büchern zu versorgen, und hatte sich dort unvermerkt etwas länger aufgehalten.
»Was gibt es denn?« fragte Bolkonski.
»Ach, Durchlaucht«, antwortete Franz, indem er den Koffer mit Anstrengung auf die Britschke hob. »Wir ziehen noch weiter. Der Bösewicht ist schon wieder hinter uns her!«
»Was bedeutet das? Was ist los?« fragte sich Fürst Andrei und ging eilig hinein.
In der Wohnung kam ihm Bilibin entgegen. Auf seinem sonst immer so ruhigen Gesicht prägte sich doch eine ziemliche Erregung aus.
»Nein, nein, das müssen Sie doch selbst zugeben«, sagte er, »daß diese Geschichte mit der Taborbrücke« (eine Brücke in Wien) »geradezu köstlich ist. Sie sind hinübergekommen, ohne irgendwelchen Widerstand zu finden.«
Fürst Andrei verstand ihn nicht.
»Aber wo kommen Sie denn her, daß Sie nicht wissen, was bereits jeder Kutscher in der Stadt weiß?«
»Ich komme von der Erzherzogin. Da habe ich nichts gehört.«
»Und haben Sie nicht gesehen, daß überall gepackt wird?«
»Nein, ich habe nichts gesehen ... Aber was ist denn eigentlich geschehen?« fragte Fürst Andrei ungeduldig.
»Was geschehen ist? Die Franzosen haben die Brücke passiert, die Auersperg verteidigen sollte, und die Brücke ist nicht in die Luft gesprengt worden, so daß Murat in diesem Augenblick schon auf der Chaussee nach Brünn dahinjagt und heute oder morgen hier sein wird.«
»Hier? Aber warum ist denn die Brücke nicht in die Luft gesprengt worden, da sie doch unterminiert ist?«
»Das frage ich Sie. Das weiß kein Mensch, nicht einmal Bonaparte selbst.«
Bolkonski zuckte die Achseln.
»Aber wenn sie die Brücke passiert haben, so ist damit unsere Armee verloren; sie wird abgeschnitten werden«, sagte er.
»Das ist ja bei diesem schlauen Streich auch die Absicht«, antwortete Bilibin. »Hören Sie zu. Die Franzosen rücken in Wien ein, wie ich Ihnen schon erzählt habe. Alles sehr schön. Am andern Tag, das heißt gestern, steigen die Herren Marschälle Murat, Lannes und Belliard zu Pferd und reiten nach der Brücke. (Bitte zu beachten, daß sie alle drei aus der Gascogne stammen.) ›Meine Herren‹, sagt einer von ihnen, ›Sie wissen, daß die Taborbrücke unterminiert ist, und daß sich an ihrem jenseitigen Ende ein furchtbarer Brückenkopf befindet und fünfzehntausend Mann, welche Befehl haben, die Brücke in die Luft zu sprengen und uns nicht hinüberzulassen. Aber unserm Kaiser Napoleon wird es angenehm sein, wenn wir diese Brücke nehmen. Wir wollen alle drei hinüberreiten und diese Brücke nehmen.‹ – ›Schön, reiten wir hinüber!‹ sagen die andern; und sie überschreiten die Brücke und nehmen sie und befinden sich jetzt mit ihrer ganzen Armee auf dieser Seite der Donau und rücken gegen uns und gegen euch und eure Verbindungen vor.«
»Lassen Sie die Späße«, sagte Fürst Andrei ernst und traurig.
Diese Nachricht war für den Fürsten Andrei betrübend, eröffnete ihm aber doch zugleich eine erwünschte Aussicht.
Sowie er gehört hatte, daß sich die russische Armee in so gefährlicher Lage befinde, war ihm auch sofort der Gedanke durch den Kopf geschossen, er, gerade er sei dazu prädestiniert, die Armee aus dieser Lage zu retten; hier sei sein Toulon, das ihn aus der Masse der unbekannten Offiziere herausheben und ihm den Eintritt in die Ruhmeslaufbahn ermöglichen werde. Während er Bilibin zuhörte, stellte er es sich bereits vor, wie er nach seiner Rückkehr zur Armee im Kriegsrat seinen Plan, das einzige Mittel zur Rettung der Armee, vorlegen und wie man ihn allein mit der Ausführung dieses Planes beauftragen werde.
»Lassen Sie die Späße«, sagte er.
»Das sind keine Späße«, fuhr Bilibin fort. »Nichts kann wahrer und trauriger sein. Diese drei Herren reiten ganz allein auf die Brücke und heben weiße Tücher in die Höhe; sie versichern, es sei ein Waffenstillstand abgeschlossen, und sie, die Marschälle, kämen, um mit dem Fürsten Auersperg das Erforderliche zu besprechen. Der wachhabende Offizier läßt sie in den Brückenkopf hinein. Sie erzählen ihm tausend Gascogner Schwindelgeschichten, sagen, der Krieg sei beendet, Kaiser Franz habe mit Bonaparte eine Zusammenkunft verabredet, und sie selbst hätten den Wunsch, mit dem Fürsten Auersperg zu reden, und was solcher Gasconaden mehr sind. Der Offizier schickt zu Auersperg, um diesen holen zu lassen; die Herren Marschälle umarmen die Offiziere, scherzen und setzen sich auf die Kanonen; unterdessen aber rückt ein französisches Bataillon unbeachtet auf die Brücke, wirft die Säcke mit Brennstoffen ins Wasser und nähert sich dem Brückenkopf. Endlich erscheint der Generalleutnant selbst, unser lieber Fürst Auersperg von Mautern. ›Liebenswürdiger Gegner! Perle des österreichischen Heeres, Held der Türkenkriege! Die Feindschaft ist beendet; wir können einander die Hand reichen. Der Kaiser Napoleon brennt vor Verlangen, den Fürsten Auersperg kennenzulernen.‹ Mit einem Wort, diese Herren, die nicht umsonst Gascogner sind, überschütten Auersperg derartig mit schönen Worten, und dieser ist so entzückt über seine schnell entstandene Intimität mit den französischen Marschällen, so geblendet von dem Anblick des Mantels und der Straußfedern und der Brillantagraffe Murats, daß er nur das Feuer der Edelsteine sieht und nicht an das Feuer denkt, das er auf die Feinde geben lassen müßte.« (Trotz der Lebhaftigkeit seiner Darstellung vergaß Bilibin nicht, nach diesem Witzwort einen Augenblick innezuhalten, um seinem Zuhörer Zeit zu lassen, es gebührend zu bewundern.) »Das französische Bataillon dringt im Laufschritt in den Brückenkopf ein, vernagelt die Kanonen, und die Brücke ist genommen. Nein, und was das allerschönste ist«, fuhr er fort, und es schien, als ob der Reiz seiner eigenen Erzählung ihm zu einer gewissen Beruhigung von seiner Aufregung verhülfe, »der Sergeant, der bei der Kanone aufgestellt war, auf deren Signalschuß die Mine angezündet und die Brücke in die Luft gesprengt werden sollte, dieser Sergeant wollte, als er sah, daß das französische Militär auf die Brücke gelaufen kam, schon den Signalschuß abgeben, aber Lannes hielt ihm den Arm zurück. Der Sergeant, der augenscheinlich klüger war als sein General, tritt zu Auersperg heran und sagt: ›Fürst, man betrügt Sie; da kommen die Franzosen!‹ Murat sieht, daß sie ihr Spiel verloren haben, wenn sie den Sergeanten weiterreden lassen. Mit erheucheltem Staunen (der echte Gascogner!) wendet er sich zu Auersperg: ›Ich werde irre an der in der ganzen Welt so gepriesenen österreichischen Disziplin‹, sagt er; ›Sie erlauben Ihrem Untergebenen in dieser Weise zu Ihnen zu reden?‹ Das war wahrhaft genial! Der Fürst Auersperg fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und läßt den Sergeanten in Arrest setzen. Nein, da müssen Sie aber doch zugeben, daß diese ganze Geschichte von der Taborbrücke reizend ist. Das ist weder Dummheit noch Feigheit ...«