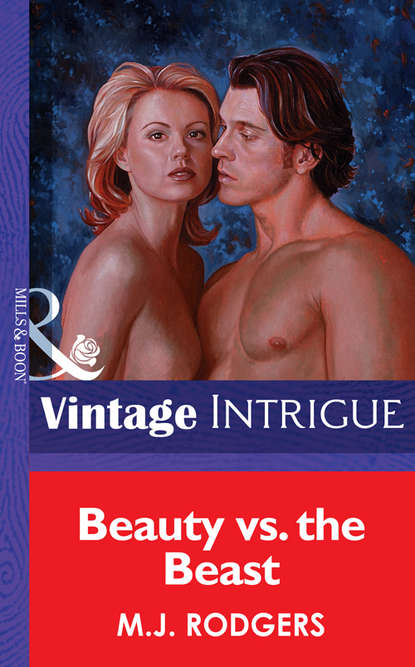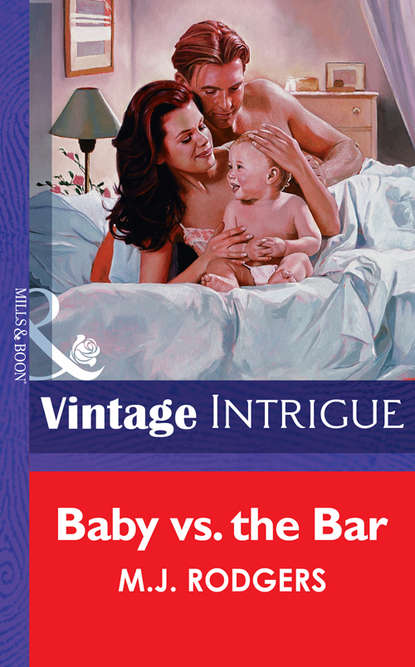- -
- 100%
- +
gerechtes Recht
Jedoch ist Recht nicht nur normativer Ausdruck, sondern zugleich auch Regulator und damit Gestalter sozialer Beziehungen. Sollen diese dem Anspruch der Gerechtigkeit standhalten, so muss auch das Recht imstande sein, seinerseits die Gerechtigkeitsanforderungen zu erfüllen. Grundlegend hierfür ist, dass die Regeln des Rechts selbst als gerecht gelten können. Damit ist nicht mehr und nicht weniger als das Problem des richtigen Rechts bezeichnet, womit wir innerhalb dieses kleinen Gerechtigkeitsexkurses wieder zu unserer rechtsphilosophischen Ausgangsfrage zurückgelangt sind. Beantwortet werden kann sie auf ganz unterschiedlichen theoretischen Ebenen. Für Kant etwa ist das richtige Recht dann gegeben, wenn der eigene freie Wille zugleich „mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze (… der Freiheit – wäre noch zu ergänzen, wenn man dem Text Kants in dieser knappen Wiedergabe gerecht werden will, d. Verf.) bestehen könne“ (Kant 1797, 338). Das ist zugegebenermaßen wiederum sehr abstrakt. Dennoch ist damit zumindest schon einmal klargestellt, dass – normativ gesprochen – nicht alles, was in Geschichte und Gegenwart in der Form des Rechts auf uns gekommen ist, auch schon notwendigerweise als gerecht angesehen werden muss. In die Wirklichkeitsperspektive des Rechts gewendet bedeutet das, dass soziale Verhältnisse nicht schon deshalb für sich in Anspruch nehmen können, gerecht zu sein, weil sie in der Form des Rechts gesellschaftlich etabliert wurden. Ganz im Gegenteil kann und muss das Recht selbst auch unter Gerechtigkeitsaspekten legitimer Gegenstand der Kritik, notfalls auch des sozialen Protestes sein, wie dies etwa als Reaktion auf die europäische Finanzkrise der letzten Jahre, die sich in verschiedenen europäischen Ländern zu einer sozialen Krise ausweitete, tatsächlich zu beobachten war.
Freilich wird sich die Frage, ob Regeln als gerecht bezeichnet werden können oder nicht, in praktischer Weise kaum von der von Kant besetzten Abstraktionshöhe herab entscheiden lassen. Die juristischen Gerechtigkeitsfragen im engeren Sinn bleiben hier noch einigermaßen unproblematisch und blass. Ihre eigentliche soziale Sprengkraft entwickeln sie erst dann, wenn das allgemeine Diktum der Gleichbehandlung konkretisiert wird. In dem bereits erwähnten Ansatz von Chaim Perelman etwa wird die Gerechtigkeit juristischer Regeln davon abhängig gemacht, ob die Kriterien für die unterschiedlichen Kategorien, innerhalb derer die Menschen gleich behandelt werden, von hinreichender sozialer Relevanz sind und ob die Zuordnung zu ihnen sachlich begründet vorgenommen wurde (Perelman 1967, 119).
Solche Kategorien sind z. B. auf das Arbeitsrecht (vgl. V-3.1) bezogen: ArbGeb, ArbN, leitende Angestellte, andere arbeitnehmerähnliche Personen, Frauen, Schwangere, Behinderte, Jugendliche, Betriebsräte, Gewerkschaftsmitglieder, ArbN in Kleinbetrieben, ArbN in Tendenzbetrieben, befristet Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte, Leiharbeiter, Beschäftigte auf Probe, Beschäftigte je nach unterschiedlicher Dauer der Betriebszugehörigkeit. Für sie alle gelten, je nach Kategorisierung, unterschiedliche Regeln, nach denen sie gleich behandelt werden. Zwischen den einzelnen Gruppen hingegen ist eine Ungleichbehandlung innerhalb des großen Rechtsstoffes „Arbeitsrecht“ möglich, ohne dass deshalb notwendigerweise Gerechtigkeitsgrundsätze verletzt würden.
gerechte Rechtsordnung
Erst unter der Voraussetzung eines in diesem Sinne gerechten Rechts kann der schon auf Aristoteles zurückgehende Satz gelten, wonach die Verletzung einer Regel des Rechts ein Akt der Ungerechtigkeit, die Wiederherstellung ihrer Geltung demnach der grundlegende Vorgang der Herstellung rechtlicher Gerechtigkeit sei. Jedoch bleibt auch eine solche Aussage formal, und zwar in dem Maße, in dem die Regelgerechtigkeit selbst nur formal bestimmt werden konnte. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Realverläufe ist nämlich ohne Weiteres einsichtig, dass in einer bestimmten Situation keineswegs immer nur eine Entscheidungsmöglichkeit zu Kategorisierung und Zuordnung vorstellbar ist. Deshalb lässt sich auch eine gerechte Rechtsordnung insgesamt wieder nur auf eine derart abstrakte Weise beschreiben, wie uns dies bereits bei Kant begegnet ist. Konkret werden die Fragen nach einer gerechten Rechtsordnung hingegen erst dann, wenn die interessengeleiteten Wertungen wieder mit in den Blick genommen werden. Geschieht dies aber, dann steht auch die gerechte Rechtsordnung sofort wieder in einem Spannungsverhältnis zur sozialen Wirklichkeit. Abstrakt kann und muss man daher den Rechtsstaat sehr wohl als Ausdruck und Symbol der gerechten Rechtsordnung begreifen. Werden jedoch die konkreten Bewertungsvorgänge mit in den Blick genommen, dann mag das Rechtsstaatsprinzip zwar immer noch für das Versprechen der Gerechtigkeit stehen. Nach Beispielen und Belegen dafür, wie wenig man aus ihm jedoch eine Garantie für Gerechtigkeit ableiten kann, wird man auch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit des demokratischen und sozialen Rechtsstaates leider nicht allzu lange suchen müssen (z. B. zum Verstoß gegen des Verhältnismäßigkeitsgebot im „Fall“ Gustl Mollath s. 2.1.2.2).
Gerechtigkeit im Rechtsverkehr
Das Verhältnis zwischen abstraktem Gleichheitssatz und konkreter Zuordnungsentscheidung nach den Regeln des Gleichheitssatzes setzt sich auch im Rechtsverkehr zwischen den Rechtspersonen, etwa bei der vertraglichen Gestaltung von Rechtsbeziehungen, fort. Zwar treffen in ihm zunächst in ihrer Willensbildung autonome Partner aufeinander, sodass der allgemeine Grundsatz der Vertragstheorie insoweit zugleich ein Gerechtigkeitspostulat ist: volenti non fit iniuria, was zu Deutsch etwa heißt, dass einem willentlich Zustimmenden eben deshalb, weil er aus freiem Willen zustimmt, auch kein Unrecht erwachsen kann. Nur eine Folge dieses Grundsatzes ist das einem größeren, auch nichtjuristischen, Publikum geläufige pacta sunt servanda (dt.: Verträge sind einzuhalten). Die Hauptelemente der Verkehrsgerechtigkeit betreffen deshalb vor allem den Bereich der ausgleichenden Gerechtigkeit. Jedoch ist der grundlegende Gedanke der Privatautonomie (vgl. II-1.3) an die stillschweigende soziale Voraussetzung des Rechts gebunden, dass der mit einem freien Willen ausgestattete Mensch zugleich auch über die sozialökonomischen Voraussetzungen autonomer Willensentscheidungen verfügt (hierzu Sinzheimer 1930, 50 f.). Genau dieses Gefüge ist aber spätestens dann aus dem Lot, wenn sich das Fiktionale dieser Voraussetzung als reales Ausgeliefertsein an sachliche Abhängigkeitsverhältnisse zeigt und sich der Einzelne unversehens einer faktisch überlegenen Regelungs- und Verfügungsmacht seines Vertragspartners gegenübersieht. Hierauf verweist auch Max Weber, wenn er schreibt (1921, 439):
„Das formale Recht eines Arbeiters, einen Arbeitsvertrag jeden beliebigen Inhalts mit jedem beliebigen Unternehmer einzugehen, bedeutet für den Arbeitsuchenden praktisch nicht die mindeste Freiheit in der eigenen Gestaltung der Arbeitsbedingungen und garantiert ihm an sich auch keinerlei Einfluß darauf.“
Nicht nur im Arbeitsrecht (IV-3), sondern auch im Mietrecht, im Verbraucherrecht und in vielen anderen Rechtsgebieten können derartige Situationen entstehen (vgl. II-1.3). Deshalb werden sich auch zur Verkehrsgerechtigkeit die wirklich schlüssigen Antworten erst wieder aus der Analyse der Klassifikationen von entsprechenden Kategorien und der Beurteilung der jeweiligen Zuordnungen zu ihnen ableiten lassen.
Verfahrensgerechtigkeit
Auch hinsichtlich der Verfahrensgerechtigkeit, also der gerechten Abwicklung rechtlicher Prozesse (Straf-, Zivil-, Familien-, Arbeits-, Verwaltungs- und andere Prozesse) lässt sich an Rawls Gerechtigkeitstheorie anknüpfen. Der verfahrensbezogene Aspekt seines „Justice as Fairness“ ist sowohl aus strafrechtstheoretischer (vgl. Hörnle 2004; hierzu IV-4.1) als auch konstruktivistisch-methodischer Sicht (vgl. I-6) bedeutend. Für John Rawls war ein faires Verfahren die Grundlage für die Gerechtigkeit und das Recht schlechthin, ein Ansatz, der sich im angelsächsischen Recht des Common Law stärker als in kontinentaleuropäischen Civil-Law-Rechtsordnungen wiederfindet. Nach dem Fairnessparadigma ist die Gewährleistung eines fairen Verfahrens für die Gerechtigkeit konstitutiv – Gerechtigkeit wird, wenn überhaupt, im demokratisch dialogischen Verfahren hergestellt. Rawls beschränkte sich aber nicht auf ein funktionalistisches Verfahrensprinzip (s. o. „Legitimation durch Verfahren“), vielmehr betrifft Verfahrensgerechtigkeit im Wesentlichen den Grundsatz der „Waffengleichheit“ im Verfahren. Dies kann man z. B. im Strafprozess von den Verteidigungsrechten des Beschuldigten bzw. Angeklagten bis hin zu den gesetzlichen Beweisverwertungsverboten verfolgen. Die bekannteste Maxime der Verfahrensgerechtigkeit ist das audiatur et altera pars, d.h. der Grundsatz, in einem Verfahren beide Seiten zu hören (verfassungsrechtlich geregelt als Recht auf rechtliches Gehör, Art. 103 Abs. 1 GG). Weitere Grundsätze der Verfahrensgerechtigkeit sind vor allem im Strafrecht (vgl. IV-1.3 u. IV-5.1) zu finden, so z. B. das Bestimmtheitsgebot und das Rückwirkungsverbot im Strafrecht bzw. das Verbot der rückwirkenden Bestrafung (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) oder auch das Verbot der doppelten Bestrafung für ein und dieselbe Tat (ne bis in idem), Art. 103 Abs. 2 u. 3 GG.
Strafgerechtigkeit
Die Strafgerechtigkeit betrifft eine vielleicht auch eine nicht juristische Öffentlichkeit in besonderer Weise interessierende und zugleich besonders kontrovers verhandelte Perspektive von Gerechtigkeit. Debatten wie etwa die um die Angemessenheit der Sanktionen im Jugendstrafrecht oder um die Strafverschärfung für Sexualstraftaten (s. o.) belegen dies. Ihre Schärfe gewinnen sie dadurch, dass offensichtlich gerade hier Werturteile aufeinanderprallen, die deshalb vergleichsweise weit auseinanderliegen, weil die sozialen Grundannahmen, aus denen sie sich herleiten, entsprechend stark differieren. Diese betreffen im Wesentlichen den Zweck der Strafe, der in der Vergeltung begangenen Unrechts oder in dem Gedanken der Resozialisierung und der Erziehung des Täters liegen oder der auf die abschreckende Wirkung von Strafen abzielen kann (vgl. hierzu im Einzelnen unter IV-2.3). Die Annahme von Strafgerechtigkeit hängt daher zum einen davon ab, welcher der genannten Strafzwecke über eine aktuell ausgeprägte soziale Plausibilität verfügt und zum anderen davon, inwieweit dann der konkrete Strafausspruch diesem Strafzweck in angemessener Weise Geltung verschafft. Seit Mitte der 1980er Jahre hat das mit Restorative Justice („Wiederherstellende Gerechtigkeit“) bezeichnete Gerechtigkeits- und Fairnesskonzept, nach dem das aus der Begehung von Unrecht erfahrene Leid so weit wie möglich ausgeglichen werden soll (Wiedergutmachung), die traditionelle Strafzwecklehre (Vergeltung vs. Resozialisierung) herausgefordert, ohne diese allerdings in der Praxis überwinden zu können (hierzu Trenczek 2014; s. IV-4.1).
Die permanenten Relativierungen, denen jeder einzelne der hier behandelten Gerechtigkeitsaspekte unterworfen werden musste, mögen für den einen eine Bestätigung einer bereits vorhandenen Aversion, für den anderen eine Enttäuschung sein. Notwendig wurden sie jedes Mal, weil es sich bei der Gerechtigkeit um eine Kategorie handelt, deren Wesensgehalt zwar eine starke ethisch rückgebundene Zentrierung um Gleichheits- und Gleichbehandlungsfragen ausmacht, deren jeweilige konkrete inhaltliche Bestimmung jedoch je nach interessengeleitet-wertendem Blickwinkel ausfällt. Wer also an eine „absolute“ Gerechtigkeit glauben will und sie definiert haben möchte, der muss auf die naturrechtlich geprägte Annahme universeller Normen, deren Geltung sich unabhängig von menschlicher Einflussnahme auf sie vorstellen ließe, verwiesen werden (vgl. 1.1.2). In der Realität des Rechts hingegen – der gelebten wie der normativen – muss „absolute“ Gerechtigkeit ein Widerspruch in sich bleiben. Denn zwischen Gerechtigkeit und positivem Recht besteht ein permanentes potenzielles Spannungsverhältnis. In ihm ist – außer in den nach Radbruch besonders zu beurteilenden Fällen, wo Recht in einem unerträglichen Gegensatz zur Gerechtigkeit steht oder aber den Kern der Gerechtigkeit, die Gleichheit, bewusst verleugnet (1.1.2) – der Geltung des positiven Rechts, der Rechtssicherheit also, Vorrang einzuräumen (Radbruch 1932, 73 ff.). In einem modernen Verfassungsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland wird dieses Spannungsverhältnis zwar zunächst auf den verschiedensten Ebenen demokratischer Diskurse und judikativer Interpretationen prinzipiell bearbeitet werden können (vgl. auch Dreier 1991, 37); dennoch wird man von Richtern, übrigens ebenso wie von Sozialarbeitern, die für eine Behörde tätig sind, erwarten müssen, dass sie auch dann, wenn sie normative Vorgaben subjektiv als ungerecht empfinden, in ihrem Handeln dem Gesetz folgen. Zu einem fatalistischen Schluss führt dies gleichwohl nicht. Denn einerseits müssen gerade auch Sozialarbeiter immer wieder den Realitätsbezug ihrer jeweiligen Hoffnung auf Gerechtigkeit des Recht an dessen normativen Möglichkeiten überprüfen: Allen zu gefallen ist auch dem Recht unmöglich, für alle zu gelten freilich erwarten wir von ihm. Andererseits wird aber gerade auch von Menschen in sozialen Berufen erwartet, dass sie in und mit ihrem jeweiligen professionellen Handeln Einfluss auf die normativen Inhalte von Gerechtigkeit nehmen, die gesellschaftlichen Diskurse hierzu beeinflussen und vorantreiben und im Einzelfall den Klienten dabei unterstützen, sich selbst und des Rechts zu ermächtigen (Empowerment).

Rawls 2003; Ritsert 1997; Sen 2010; Dreier 1991

1. Welche Bedeutung hat der Staat für das Recht und was versteht man unter dem Begriff Rechtsstaat? (1.1.1, vgl. auch 2.1.2)
2. Wie bestimmt sich das Verhältnis von Recht und Moral? (1.1.1)
3. Was sind die Kennzeichen einer Rechtsnorm und welche Typen von Rechtsnormen gibt es in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland? (1.1.3)
4. Was unterscheidet eine kommunale Satzung von der Satzung eines Vereins? (I-1.1.3.4 und II-1.1)
5. Weshalb ist die Unterscheidung von Privatrecht und Öffentlichem Recht bei der Beantwortung von Rechtsfragen im Einzelfall wichtig? (1.1.4)
6. Welche EU-Regelungen haben unmittelbare rechtliche Wirkungen für das Alltagsleben der Bürger? (1.1.5)
7. Inwieweit kann man von einem Europäischen Sozialrecht sprechen? (1.1.5)
8. Aufgrund welchen völkerrechtlichen Abkommens sind die Jugendämter in Deutschland verpflichtet, ausländischen Minderjährigen Schutz zu gewähren, und was versteht man insoweit unter Schutz? (1.1.5.2)
9. Was versteht man unter dem Begriff Einzelfallgerechtigkeit? (1.2.4)
10. Was versteht man unter dem Begriff Legitimation durch Verfahren, und welche Bedeutung hat dies für die Soziale Arbeit? (1.2.2)
2 Verfassungsrechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit (Behlert / Trenczek)
I-2.1 Die Bundesrepublik als demokratischer und sozialer Rechtsstaat
2.1.1 Demokratie
2.1.2 Rechtsstaatsprinzip
2.1.2.1 Bindung an Recht und Gesetz
2.1.2.2 Verhältnismäßigkeit
2.1.2.3 Rechtsschutzgarantie und Justizgewährungsanspruch
2.1.2.4 Gleichheitsgebot und Willkürverbot
2.1.3 Sozialstaatsprinzip
2.2 Grundrechte
2.2.1 Geschichtliches – begriffliche Einordnung
2.2.2 Überblick
2.2.3 Funktion der Grundrechte
2.2.4 Geltung von Grundrechten
2.2.5 Schutz der Menschenwürde und der Freiheit der Person
2.2.6 Grundrechte aus Art. 6 GG: Ehe und Familie
Gerade im Hinblick auf Menschen, die Hilfe bedürfen und in Gefahr stehen, von öffentlicher oder professioneller Unterstützung abhängig zu werden, empfiehlt es sich, die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Bundesrepublik und das dahinter stehende Menschenbild genauer anzusehen:
„Der Einzelne ist zwar der öffentlichen Gewalt unterworfen, aber nicht als Untertan, sondern als Bürger … Dies muss besonders dann gelten, wenn es um seine Daseinsmöglichkeit geht. … Die unantastbare, von der staatlichen Gewalt zu schützende Würde des Menschen (Art. 1) verbietet es, ihn lediglich als Gegenstand staatlichen Handlungsbedarfs zu betrachten, [insbesondere] soweit es sich um die Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs, also seines Daseins überhaupt handelt. Das folgt aus dem Grundrecht der freien Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG). Auch der Gemeinschaftsgedanke, der in den Grundsätzen des sozialen Rechtsstaats (Art. 20 und 28 GG) und der Sozialgebundenheit des Eigentums (Art. 14 GG) Ausdruck gefunden hat, erschöpft sich nicht in der Gewährung von materiellen Leistungen, sondern verlangt, dass die Teilnehmer der Gemeinschaft als Träger eigener Rechte anerkannt werden, die grds. einander mit gleichen Rechten gegenüberstehen (Art. 3 GG), und dass nicht ein wesentlicher Teil des Volkes in dieser Gemeinschaft hinsichtlich seiner Existenz ohne Rechte dasteht“ (BVerwGE 1, 159 ff.).
Übersicht 6: Verfassungsrechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit

2.1 Die Bundesrepublik als demokratischer und sozialer Rechtsstaat
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat (Art. 20 Abs. 1 GG). Das Grundgesetz, die Verfassung (vgl. 1.1.3.1) und rechtliche Grundordnung des deutschen Staates bestimmt in Art. 20 GG – und zwar mit Anspruch auf Unveränderlichkeit (Art. 79 Abs. 3 GG) – Rechtsstaat, Demokratie, Sozialstaat als wichtigste, ineinandergreifende Verfassungsgrundsätze (zum Föderalismusprinzip, der Gliederung des Bundes in Länder, vgl. 4.1.2).
Gewaltenteilung
Kennzeichen und gleichermaßen Voraussetzung für den demokratischen Rechtsstaat ist die von dem französischen Philosophen Montesquieu (1689 –1755) ausgeformte Lehre von der Dreiteilung der staatlichen Gewalten. Danach wird die Exekutive (Regierung und Verwaltung) abgegrenzt von der Legislative (Gesetzgebung, i. d. R. das Parlament) und der Judikative (Rechtsprechung (s. Übersicht 7). Grob gesagt, stellt die Legislative die Normen auf, die Exekutive (insb. die Verwaltung) wendet sie an und die Rechtsprechung kontrolliert die Einhaltung der Gesetze. Auf dieses („horizontale“) Gewaltenteilungsprinzip nimmt die Verfassung der Bundesrepublik ausdrücklich Bezug in Art. 20 Abs. 3 GG: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Allerdings ist das Gewaltenteilungsprinzip heute nicht mehr in reiner Form angewendet. So wird die Regierung als Teil der Exekutive mittlerweile nicht mehr von einem „absoluten Herrscher“ eingesetzt, sondern vom Parlament gewählt, dessen Regierungsfraktionen die Regierung weniger kontrollieren denn stützen. Die Tätigkeit der Exekutive erschöpft sich auch nicht in der reinen Anwendung von Normen, vielmehr haben die Regierung und die sog. Selbstverwaltungsträger auch einen politischen Gestaltungsauftrag, während die übrige Verwaltung eher ausführend tätig ist. Zudem nehmen Exekutiv- und Verwaltungsbehörden auch Aufgaben wahr, die streng inhaltlich zur Gesetzgebung (Erlass von Verordnungen und Satzungen) oder Rechtsprechung (Bußgeldbescheide) gehören, andererseits werden auch die Gesetzgebung (z.B. bei Erlass eines Haushaltsplanes) und die Rechtsprechung (Register, Grundbuch) verwaltend tätig.
Übersicht 7: Staat und Gewaltenteilung

Verfassungsorgane
Ein Ausfluss der Gewaltenteilung ist die Zuweisung grundlegender Staatsaufgaben an die sog. Verfassungsorgane, also die Institutionen, die im GG ausdrücklich mit Rechten und Pflichten ausgestattet sind. Das sind auf Bundesebene:
■ der Bundestag (Art. 38 – 48 GG)
■ der Bundesrat (Art. 50 –53 GG)
■ der Gemeinsame Ausschuss (Art. 53a GG)
■ die Bundesversammlung (Art. 54 GG)
■ der Bundespräsident (Art. 54 –61 GG)
■ die Bundesregierung (Art. 62 –69 GG)
■ das Bundesverfassungsgericht (Art. 93, 94 GG)
Der Bundeskanzler ist zwar im GG erwähnt, er ist aber als Teil der Bundesregierung kein eigenständiges Verfassungsorgan. Besteht zwischen den einzelnen Organen eine divergierende Auffassung über den Umfang ihrer Rechte und Pflichten oder ihrer Mitglieder, kann das BVerfG im sog. Organstreitverfahren (Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, §§ 63 ff. BVerfGG) angerufen werden. Im Hinblick auf die wechselseitige Kontrolle („Checks and Balances“) und Verflechtungen der Verfassungsorgane spricht man auch von Gewaltenverschränkung, während die durch das Föderalismusprinzip (s. 4.1.2) geprägte Gliederung und wechselseitige Kontrolle von Bund, Ländern und Gemeinden (mittlerweile auch unter Einschluss der EU-Ebene) als „vertikale“ Gewaltenteilung bezeichnet wird.

Es lassen sich jedoch noch andere, grundlegendere Entwicklungen des Gewaltenteilungsprinzips beobachten. Denn insb. dort, wo (wie in der Bundesrepublik Deutschland) Regierungen im Amt sind, die die parlamentarische Mehrheit hinter sich wissen, gestaltet sich das Wechselspiel zwischen Parlament und Regierung – zumal unter den Bedingungen des aus Art. 21 GG abgeleiteten sog. Fraktionszwangs – mitunter nicht sehr effektiv. Parlamentarische Kontrolle reduziert sich dann häufig auf Minderheitenrechte der parlamentarischen Opposition (z. B. Untersuchungsausschuss, Art. 44 GG; Große und Kleine Anfragen, §§ 100 ff. GO BT; Befragungen der Bundesregierung, § 106 GO BT). Die wirksamste Kontrolle von Regierung und Parlament geht daher heute vom BVerfG aus (hierzu 5.1.1), was zwar unter demokratietheoretischen Aspekten nicht unumstritten ist, sich im Ergebnis allerdings in aller Regel als segensreich für die politische und rechtliche Gestaltung des Gemeinwesens erwiesen hat.
2.1.1 Demokratie
Der Begriff Demokratie kommt aus dem Griechischen (demos – Volk; kratein – herrschen) und bedeutet „Volksherrschaft“. Der Begriff ist allerdings nicht unproblematisch und wird gerade von sog. populistischen Bewegungen recht schlicht und bizarr ausgelegt. In einer Demokratie hat sich nicht alles der Mehrheit zu beugen (s. u.), denn diese ist zu „monströsen Irrtümern“ fähig. „Eine Demokratie funktioniert nicht ohne Presse- und Versammlungsfreiheit, nicht ohne Oppositionsrechte, nicht ohne den Schutz der Schwachen“ (Janisch 2016a, 4).
Nach Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Damit ist nicht gemeint, dass zwingend alle hoheitlichen Entscheidungen durch die Bürger unmittelbar getroffen werden müssen, sondern dass sie einer gesetzlichen Legitimation bedürfen, die sich auf einen Willensakt des Volkes zurückführen lässt. Konkretisiert ist das Demokratiegebot durch das Gebot allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen (Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG). Man unterscheidet zwischen „unmittelbarer“ Demokratie, in der das Volk in Abstimmungen direkt selbst über eine Frage entscheidet, und der sog. repräsentativen Demokratie, bei der das Volk „abgeordnete“ Volks-Vertreter wählt, die als ihre Repräsentanten in den Parlamenten, den Volksvertretungen, die wesentlichen (gesetzlichen) Entscheidungen treffen. Dem Grundgesetz liegt ein ganz überwiegend repräsentatives Demokratiemodell zugrunde (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG), in welchem nur rudimentär Elemente der unmittelbaren Demokratie vorkommen, die allerdings in den letzten Jahren wieder verstärkt aktiviert werden (z. B. die beiden erfolgreichen Bürgerentscheide im Juli 2010, in Bayern für ein umfassendes Rauchverbot in öffentlichen Räumen und in Hamburg gegen die von der Bürgerschaft beschlossene Einführung der 6-jährigen Primarschule).
Eine besondere Beachtung finden im Grundgesetz auch die Parteien (Art. 21 GG), die als Vermittler der politischen Willensbildung einen besonderen Auftrag haben. Die Parteiendemokratie geht faktisch zulasten unmittelbarer Demokratieelemente. Dennoch ist, wie auch durch den Ausgang verschiedener Volks- bzw. Bürgerentscheide in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen europäischen Ländern belegt werden kann, allein von der Form unmittelbarer Demokratie nicht notwendigerweise auf eine größere demokratische Substanz der getroffenen Entscheidung zu schließen. Denn auch der unmittelbar entäußerte Volkswille kann, „fiktiv, fehlbar und verführbar“ sein (Offe 1992, 127).