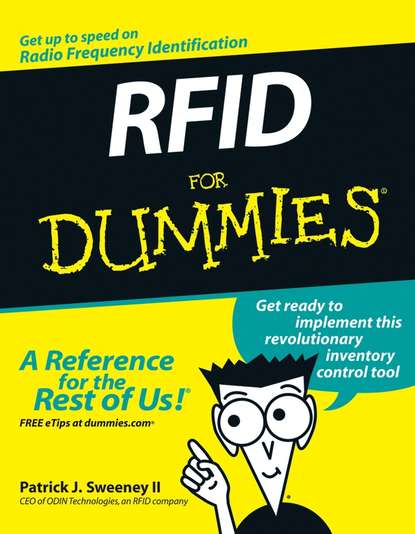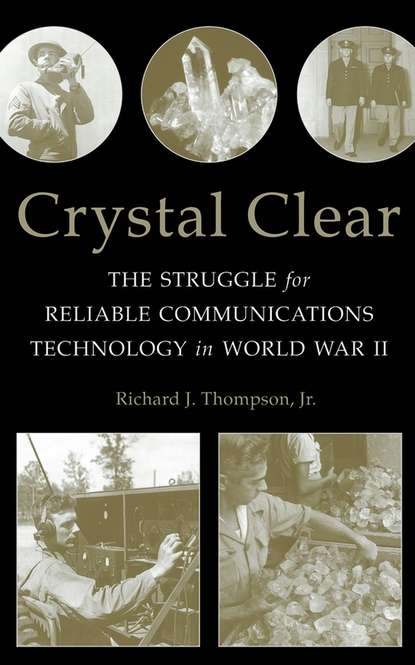- -
- 100%
- +
Minderheitenschutz

Demokratie ist demnach etwas anderes als ein schlichtes Mehrheitsprinzip. Sie basiert auf der Anerkennung des einzelnen Bürgers als Träger universeller Grundund Menschenrechte (zur UN-Menschenrechtserklärung von 1948 und der EMRK s. 1.1.5). Soweit der Demokratiegedanke mit der Organisation von Mehrheiten und Mehrheitsentscheidungen verknüpft wird, muss beachtet werden, dass das Betätigungsrecht der Opposition gewährleistet ist und der Schutz von Minderheiten gewahrt bleibt (keine Diktatur der Mehrheit). Insoweit ergibt sich aus dem Demokratieprinzip ein besonderer Handlungsauftrag für die Soziale Arbeit, da sie es vielfach mit Menschen zu tun hat, die – aus welchen Gründen auch immer – einer benachteiligten Bevölkerungsgruppe oder Minderheit angehören (z. B. Kinder und Jugendliche, alte, behinderte, einkommensarme Menschen, Migranten und ausländische Bevölkerungsgruppen in prekären sozialen und aufenthaltsrechtlichen Situationen). Hierbei geraten Sozialarbeiter u. U. in ein Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen: Auf der einen Seite steht der Auftrag des betroffenen Klienten, auf der anderen Seite stehen die Erwartungen des öffentlichen Arbeitgebers, dem sie arbeitsrechtlich und gesetzlich verpflichtet sind. Man spricht hier insofern von einem doppelten Mandat. Das Demokratiegebot verpflichtet die Mitarbeiter öffentlicher Träger, die demokratisch legitimierten Entscheidungen des Gesetzgebers vorbehaltslos (wenn auch nicht blind bzw. kritiklos) zu befolgen. Die sich aus dem doppelten Mandat mitunter ergebenden Konflikte sind nicht immer leicht aufzulösen, sie fordern aber zur demokratischen Teilnahme und damit zur rechtlich-politischen Einwirkung auf die Sozialverhältnisse auf. Die Soziale Arbeit hat einen politischen Gestaltungsauftrag insb. im Hinblick auf die Sicherung eines menschenwürdigen Daseins und die Abwendung bzw. den Ausgleich von Benachteiligungen und Belastungen (vgl. z. B. § 1 SGB I, § 1 Abs. 3 SGB VIII).Auch deshalb muss sich Soziale Arbeit im Interesse ihrer Klienten einmischen und in den öffentlichen Diskurs einbringen.
2.1.2 Rechtsstaatsprinzip
staatliches Gewaltmonopol
In einem Rechtsstaat bildet das Recht die verbindliche Ordnung für das Zusammenleben der Menschen. Die Wortbildung selbst steht mit spezifischen deutschen Entwicklungen des 18. und 19. Jahrhunderts im Zusammenhang. Deshalb führt eine lineare Übersetzung des Wortes in andere Sprachen auch zu keinem sinnvollen Ergebnis. Es besteht aber heute weitgehend Einigkeit darüber, dass im Deutschen mit „Rechtsstaat“ das gemeint ist, was im angloamerikanischen Rechtsraum als „Rule of Law“ bezeichnet wird. In England finden sich auch mit der Magna Carta Libertatum (1215), vor allem aber mit der Bill of Rights (1689), die geschichtlichen Ursprünge des Rechtsstaats. Die theoretische Konzeption geht letztlich auf die Rechtsphilosophie Immanuel Kants zurück und basiert auf dem von ihm grundlegend beschriebenen Verhältnis des einzelnen Bürgers zum Staat, der Notwendigkeit des Schutzes des Bürgers vor der Übermacht des Staates und des Schutzes durch den Staat im Hinblick auf die Machtungleichgewichte in der Gesellschaft. Der Rechtsstaat war bei Kant konstitutiv für die bürgerliche Freiheit (vgl. 1.1.1). Der Gegensatz ist der Polizeistaat, in dem der Einzelne Objekt der staatlichen Gewalt ist. Andererseits lässt sich das Axiom des staatlichen Gewaltmonopols auf Thomas Hobbes zurückführen. In einem Rechtsstaat ist grds. nur der Staat Hoheitsträger und darf Zwang zur Durchsetzung der Verhaltensregeln anwenden (sog. staatliches Gewaltmonopol).
Die wesentlichen Funktionen des Rechtsstaats gehen aus heutiger Perspektive über die Gewährleistung der persönlichen Freiheit hinaus und liegen in der Strukturierung des Gemeinwesens und seiner wesentlichen öffentlichen Institutionen (Ordnungsfunktion), in dem Grenzziehungsauftrag zum Schutz der Bürger (Herrschaftskontrolle, insb. Schutz der „Schwächeren“, z. B. Minderheiten und Benachteiligten, vor den Mächtigeren) sowie – im Zusammenspiel mit dem Sozialstaatsprinzip – dem Auftrag zur Chancenermöglichung (Emanzipation und Aktivierung) zur Gewährung gesellschaftlicher Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn sich die Idee des Rechts an der Gerechtigkeit orientiert, kann dieses Ziel immer nur ansatzweise erreicht werden, da im Widerstreit gesellschaftlicher und privater Interessen optimal nur ein fairer Interessenausgleich geleistet werden kann (hierzu 1.2).
Allerdings wird der Rechtsstaat immer wieder bedroht, insbes. auch nicht selten durch politischen Extremismus und Terror. Möglicherweise nicht so offensichtlich sind aber die Bedrohungen der Rechtsstaatlichkeit durch Initiativen, die sich zu seiner Verteidigung berufen fühlen. Gerade aus Anlass von Terrorakten und schwersten Straftaten ertönt immer wieder in einem simplen „politischen Reiz-Reaktion-Mechanismus“ der Ruf nach schärferen (Straf-)Gesetzen und Ermittlungsmaßnahmen (s. IV-1.3), wird die Einschränkung von Bürgerfreiheiten (z. B. Datenschutz, s. III-1.2.3) zugunsten einer vermeintlich erhöhten Sicherheit gefordert. „Der Rechtsstaat wird es auf Dauer sicher nicht ohne Schaden überstehen, wenn er unablässig und fälschlich zum Hindernis bei der Bekämpfung des Terrors erklärt wird“ (Janisch 2016b, 4). Umgekehrt erweist sich der Rechtsstaat gerade im Umgang mit seinen Anfeindungen.
2.1.2.1 Bindung an Recht und Gesetz
Art. 20 Abs. 3 GG
Wesentlich für einen Rechtsstaat ist, dass die Macht des Staates nicht grenzenlos, sondern rechtlich gebunden und demokratisch legitimiert ist. Dies gilt insb. im Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern, deren vom Staat anerkannte (nicht verliehene) Menschen- und Grundrechte die individuellen und sozialen Freiheitssphären umschreiben (Art. 1 –19 GG), in die der Staat nur unter gesetzlich bestimmten Voraussetzungen eingreifen darf. Der Bürger ist nicht Untertan, sondern er verfügt über verfassungsrechtlich anerkannte Rechte und Pflichten. Greift die Exekutive in die Rechtsstellung des Bürgers ein, so muss er die Möglichkeit haben, die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen von unabhängigen Gerichten überprüfen zu lassen. Kernelement des Rechtsstaats ist also die Bindung der „hoheitlichen“ Gewalt (insb. auch der Sozialverwaltung) an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) und die Garantie des gerichtlichen Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4, Art. 103 f. GG).
Vorrang des Gesetzes
Aus dem Grundsatz, dass alles staatliche Handeln an Recht und Gesetz gebunden ist (Gesetzmäßigkeit), lassen sich zwei wesentliche Regeln ableiten, die insb. für die (Sozial-)Verwaltung von Bedeutung sind: Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes. Aus dem Vorrang des Gesetzes ergibt sich, dass jede Verwaltungsmaßnahme mit den geltenden Rechtsnormen im Einklang stehen muss, also nicht gegen gültige Rechtssätze verstoßen darf. Deshalb muss die Verwaltung, müssen die Sozialarbeiter das Grundgesetz, insb. die darin enthaltenen Grundrechte, sowie die Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen kennen und dürfen gegen diese Rechtsnormen nicht verstoßen. Ein vom Gesetz abweichendes Handeln ist rechtswidrig. Die fachlichen Standards der Sozialen Arbeit bestimmen sich ganz wesentlich durch rechtliche Regelungen.

Im Rahmen einer Inobhutnahme hat das JA die Eltern „unverzüglich“ zu unterrichten und mit ihnen gemeinsam das Gefährdungsrisiko abzuschätzen (§ 42 Abs. 3 S. 1 SGB VIII; im Einzelnen III-3.4.1.1). Überredet ein Sozialarbeiter einen 16-jährigen Jugendlichen, der über seine autoritären Eltern klagt, ohne Abklärung mit den Eltern zu einem Umzug in eine Wohngemeinschaft, verstößt dies gegen Art. 6 GG, §§ 1631 ff. BGB sowie §§ 1 Abs. 2, 8a Abs. 1, 9 Ziff.1, 27 ff. bzw. 42 SGB VIII.
Privatautonomie
Soweit keine Rechtsnormen vorliegen, besteht für alle Bürger Handlungsfreiheit. Sie dürfen tun und lassen, was sie wollen, solange sie nicht gegen Rechtsnormen verstoßen. Im Rechtsverkehr der Bürger spricht man insoweit von Privatautonomie, im Hinblick auf Verträge gilt die Vertragsfreiheit (§ 311 BGB, hierzu II-1), d. h. solange die gesetzlichen Regelungen eingehalten werden (z. B. keine rechtswidrigen und sittenwidrige Geschäfte, §§ 134, 138, 242 BGB; Einhaltung von Formvorschriften, §§ 126 ff. BGB; Schutz vor unangemessener Benachteiligung oder mehrdeutigen und überraschenden Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, §§ 305 ff. BGB; Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften, § 312 BGB; zu den Vorschriften zum Verbraucherschutz vgl. II-1.3.1), können die Vertragsparteien ihre Verträge frei gestalten.
Vorbehalt des Gesetzes
Die allgemeine Handlungsfreiheit im Rahmen der Gesetze besteht zwar für den Bürger, nicht aber für den Staat und andere öffentliche Träger. Der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes knüpft an das Demokratiegebot an und besagt, dass der Gesetzgeber alle wesentlichen Fragen, die den Bürger unmittelbar betreffen, selbst entscheiden muss und nicht der Verwaltung zur Entscheidung überlassen darf (BVerfG NJW 1976, 34; 1976, 1309; 1979, 359). Wesentliche Maßnahmen sind also nur rechtmäßig, wenn sie auf einer (ausreichenden) gesetzlichen Grundlage ergehen (Gesetz oder mit gesetzlicher Ermächtigung erlassene Rechtsnorm; nicht ausreichend ist hingegen eine Verwaltungsvorschrift) und die Grundrechte nur im zulässigen Umfang einschränken. Damit sollen einerseits Willkür und unkontrollierte Eigengesetzlichkeiten verhindert, andererseits die Berechenbarkeit der Verwaltung und die Gleichbehandlung der Bürger verbessert werden. Wesentliche Maßnahmen in diesem Sinne sind:
a) Eingriffe in die Rechts- und Freiheitssphäre einer natürlichen oder juristischen Person, d. h. Maßnahmen, die zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen verpflichten bzw. ein Recht entziehen oder einschränken. Dies betrifft also nicht nur kontrollierende Maßnahmen der Polizei, sondern alle in die Rechtsstellung der Bürger eingreifenden Maßnahmen öffentlicher Verwaltungsträger (z. B. auch Inobhutnahme oder Gebührenerhebung durch das JA; zum Kopftuchverbot ohne gesetzliche Grundlage s. BVerfG 2 BvR 1436 / 02 v. 24.09.2003). So ist z. B. auch jede Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten und ihre Mitteilung an Dritte ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (vgl. das sog. Volkszählungsurteil des BVerfG v. 15.12.1983 – E 65, 1; hierzu III-1.2.3). Auch innerhalb sog. Sonderrechtsverhältnisse (z. B. Strafvollzug, geschlossene Unterbringung) bedürfen weitere, über das Grundverhältnis hinausreichende Beschränkungen der Grundrechte (z. B. Briefzensur, beschränkte Nutzung von Medien) einer gesetzlichen Grundlage (BVerfGE 33, 1 ff. = NJW 1972, 811; BVerfG 2 BvR 1673 / 04 – 31.05.2006 – ZJJ 2006, 193 ff. zum Jugendstrafvollzug). Ein Eingriff liegt immer dann vor, wenn grundrechtlich geschützte Rechtspositionen nicht unerheblich beschränkt werden (vgl. z. B. im Hinblick auf Art. 6 Abs. 2 GG die Einführung der Sexualerziehung in der Schule, BVerwG NJW 1975, 1181).

Die Polizei darf Wohnungen, z. B. das Wohnheim eines freien Trägers, nur dann betreten und durchsuchen, wenn und soweit ihr dies durch Art. 13 GG und die einschlägigen Vorschriften der Polizeigesetze der Länder gestattet ist (grds. nur auf Anordnung des Amtsrichters, nur zur Abwendung einer gemeinen Gefahr, einer Lebensgefahr für einzelne Personen oder zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; vgl. z. B § 25 ThürPAG). Die dauerhafte Rundumüberwachung eines aus der Sicherungsverwahrung entlassenen Mannes durch die Polizei ist aufgrund der polizeilichen Generalklausel nur für eine kurze Zeit, ohne eine spezifische gesetzliche Grundlage aber nicht dauerhaft lässig (BVerfG 1 BvR 22 / 12 – 8.11.2012).
b) Auch Leistungsentscheidungen, mit denen der Staat (oder andere Hoheitsträger) in die Handlungs- und Gestaltungsfreiheit der Bürger interveniert (z. B. Subventionen, Förderung von freien Trägern) sind wesentlich und bedürfen der gesetzlichen Regelung. Für die Begründung oder Feststellung von Rechten reicht es allerdings nach der Rechtsprechung aus, dass in einem Haushaltsgesetz oder in einer Haushaltssatzung zweckgebundene Mittel bereitgestellt werden (z. B. im Hinblick auf Subventionen BVerwG NJW 1979, 2059 f.).

Sind im Haushaltsplan eines Kreises für die Bezuschussung von Altentagesstätten (§ 71 SGB XII) 50.000 € vorgesehen, ist die Verwaltung berechtigt und verpflichtet, diese Mittel nach pflichtgemäßem Ermessen auf die verschiedenen Antragsteller zu verteilen.
§ 31 SGB I
c) Im Hinblick auf die Sozialverwaltung hat der Gesetzgeber alle Entscheidungen über Sozialleistungen einem besonderen Gesetzesvorbehalt unterworfen. Nach § 31 SGB I ist die Begründung, Feststellung, Änderung oder Aufhebung von Rechten und Pflichten nach dem SGB nur zulässig, soweit ein Gesetz sie vorschreibt oder zulässt. Dieser sozialrechtliche Gesetzesvorbehalt geht über die allgemeinen Grundsätze hinaus. Die öffentlichen Träger z. B. der Jugend- und Sozialhilfe dürfen aufgrund des sozialrechtlichen Gesetzesvorbehalts Sozialleistungen nur bewilligen und durchführen, wenn sich dies aus dem SGB ergibt, wenn also die fachliche Prüfung ergeben hat, dass die gesetzlichen Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind (zur sog. Steuerungsverantwortung s. III-3.3.4.4).

Im Rahmen des Jugendgerichtsverfahrens muss das JA frühzeitig prüfen, ob und ggf. welche Jugendhilfeleistungen für einen Jugendlichen oder sog. Heranwachsenden geeignet und erforderlich sind (§ 52 SGB VIII). Leistungen der Jugendhilfe sind zu erbringen, sofern die formellen und materiellen Leistungsvoraussetzungen nach dem SGB VIII (nicht JGG!) vorliegen. Das JA muss diese Prüfung vornehmen und kann nicht vom Jugendrichter zur Durchführung einer Betreuung oder anderen Maßnahmen angewiesen werden.
2.1.2.2 Verhältnismäßigkeit
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet und hat Verfassungsrang (vgl. BVerfGE 19, 348; 65, 54; 70, 286; 76, 50; 77, 334; 104, 347), und zwar auch im Hinblick auf die EU-Grundrechtecharta, wie der EuGH zuletzt in seiner geradezu historischen Entscheidung zum Sozialdatenschutz unter besonderer Hervorhebung des Verhältnismäßigkeitsgebots deutlich gemacht hat (EuGH C-293 / 12 u. C-594 / 12 – 08.04.2014; s. a. I-5 u. III-1.2.3). Er ist geradezu das vornehmste Prinzip der Rechtsanwendung in einer rechtsstaatlich organisierten Gesellschaft und bei allen Entscheidungen, Handlungen etc. der öffentlichen Hand (Staat, Kommune, öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungsträger) immer (in jeder logischen Sekunde) zu berücksichtigen. Besondere Bedeutung kommt ihm bei Eingriffen in die Freiheitssphäre der Betroffenen (zum Strafrecht vgl. IV-1.2) und bei Ermessensentscheidungen zu (vgl. 3.4.2). Auch (scheinbar) vom Wortlaut eines Gesetzes gedeckte Maßnahmen und (Ermessens-) Entscheidungen sind rechtswidrig, wenn sie gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen. Bei jeder „hoheitlichen“ Entscheidung und Maßnahme ist zu prüfen, ob diese geeignet, erforderlich und angemessen ist.
Geeignetheit
■ Geeignetheit: Maßnahmen und Leistungen sind nur zulässig, wenn sie geeignet sind, den vom Gesetz angestrebten Zweck zu erreichen. Sofern der Gesetzgeber (anders als z. B. in § 1 SGB VIII) den Zweck nicht selbst ausdrücklich formuliert hat, werden über die Frage, was die richtige Entscheidung oder die geeignete Maßnahme ist, oft unterschiedliche Auffassungen bestehen, die vom fachlichen und politischen Vorverständnis der Beteiligten abhängen (z. B. Geeignetheit von freiheitsentziehenden Maßnahmen für die angestrebte Legalbewährung im Hinblick auf die extrem hohen Rückfallziffern nach Vollzug der Freiheitsstrafe, vgl. OLG Schleswig NStZ 1985, 475). Gleichwohl darf die Entscheidung nicht nur auf Meinungen basieren, rechtliche Entscheidungen dürfen nicht „am grünen Tisch“ losgelöst von den empirisch nachweisbaren Zusammenhängen der Lebenswelt getroffen werden. Im Rahmen der Entscheidungsfindung müssen vielmehr die „außerrechtlichen“ Wirklichkeiten anerkannt werden.
Erforderlichkeit
■ Erforderlichkeit: Kann ein bestimmtes Ziel durch verschiedene, allesamt geeignete Vorgehensweisen erreicht werden, so darf nur diejenige ausgewählt werden, die die Betroffenen und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt und zur Erreichung des Ziels unerlässlich ist. Die Intervention darf im Hinblick auf das gesetzliche Ziel weder überflüssig sein noch durch ein weniger einschneidendes, aber auch geeignetes Mittel erreicht werden können („So wenig wie möglich, so viel wie nötig“; zur sog. Subsidiarität staatlicher Interventionen s. a. 2.1.3). Bei der Auswahl der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten muss eine Verwaltung bewusst die Vor- und Nachteile der verschiedenen geeigneten Möglichkeiten abwägen und dann das am wenigsten einschneidende Mittel ergreifen.

Beispielsweise darf die Polizei nicht den sofortigen Abbruch einer Musikveranstaltung in einem Jugendheim verlangen, wenn es zur Vermeidung der Lärmbelästigung der Nachbarn ausreicht, die Fenster des Veranstaltungsraumes zu schließen. Sind in einer Heimeinrichtung im Hinblick auf die in ihr betreuten Kinder Mängel aufgetreten, so soll die Einrichtung zunächst beraten werden, wie die Mängel abgestellt werden können. Reicht das nicht aus, um die Mängel abzustellen, können und müssen zunächst (geeignete) Auflagen erteilt werden, bevor die Betriebserlaubnis widerrufen und das Heim geschlossen werden darf (vgl. § 45 Abs. 3 SGB VIII).
Angemessenheit
■ Angemessenheit: Der Nachteil, der durch eine geeignete und an sich erforderliche Intervention entsteht, darf nicht erkennbar in grobem Missverhältnis zu dem angestrebten und erreichbaren Erfolg stehen. Die Grenzen staatlicher Handlungen sind durch Abwägung der in Betracht kommenden Interessen der Betroffenen und des Gemeinwesens bzw. der öffentlichen Verwaltung zu ermitteln. Die öffentlichen Interessen müssen umso bedeutender und ihre Verwirklichung umso dringlicher sein, je stärker der Eingriff in eine geschützte Rechtsstellung wirkt.Ausdrücklich formuliert ist dieser Grundsatz z. B. in § 112 StPO: Danach darf die Untersuchungshaft trotz Vorliegen eines dringenden Tatverdachts und obwohl ein Haftgrund besteht nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht (zu den Grenzen der strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen s. IV-3.3.1).

Die Polizei darf zur Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten nicht von der Schusswaffe Gebrauch machen, auch wenn dies das einzige geeignete Mittel wäre, diese zu verhindern. Bei der Entscheidung über die geschlossene Unterbringung eines psychisch kranken Straftäters sind das Sicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit und der Freiheitsanspruch des Einzelnen gegeneinander abzuwägen. Hierbei ist es erforderlich, detailliert darzulegen, aufgrund welcher konkreten Tatsachen und mit welcher Wahrscheinlichkeit die Gefahr weiterer schwerer Straftaten besteht und aus welchen Gründen ambulante Hilfen außerhalb des Maßregelvollzuges nicht ausreichen (BVerfG NJW 1993, 778). Die geschlossene Unterbringung einer Person, die weder sich noch andere gefährdet, ist ungeachtet der scheinbar weitreichenden Rechtsgrundlage (§§ 1631b, 1906 BGB) unverhältnismäßig. Im Fall Gustl Mollath haben dies Gerichte und Ärzte missachtet. Das BVerfG (2 BvR 371 / 12 BvR – 26.08.2013) hat den Unterbringungsbeschluss des OLG Bamberg vom 26.08.2011 als unzureichend eingestuft, da das Gericht nicht ausreichend belegt und konkretisiert habe, warum von Mollath angeblich weiter die Gefahr künftiger rechtswidriger Taten ausgehe. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebiete es zudem, die Unterbringung nur solange zu vollstrecken, wie der Zweck der Maßregel dies unabweisbar erfordere und weniger belastende Maßnahmen nicht genügen. Im Hinblick auf die Vorratsdatenspeicherung hat der EuGH betont, dass die Speicherung von (Kommunikations-)Daten auf Vorrat nur auf das „absolut Notwendige“ sowie auf einen Personenkreis zu begrenzen ist, der in irgendeiner Weise in eine schwere Straftat verwickelt sein könnte (EuGH C-293 / 12 u. C-594 / 12 – 08.04.2014; EuGH C-203 / 15 u. C-698 / 15 – 21.12.2016; s. a. III-1.2.3).
So knapp und geradezu einfach das Verhältnismäßigkeitsgebot auf den drei Stufen ausformuliert ist, so schwer scheint es Behörden bzw. öffentlichen Trägern mitunter zu fallen, die Grenzen staatlicher Befugnisse an dieser Grenze auszurichten, wie zahlreiche Entscheidungen des BVerfG und der europäischen Gerichte (EGMR und EuGH) dokumentieren. Es geht also nicht nur darum, jeweils den bloßen Wortlaut eines Gesetzes umzusetzen bzw. einzuhalten, sondern den freiheitlich-bürgerfreundlichen Gehalt der (europäischen und grundgesetzlichen) Rechtsordnung zu erkennen und mit einer entsprechenden Haltung gegenüber dem Bürger umzusetzen. Dies ist insb. auch für die Soziale Arbeit im Hinblick auf das asymmetrische Verhältnis zu ihren Klienten von besonderer Bedeutung. Das Verhältnismäßigkeitsgebot wird mitunter auch als Übermaßverbot („Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“; „Die Kirche im Dorf lassen“) bezeichnet, wobei dieser Aspekt vor allem im Hinblick auf die zweite und dritte Ebene des Verhältnismäßigkeitsgebots, also die Erforderlichkeit (im engeren Sinne) und die Angemessenheit hoheitlicher Maßnahmen, relevant ist.
Im Rahmen der Gesetzgebung hat der Gesetzgeber einen weiten (politischen) Bewertungs- und Entscheidungsspielraum. Freilich müssen auch hier im Hinblick auf die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit, mithin die Auswirkungen neuer Regelungen, stets die zu dieser Zeit verfügbaren empirischen Fakten und fachlichen Beurteilungen berücksichtigt werden. Stellt sich die Bewertung empirisch als falsch heraus, muss die Regelung für die Zukunft unter Berücksichtigung eines Anpassungs- und Übergangszeitraums korrigiert werden (BVerfGE 25, 13, 17; 50, 335; 95, 314).
Während der abwehrende („negative“) Aspekt des Verhältnismäßigkeitsgebots zur Begrenzung von Eingriffen und zur Zurücknahme des staatlichen Kontrollzugriffs verpflichtet, beinhaltet seine positive Seite die Verpflichtung des Staates, den Einzelnen hilfreich zu unterstützen, wenn seine Ressourcen und Kompetenzen zur sozialadäquaten Lebensbewältigung nicht ausreichen. In dieser Ausprägung spricht man vom Verhältnismäßigkeitsgebot zumeist als Subsidiaritätsprinzip (hierzu 2.1.3).
2.1.2.3 Rechtsschutzgarantie und Justizgewährungsanspruch
Justizgewährleistungsanspruch/-pflicht
Nach Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG steht jedem der Rechtsweg zu einem Gericht offen, wenn er durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird. Ob das der Fall ist, haben dann letztlich die Gerichte zu prüfen (zur Rechtskontrolle vgl. ausführlich I-5). Damit verknüpft und aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet ist der sog. Justizgewährleistungsanspruch des Bürgers, zur umfassenden Wahrung seiner Rechte die staatlichen Gerichte in Anspruch nehmen zu können und von diesen eine Entscheidung in der Sache treffen zu lassen (vgl. Art. 6 Abs. 1 EMRK). Dem entspricht (insb. mit Blick auf das Rechtsprechungs- und Gewaltmonopol des Staates sowie das Selbsthilfeverbot für den Bürger) auf der anderen Seite die Pflicht des Staates, für alle Rechtsverletzungen und Rechtsstreitigkeiten den gerichtlichen Schutz zur Verfügung zu stellen (Justizgewährleistungspflicht).
2.1.2.4 Gleichheitsgebot und Willkürverbot
Nach Art. 3 Abs. 1 GG sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Das Gleichheitsgebot ist im Rechtsstaat nicht als Gebot sozialer Gleichheit ausformuliert, sondern nur als Gleichbehandlung nach dem Gesetz. Das Gleichheitsgebot des GG überwindet deshalb nicht das Spannungsverhältnis zwischen Recht und Gerechtigkeit (vgl. 1.2). Rechtspositivistisch gesehen verbietet das Recht – wie es der französische Literaturnobelpreisträger Anatole France (1844 – 1924) formuliert hat – in seiner „majestätischen Gleichheit Reichen wie Armen unter Brücken zu schlafen, auf Straßen zu betteln und Brot zu stehlen“ (France 1919, 112).