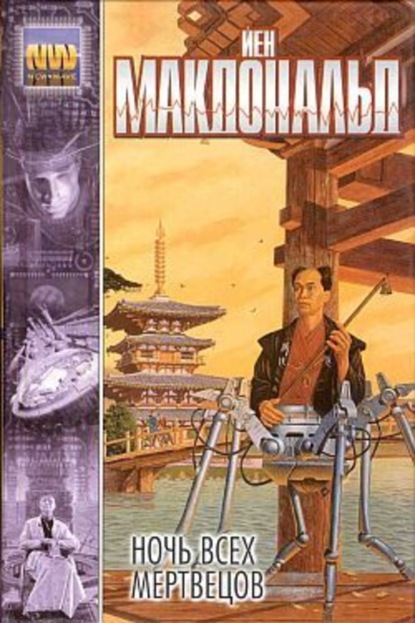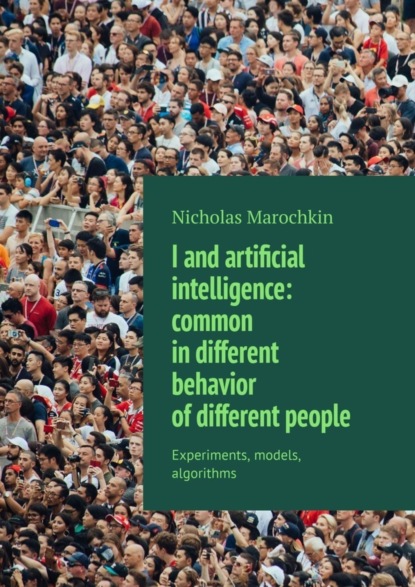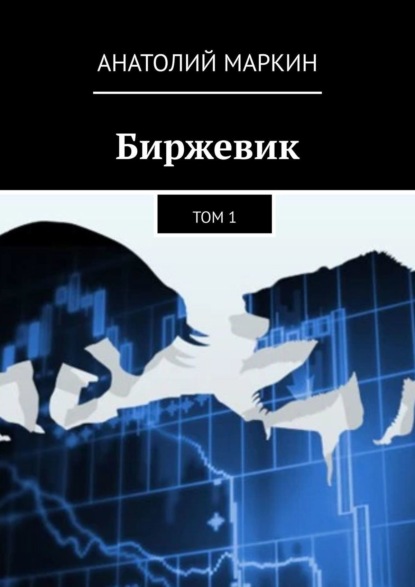- -
- 100%
- +
Aus Art. 3 Abs. 1 GG folgt nicht, dass alle Menschen gleich behandelt werden müssen. Der allgemeine Gleichheitssatz des Grundgesetzes (s. Übersicht 8) ist nur verletzt, wenn der Staat einen Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten ungleich (und damit ungerecht und unfair) behandelt, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (Verbot der Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte, vgl. BVerfGE 74, 9 ff.). Deshalb hat das Grundgesetz in Art. 3 Abs. 3 GG schon vorweg festgelegt, dass der Staat niemanden aufgrund des Geschlechts, seiner Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, seines Glaubens und seiner religiösen oder politischen Ansichten benachteiligen oder bevorzugen darf. Insoweit ist also eine unterschiedliche Behandlung durch staatliche Instanzen nicht gerechtfertigt.
Racial Profiling
Dies betrifft auch das sog. Racial Profiling (vgl. Cremer 2013, 11 f., 16 ff.). Hierbei handelt es sich um polizeiliche Personenkontrollen ohne Vorliegen eines Straftatverdachts, u. a. im Rahmen von §§ 22 Abs. 1a, 23 Abs. 3 BPolG, die nach äußerem Erscheinungsbild, insb. nach der Hautfarbe der Betroffenen, vorgenommen werden, damit aber gegen das Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen (OVG Rh-Pf 7 A 10532 / 12 – 29.10.2012).
Der Gleichheitsgrundsatz verbietet der Verwaltung jedes willkürliche Verhalten, d. h. nicht nur die nicht durch sachliche Unterschiede gerechtfertigte Ungleichbehandlung gleicher, sondern auch die nicht durch zulässige sachliche Gründe begründete Gleichbehandlung ungleicher Tatbestände. Grob ausgedrückt: Gleiches soll gleich, Ungleiches kann und soll unterschiedlich behandelt werden. Beispielsweise verstößt die finanzielle Förderung einer (juristischen) Person, die anders als andere Leistungsempfänger die aufgestellten, z. B. landesrechtlichen, Förderrichtlinien nicht erfüllt, gegen Art. 3 GG. Hierin liegt freilich gleichzeitig ein Verstoß gegen den Vorrang des Gesetzes. Ein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung im Rahmen von Ermessensentscheidungen ist gegeben, wenn z. B. aufgrund eines im Haushaltsplan vorgesehenen Budgettitels eine Reihe von Antragstellern Zuwendungen erhalten haben (z. B. für Altenerholung, Mitarbeiterschulung), der Betrag aber verbraucht ist und nun andere leer ausgehen.
Mit Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG ist allerdings ausdrücklich auch die Möglichkeit eröffnet, mittels sog. positiver Maßnahmen (zuweilen wird auch, semantisch sicher wenig überzeugend, von „positiver Diskriminierung“ gesprochen) bestehende Ungleichheiten zu beseitigen (z. B. Frauenquoten). In ähnlicher Weise verbietet Art 3. Abs. 3 S. 2 GG nicht nur die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung, sondern erlaubt i. V. m. § 1 BGG eine bevorzugte Berücksichtigung von Bewerbern mit Behinderung auf einen Arbeitsplatz bei gleicher Eignung.

Die unterschiedliche Förderung von Familien (z. B. im Hinblick auf die kostengünstigere Teilnahme an Familienfreizeiten nach § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) durch das städtische JA aufgrund der Anzahl der Kinder oder von allein oder gemeinsam erziehenden Eltern kann durchaus mit Art. 3 GG vereinbar sein. Wenn ein städtisches Jugendzentrum seine Räume unterschiedlichen Jugendgruppen für deren (Vereins-)Treffen und Aktivitäten zur Verfügung stellt, darf der Antrag einer Gruppe von rechtsradikalen Jugendlichen auf Überlassung von Räumen für eine „Pogo-Party in geschlossener Gesellschaft“ nicht allein mit Bezug auf ihre verquere politische Weltanschauung abgelehnt werden. Eine Ablehnung wäre aber im Hinblick auf Art. 3 GG zulässig, wenn bei den früheren Veranstaltungen der Gruppe – und anders als bei anderen Gruppen – besonders viel Mobiliar zu Bruch ging, strafbares Verhalten angekündigt wird oder das JA generell Tanzveranstaltungen im Jugendzentrum mangels Interesses nicht mehr zulassen will.
Die von verschiedenen Gerichten gebilligte Behördenpraxis, die davon ausgeht, dass ein einmaliger Cannabiskonsum Zweifel an der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen begründet und die Einholung eines tief in den Persönlichkeitsbereich eingreifenden medizinisch-psychologischen Gutachtens rechtfertigt, während bei alkoholauffälligen Kraftfahrern ein derartiges Gutachten erst „nach wiederholten Verkehrszuwiderhandlungen unter Alkoholeinfluss“ eingeholt wird, hält das BVerfG für sachlich nicht gerechtfertigt (BVerfG 24.06.1993 – 1 BvR 689 / 92). In einer anderen Entscheidung hat das BVerfG (9.03.1994 – 2 BvL 43 / 92, 2 BvR 2031 / 92) aber im Hinblick auf die Strafbarkeit des Drogenbesitzes entschieden, dass Art. 3 GG es nicht gebiete, alle potenziell gleich schädlichen Drogen gleichermaßen zu verbieten oder zuzulassen, weshalb der Gesetzgeber den Umgang mit Cannabisprodukten einerseits, mit Alkohol oder Nikotin andererseits unterschiedlich regeln dürfe (zum Drogenstrafrecht s. IV-2.3.5).
Selbstbindung der Verwaltung
Grds. ist eine Verwaltung nur an gesetzliche Vorschriften gebunden, nicht an interne Verwaltungsvorschriften (1.1.3.6). Eine Bindung der Verwaltung tritt aber auch dann ein, wenn durch Verwaltungsvorschriften festgelegt ist, wie ein Ermessensspielraum ausgefüllt werden soll. Insoweit muss die Verwaltung alle Bürger, die die gleichen Voraussetzungen mitbringen, gleich behandeln. Von einer derartigen von Art. 3 GG geforderten Selbstbindung kann die Behörde aber abweichen, wenn sie beabsichtigt, ihre Entscheidungen im Rahmen ihres Ermessensspielraumes künftig an anderen Gesichtspunkten zu orientieren.
Aus dem Gleichheitsgrundsatz kann nicht abgeleitet werden, dass die Behörde, die durch pflichtwidriges Verhalten einen oder mehrere Beteiligte begünstigt hat, in gleicher Weise auch in Zukunft rechtswidrig verfährt: keine Gleichheit im Unrecht (vgl. z. B. im Hinblick auf die Einberufung von Wehrpflichtigen BVerwG NJW 72, 1483 f.).
Das Gleichheitsgebot richtet sich wie alle Grundrechte unmittelbar nur an alle Hoheitsträger, also öffentliche Institutionen und Einrichtungen, Verwaltungen und Dienste, entfaltet jedoch eine sog. mittelbare Drittwirkung (s. u. 2.2.4) letztlich im Hinblick auf die durch § 138 BGB geschützte, herrschende Rechts- und Sozialmoral („ethisches Minimum“; vgl. 1.1.2).
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Inzwischen wurde das Gleichbehandlungsgebot bzw. Diskriminierungsverbot explizit auf andere Regelungsbereiche ausgeweitet. Dies geschah durch das am 18.08.2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), mit dem entsprechende EU-Richtlinien (s. 1.1.5.1) umgesetzt wurden (hierzu Däubler / Bertzbach 2013). Das Gesetz enthält v. a. Regelungen, die sich an private ArbGeb richten (§§ 6 ff.AGG; hierzu IV-3.2 u. IV-3.4.1), aber auch solche, nach denen das Diskriminierungsverbot in bestimmten Bereichen des Zivilrechts zu beachten ist. Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse (eine sicherlich höchst umstrittene Wortwahl, die aber auf Art. 2 AEMR aus dem Jahr 1948 zurückgeht) oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen (§ 1 AGG). Allerdings gilt das Benachteiligungsverbot im Zivilrecht nach § 19 Abs. 1 AGG nur eingeschränkt und zwar nur bei sog. Massengeschäften, d. h. Rechtsgeschäften, die typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen bzw. bei denen das Ansehen der Person nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen, sowie Rechtsgeschäften, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben. Unter Massengeschäfte im Sinne des Gesetzes fallen der Besuch von Gaststätten und Diskotheken (vgl. AG Hannover 462 C 10744 / 12 – 14.08.2013; AG Bremen 20.02.2011 – 25 C 0278/10) oder anderen Freizeiteinrichtungen, der alltägliche Einkauf im Einzelhandel, die Buchung einer Pauschalreise, der Frisörbesuch, der Geschäftsabschluss mit dem Gebrauchtwagenhändler oder die Inanspruchnahme von Personenbeförderungsunternehmen.
Übersicht 8: Anwendung des Gleichheitsgebotes des Art. 3 GG

Keine Anwendung findet das Gesetz auf Verträge, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragspartnern begründet wird (§ 19 Abs. 5 S. 1 AGG). Kreditverträge sollen deshalb nicht unter das Verbot der Ungleichbehandlung fallen, weil hier die individuelle Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers eine ausschlaggebende Rolle spielt (im Einzelnen vgl. Degener et al. 2008, 293). Zudem benennt § 20 AGG einzelne Fallgruppen, in denen eine unterschiedliche Behandlung aus „sachlichen Gründen“ (z. B. Verhinderung von Gefahren, Schutz der Intimsphäre, Gewährung besonderer Vorteile, vgl. auch § 5 AGG) zulässig ist. Bei privaten Versicherungen ist dies bspw. der Fall, wenn für bestimmte Gruppen (Schwangere, Behinderte, besonders junge und ältere Menschen o. Ä.) versicherungsmathematisch ein statistisch höheres Schadenseintrittsrisiko vorliegt (§ 20 Abs. 2 AGG). Allerdings hat der EuGH (hierzu 5.1) die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in Versicherungstarifen beanstandet und die Einführung sog. Unisex-Tarife gefordert (EuGH C-236 / 09 – 01.03.2011).
Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung, Durchführung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse unzulässig, die den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, die sozialen Vergünstigungen, die Bildung bzw. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum, zum Gegenstand haben. Hierzu dürften Arztverträge ebenso gehören wie Angebote von Hausaufgabenhilfen von Vereinen oder von betreuten Wohnformen durch private Träger. Für öffentliche Sozialleistungsträger, auch soweit sie sich privater Anbieter zur Leistungserbringung bedienen, gilt Art. 3 GG ohnehin. Die Vermietung von nicht mehr als 50 Wohnungen ist in der Regel kein Massengeschäft (§ 19 Abs. 5 S. 3 AGG). Das AGG richtet sich deshalb grds. nicht an Privatvermieter einzelner Wohnungen, wohl aber an Wohnungsbaugenossenschaften o. Ä. Im Hinblick auf die Vermietung von (Hotel-)Zimmern hat das OLG BB (1 U 4 / 10 – 18.04.2011) entschieden, dass Hotelbetreiber als private Unternehmer – anders als der Staat – nicht zur Gleichbehandlung aller potenziellen Gäste verpflichtet sind und deshalb Personen mit extremer politischer Gesinnung den Zugang verwehren können. Weder das AGG noch entsprechende EU-Richtlinien stünden dem Hausverbot entgegen, da die Weltanschauung nur in Bezug auf Beschäftigung und Beruf, nicht aber im allgemeinen zivilrechtlichen Bereich mit einem besonderen Diskriminierungsverbot versehen sei.
Das AGG beinhaltet somit keine Regelungen, die ganz allgemein im Privatrechtsverkehr eine Diskriminierung verbieten. Bei einer nachgewiesenen ungerechtfertigten Benachteiligung haben die Betroffenen nach dem AGG Beseitigungs-, Unterlassungs- und ggf. Schadensersatzansprüche, die innerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend gemacht werden müssen (§ 21 AGG). Obwohl die Beweislast für die Betroffenen erleichtert ist (§ 22 AGG: Beibringen von Indizien, aber keine Beweislastumkehr) wird es mangels schriftlicher Unterlagen (z. B. einer Stellenausschreibung) häufig schwer sein, eine Benachteiligung darzulegen und den „eigentlichen“ Grund für die als unzulässig angesehene Diskriminierung festzustellen. Zudem hat das BAG zuletzt entschieden, dass die Vermutung einer Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes nur besteht, wenn Indizien vorliegen, die mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“ darauf schließen lassen, dass ein in § 1 AGG genannter Grund tatsächlich ursächlich für die Benachteiligung war (BAG 26.01.2017 - 8 AZR 736/15).
2.1.3 Sozialstaatsprinzip
Auch das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 und 28 GG) ist eine der wesentlichen, nicht veränderbaren Grundentscheidungen der deutschen Verfassung (Art. 79 Abs. 3 GG). Verfassungsrechtlich handelt es sich beim Sozialstaatsprinzip um eine sog. Staatszielbestimmung. Sie verpflichtet den Staat, für soziale Gerechtigkeit auf der Grundlage der Achtung der Menschenwürde zu sorgen, widerstreitende Interessen auszugleichen und erträgliche Lebensbedingungen herzustellen (vgl. BVerfGE 82, 60, 85). Ziel ist die Herstellung sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit (vgl. § 1 SGB I). Das BVerfG und die übrige höchstrichterliche Rechtsprechung haben aus der Menschenwürdegarantie und dem Sozialstaatsprinzip u. a. die Verpflichtung aller staatlichen Organe abgeleitet:
■ für einen Ausgleich sozialer Ungleichheiten und Gegensätze und damit für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen (Gebot der sozialen Gerechtigkeit, BVerfGE 22, 180, 204; 35, 348, 355 f.), insb. Chancengleichheit für sozial Benachteiligte zu schaffen (BVerfGE 56, 1393);
■ für eine annähernd gleichmäßige Verteilung der öffentlichen Lasten zu sorgen, insb. sollen Lasten der staatlichen Gemeinschaft nicht zufällig von einzelnen Bürgern oder bestimmten Personenkreisen getragen werden (Lastenausgleichsgebot; vgl. BVerfGE 5, 85, 198 f.; 27, 253);
■ jedem mittellosen Bürger das Existenzminimum erforderlichenfalls durch Sozialleistungen zu sichern (vgl. BVerfGE 82, 60) und dem Bürger das selbst erzielte Einkommen bis zur Höhe des Existenzminimums nicht (durch Steuern) zu entziehen (BVerfG NJW 1990, 2869);
■ Menschen, die materielle, gesundheitliche oder psychosoziale Probleme haben und sich nicht selbst helfen können, Hilfe zukommen zu lassen (BVerfG NJW 1977, 1489);
■ insbes. schwächeren Mitbürgern „zur Erlangung und Wahrung der ihnen vom Gesetz zugedachten Rechte nach Kräften beizustehen“, denn im sozialen Rechtsstaat sind die Amtsinhaber nicht nur Vollstrecker staatlichen Willens und nicht nur Diener des Staates, sondern zugleich auch „Helfer des Bürgers“(BGH NJW 1965, 1227);
■ zur Berechnung der im Rahmen der Sozialhilfe gewährten Regelleistungen, insb. für Kinder, den notwendigen Bedarf in einem transparenten und sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren zu ermitteln. Zudem muss der Gesetzgeber, neben der Deckung des typischen Bedarfs zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums durch einen monatlichen Festbetrag, für einen darüber hinausgehenden unabweisbaren, laufenden, nicht nur einmaligen, besonderen Bedarf einen zusätzlichen Leistungsanspruch einräumen (BVerfG 1 BvL 1 / 09 – 09.02.2010).
Allerdings ist der Sozialstaatsgrundsatz inhaltlich nicht konkretisiert. Er enthält infolge seiner Weite und Unbestimmtheit keine unmittelbaren Handlungsanweisungen, die durch die Gerichte ohne zusätzliche gesetzliche Grundlage umgesetzt werden könnten (BVerfGE 65, 182, 190). Der einzelne Bürger kann deshalb aus dem Sozialstaatsprinzip grds. keine Ansprüche auf konkrete Leistungen ableiten (vgl. § 2 Abs. 1 S. 2 SGB I). Vielmehr ist es – gemäß dem Demokratieprinzip – Aufgabe des Gesetzgebers, das Sozialstaatsprinzip durch gesetzliche Normen zu konkretisieren und für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen (BVerfGE 33, 303, 333; 69, 272). Deshalb wurde im SGB I die Sicherung eines menschenwürdigen Daseins und die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit zu einer grundlegenden staatlichen Aufgabe gemacht. Das Sozialstaatsprinzip hat also zunächst Steuerungsfunktion für die Sozialgesetzgebung. Ausfluss des Sozialstaatsprinzips sind insoweit z. B.:
■ die im SGB geregelten Ansprüche auf staatliche Leistungen,
■ im Arbeitsrecht z. B. die Kündigungsschutzvorschriften, das Mutterschutz-, Schwerbehinderten- und Jugendarbeitsschutzgesetz,
■ im Wohnungs- und Mietrecht ebenfalls die Kündigungsschutzvorschriften sowie die Regelungen über Wohnungsbaudarlehen oder die Berechtigung zum Bezug von Sozialwohnungen,
■ in der Steuergesetzgebung z. B. die steuerliche Freistellung des Existenzminimums oder die Steuerbegünstigung gemeinnütziger Vereinigungen.
Darüber hinaus muss die Verwaltung das Sozialstaatsprinzip als bindende Auslegungsregel (hierzu 3.3.2) sowie bei der Anwendung von Ermessensvorschriften beachten.
Subsidiaritätsprinzip
Das Gebot der Menschenwürde schließt die abhängig machende Totalversorgung und eine fürsorgerische Belagerung durch den Staat aus. In neuerer Zeit spricht man von dem „Leitbild des aktivierenden Sozialstaates“, der die Förderung und Befähigung des Einzelnen zur Übernahme von Eigenverantwortung unter dem Schlagwort des „Förderns und Forderns“ zum Ziel hat. Traditioneller spricht man hier vom Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“, vom Nachrang- oder Subsidiaritätsprinzip. Im weiten, grundsätzlichen Sinne geht es dabei um das Verhältnis von Bürger und Staat überhaupt. Im engeren Sinne geht es um das Verhältnis freier Träger (= Bürger) zu öffentlichen Trägern (= Staat). Der Subsidiaritätsgedanke ist zunächst Kern des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Bei staatlichen Interventionen muss stets geprüft werden, ob diese nicht nur geeignet, sondern auch notwendig sind (s. 2.1.2.2). Das gilt für Hilfeleistungen ebenso wie bei Eingriffen. Die Intervention des Staates ist nicht erforderlich, wenn und soweit die Bürger sich selbst helfen können. Selbst wenn Menschen auf Hilfe angewiesen sind, bleiben sie vollwertige Rechtssubjekte, deren Würde unangetastet bleibt und bleiben muss. Ein fürsorgerisch-entmündigender Umgang mit hilfebedürftigen Menschen ist nicht nur unsozial und fachlich inadäquat, sondern auch verfassungswidrig. Nicht alles, was nützt, ist auch erlaubt. Hilfe muss aus ethischen, sozialpädagogischen wie rechtlichen Gründen immer Hilfe zur Selbsthilfe sein. Im Hinblick auf den Nachrang staatlicher Hilfe und den Vorrang der Hilfe zur Selbsthilfe kann man also in Anknüpfung an das Verhältnismäßigkeitsgebot in der Sprache der Sozialen Arbeit formulieren: so selbstständig, so viel Eigenverantwortung und Freiraum wie möglich, deshalb so wenig Hilfe wie möglich, aber so viel Hilfe wie nötig.
Während der abwehrende („negative“) Aspekt des Subsidiaritätsgedankens zur Zurücknahme des staatlichen Kontrollzugriffs verpflichtet, beinhaltet seine positive Seite aber immer auch die Verpflichtung des Staates, dem Bürger helfend zur Seite zu stehen, wenn seine eigenen Kräfte nicht ausreichen. Denn wenn der Sozialstaat nur die Aktivierung des Einzelnen forderte, ohne seinerseits entsprechende Unterstützungssysteme bereitzustellen oder gar die mangelnde Bereitstellung, das Wegbrechen und den Abbau integrativer Sozialleistungen durch eine verstärkt ordnungsrechtliche Sozialkontrolle kompensierte, wären dies die düsteren Zeichen des Wandels vom leistenden Sozialstaat zum strafenden Staat (Bettinger / Stehr 2009, 252 ff.; Wacquant 2009, 292).
Verhältnis öffentlicher und freier Träger
Wird aus dem Subsidiaritätsgebot mit Blick auf den Leistungsempfänger das Gebot der Hilfe zur Selbsthilfe und das Prinzip der Nachrangigkeit (vgl. § 2 Abs. 1 SGB XII) begründet, so beinhaltet es andererseits einen grundsätzlichen Betätigungsvorrang der freien Träger (s. 4.1.2.2) vor den öffentlichen Sozialleistungsträgern (vgl. z. B. § 4 Abs. 2 SGB VIII, § 5 Abs. 4 SGB XII). Im Hinblick auf das Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern muss allerdings auch festgehalten werden, dass das BVerfG in seiner Entscheidung von 1967 (BVerfGE 22, 180 f.) – übrigens ohne das Wort Subsidiaritätsprinzip zu erwähnen – von einer „durch Jahrzehnte bewährten Zusammenarbeit von Staat und freien Verbänden“ ausgegangen ist (sog. Korporatismus), eine Existenz wahrende Bestandsgarantie öffentlicher Einrichtungen formuliert sowie auf die Planungs- und Gesamtverantwortung der öffentlichen Träger für die Bereiche der Jugendhilfe und Sozialhilfe hingewiesen hat (vgl. hierzu ausführlich Münder 1998).
System der sozialen Sicherung
Das System der sozialen Sicherung in Deutschland ist im Sozialrecht (hierzu III-1) geregelt und besteht im Wesentlichen aus vier Säulen, die unterschiedlichen Prinzipien folgen und sich im Hinblick auf Inhalt und Rechtsgrund der Leistung, den Bereichen und Trägern der Leistungen unterscheiden (s. Übersicht 9):
■ der Vorsorge durch die Sozialversicherungssysteme,
■ dem Versorgungssystem,
■ dem Förderungssystem,
■ dem Hilfesystem.

Die Bedeutung des Sozialleistungsbereichs für die Volkswirtschaft ist immens. Die Leistungen des Sozialbudgets insgesamt beliefen sich Ende 2012 für Deutschland auf rund 760 Mrd. Euro. Das Verhältnis von Sozialleistungen zum Bruttoinlandsprodukt – die Sozialleistungsquote – hat sich allerdings von 31,3 % im Jahr 2009 auf 30,4 % im Jahr 2013 abgesenkt (vgl. www.destatis.de ➝ Sozialbudget) und ist damit niedriger als einige Jahre davor (z. B. 2000: 33,6 % bei insg. 681 Mrd. Euro; 2001: 33,8 % bei insg. 702 Mrd. Euro). Den größten Bereich machen die Renten aus, wie sich aus der nachfolgenden Aufstellung der Sozialleistungen nach Funktionen (ohne Verwaltungsausgaben) ergibt (vgl. www.destatis.de 8 / 2013):
■ Alter und Hinterbliebene: 292,7 Mrd. Euro
■ Krankheit und Invalidität: 294,74 Mrd. Euro
■ Arbeitslosigkeit: 42,3 Mrd. Euro
■ Kindergeld- und Familienleistungsausgleich: 41,5 Mrd. Euro
■ Kinder- und Jugendhilfe: 27,8 Mrd. Euro (2011), davon 18,5 Mrd. für KiTa und 7,8 Mrd. für erzieherische Hilfen und Schutzmaßnahmen
■ Sozialhilfe: 22,7 Mrd. Euro (2011)
Zur Menschenwürde gehört mehr als die bloße Absicherung gegen die existenziellen Lebensrisiken wie Krankheit, Invalidität, Pflegebedürftigkeit, Alter oder Arbeitslosigkeit. Zum Sozialstaat des Grundgesetzes gehört, dass er zu Bedarfsgerechtigkeit und Chancengleichheit beiträgt. Die Bedeutung des Sozialstaats besteht in diesem Sinne auch wesentlich darin, zur Verteilungsgerechtigkeit beizutragen (BMGS 2005, 3).
2.2 Grundrechte
2.2.1 Geschichtliches – begriffliche Einordnung
Grundrechte und Menschenrechte
Die Idee der Grundrechte wird häufig aus naturrechtlichen Vorstellungen abgeleitet. „Freiheit (Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür)“, so lesen wir bei Immanuel Kant, sei das „einzige, ursprüngliche, jedem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende Recht“ (1797, 345). Kant formuliert hiermit nicht mehr und nicht weniger als den Ursprungsgehalt der Menschenrechte, die uns geschichtlich etwa in Gestalt der Virginia Bill of Rights von 1776, der amerikanischen Verfassung von 1787 und vor allem der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26.08.1789 entgegentreten. Heute finden wir diese Idee in der AEMR, den beiden Menschenrechtspakten und einer Vielzahl weiterer internationaler Konventionen vor (hierzu: 1.1.2).
Freiheit vor dem Staat
Zum Wesen der Grundrechte gehört jedoch nicht nur ihr freiheitlicher Gehalt als solcher, sondern gleichermaßen auch ihre Gerichtetheit gegen potenzielle Bedrohungen eben dieses Freiheitsgehaltes durch staatliche Intervention. Dies wird in der naturrechtlichen Perspektive anhand der vertragstheoretischen Argumentation des englischen Staatsdenkers John Locke entwickelt.
Übersicht 9: System der sozialen Sicherung in Deutschland

Vertragstheorie
Die Vertragstheorie macht geltend, dass der Einzelne, da ihm als vereinzeltem Individuum keine Möglichkeiten eines effektiven Schutzes seines Freiheitsrechts zu Gebote stehen, darauf angewiesen sei, mit den anderen Mitgliedern der Gesellschaft eine Übereinkunft über einen Zusammenschluss zum Zwecke der Freiheitssicherung zu treffen. Dies sei zugleich der Gründungsakt einer staatlichen Gewalt, an die dann also das Recht zu Gesetzgebung und Gesetzesausführung übertragen werde. Nun können aber nach einer derartigen Konstruktion die Einzelnen nichts auf die Staatsgewalt übertragen, worüber sie selbst nicht verfügen. Da ihnen jedoch, wie bei Kant gesehen, insb. kein Recht auf Eingriff in die Freiheitsrechte des anderen zustehe, könne demzufolge auch der Staat ein derartiges Recht nicht für sich beanspruchen (Locke 1689, 264 ff., 289 ff.).