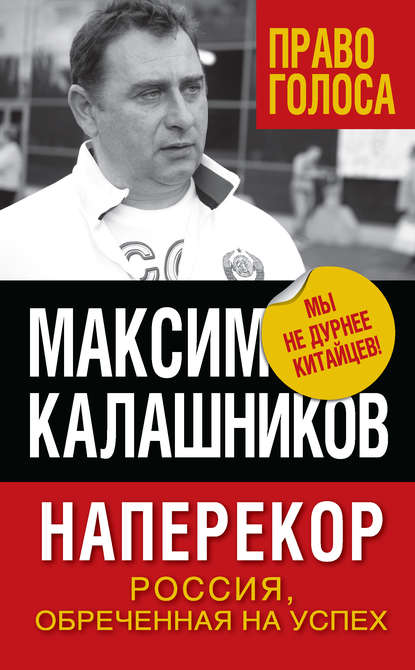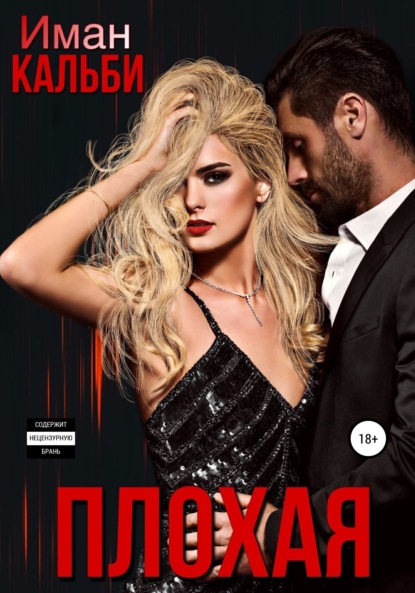- -
- 100%
- +
Rolle und Funktion des Staates
staatliches Gewaltmonopol
Damit ist zugleich auf die Differenz zwischen Definition und Begriff aufmerksam gemacht. Es geht in diesem einleitenden Kapitel daher nicht in erster Linie darum, einen Merksatz zum Recht zu formulieren, sondern darum, Recht begreifen zu können. Denn dies meint – im Unterschied zur Definition – das Wort „Begriff“. Ganz wesentlich ist hierfür die Frage nach der Rolle und Funktion des Staates. Nach der von Platon (375 v. Chr.: „politeia“ – der Staat; „nomoi“ – die Gesetze) und Aristoteles (330 v. Chr.) begründeten Staatsphilosophie ist der Staat Garant des friedlichen Zusammenlebens der Menschen. Nach Aristoteles bestimmte deshalb der Staat, was als Recht gilt. Der englische Philosoph Thomas Hobbes verabsolutierte den Staat als „Leviathan“ (1651), als legitime und allmächtige Autorität, um das menschliche Chaos zu beherrschen. Dagegen entwickelte Immanuel Kant ein Idealbild der bürgerlichen Gesellschaft, in dem die Freiheit des Individuums den Machtansprüchen des absoluten Staates gegenüberstand. Verbindendes Element ist bis heute insoweit die Prämisse, dass einerseits in einem Rechtsstaat grds. nur dem Staat als Hoheitsträger das Recht auf Zwang eingeräumt ist (sog. staatliches Gewaltmonopol), dieses Recht andererseits aber durch Freiheitsrechte der Bürger gegenüber dem Staat (im modernen Verfassungsstaat heute als Grundrechte bezeichnet, hierzu 2.2) rechtlich rückgebunden und begrenzt ist.
Recht hat zunächst etwas mit Normen (s. Übersicht 1), also vorformulierten Erwartungen, zu tun. Soziale Normen sind Verhaltensregeln, Leitbilder, die das gegenwärtige oder das zukünftige Handeln der Menschen (und heute auch sog. juristischer Personen, hierzu II-1.1) in bestimmten Situationen mehr oder weniger verbindlich beschreiben. Man unterscheidet hier insb. Traditionen, Konventionen, Brauch, Sitte und Recht. Das Spektrum reicht von Normen, die nur innerhalb einer bestimmten Gruppe („Subkultur“) anerkannt sind (z. B. die Verhaltensregeln innerhalb von Jugendcliquen, von Kaufleuten, Mitgliedern einer Kirche), bis zu solchen, die für alle Mitglieder einer Gesellschaft gelten. Was im Kontext einer einzelnen Gruppe als abweichend gilt (z. B. Bluttransfusion bei Zeugen Jehovas), kann für die Gesamtgesellschaft akzeptabel oder zwingend notwendig sein, während umgekehrt ein von der Gesamtgesellschaft missbilligtes Verhalten in spezifischen Gruppen der gleichen Kultur gebilligt und sogar gefördert werden kann (z. B. manche Formen jugendtypischen Verhaltens). Im Verhältnis der Normensysteme nimmt der Grad der Verbindlichkeit über Brauch und Sitte bis zum Recht zu. Es kann auch vorkommen, dass der Gesetzgeber im positiven, d. h. in einem (demokratischen) Gesetzgebungsverfahren verfassten Recht ausdrücklich auf bestimmte (Handels-)Bräuche und die „guten Sitten“ Bezug nimmt (vgl. §§ 138, 157, 242 BGB, § 346 HGB).
Übersicht 1: Normensysteme

Sitte und Moral
Rechtsstaat
Als „Goldene Regel“ der praktischen Ethik findet sich in nahezu allen Weltreligionen und Philosophien in der sprichwörtlichen Wendung das Gebot „Was du nicht willst, dass man dir tu, das fügʼ auch keinem anderen zu“, also „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ Ob und inwieweit Sitte, Moral und Recht sich beeinflussen oder gar decken, ist in der Menschheitsgeschichte unterschiedlich beantwortet worden. Für die europäischen Rechtsordnungen des Mittelalters etwa war es geradezu ein Kennzeichen, dass die jeweiligen Moralvorstellungen religiöser und weltlicher Herrscher als allgemein verbindliches Recht mit Folter und Inquisition eingefordert wurden. Die seitdem vollzogene Emanzipation des Rechts von der Moral muss daher insoweit als ein Fortschritt innerhalb der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft gesehen werden. In der rechts- und sozialphilosophischen Literatur ist sie bis zu Hobbes (Hobbes 1651, 73) zurückzuverfolgen; in voller Konsequenz durchgeführt wurde sie dann von Kant in der „Metaphysik der Sitten“, die im ersten Teil die Rechtslehre und im zweiten Teil die von ihm so bezeichnete Tugendlehre behandelt (Kant 1797). Von Immanuel Kant stammt auch das wohl wichtigste menschliche Moralgebot, der sog. kategorische Imperativ, also das Gebot, welches für jedes vernunftbegabte Wesen per se und universell gelten soll: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“ (Kant 1788, 54). In ihm geht es darum, dass jeder Mensch zunächst prinzipiell über die Fähigkeit verfügt, einen freien Willen zu bilden, und damit in der Lage wäre, dem Grundsatz auch tatsächlich für sich selbst Geltung zu verschaffen. Es ist also die moralische Dimension angesprochen; ein Gesetz im juristischen Sinne ist hier nicht gemeint. Mit Moral verbindet Kant die innere Haltung des Individuums, die Gesinnung, die – wie er sagt – Tugend. Recht hingegen richtet sich an das äußere Verhalten der Menschen, ob ein Bürger diese Norm für richtig oder aus welchen Gründen er sich an die Rechtsnorm hält, ist unerheblich, solange die Verhaltensanweisung eingehalten wird. Dies muss so sein, weil die Freiheit des Einzelnen, die für Kant die Voraussetzung moralisch richtigen Verhaltens ist, mit der Freiheit des anderen in Konflikt geraten kann. Deshalb muss es klare Grenzen und Regeln geben. Diese Grenzen werden vom Recht gesetzt. Das Recht ist demnach in den Worten von Kant der Inbegriff der Bedingungen, unter denen das Belieben des einen, etwas zu tun oder zu unterlassen, mit einem entsprechenden Belieben des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit vereinigt werden kann (Kant 1797, 317 f., 337). Damit freilich ist nicht nur die Unterscheidung zwischen Moral und Recht getroffen, sondern zugleich das Verbindende bezeichnet, für das Kant den Begriff der Sittlichkeit verwendet. Georg Jellinek, ein bedeutender Staatsrechtler Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, fasst diesen Zusammenhang in die von Juristen gern verwendete Formel vom Recht als dem sozialethischen Minimum (Jellinek 1872 / 1878, 42). Gleichwohl ist mit der strikten Unterscheidung zwischen moralisch zu erwartendem und rechtlich verbindlich verlangtem Handeln die Idee des modernen Rechtsstaates geboren, der die Einhaltung dieser Regeln zum Wohle der Freiheit des Einzelnen und zum Wohle der Gesellschaft als Ganzem zu garantieren hat (Kant 1797, 333). Der frühere Bundesverfassungsrichter Wolfgang Böckenförde bringt dies mit der Formulierung auf den Punkt, dass das Recht eben keine Tugend- und Wahrheitsordnung sei, sondern eine Friedens- und Freiheitsordnung (Böckenförde 1973, 193).
Im Sinne des modernen systemtheoretischen Ansatzes ist das positive Recht geradezu die Voraussetzung der modernen Gesellschaft (Luhmann 1970, 177 f.). Die „Heterogenität der Wertpräferenzen“ macht in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft ein Mindestmaß an Einheitlichkeit und Verbindlichkeit von Normen für den sozialen Kontakt unverzichtbar. Fehlt es an Konformität, ist die Gesellschaft in ihrem Bestand gefährdet. Recht dient damit der Wahrung von Konformität und dem Bestand des Sozialsystems.
soziale Kontrolle
Soziale Normen definieren deshalb in aller Regel nicht nur den Verhaltensbereich als solchen, sondern gleichzeitig auch die jeweiligen Reaktionen auf das von ihm abweichende Verhalten. Die sozialen und gesellschaftlichen Mechanismen und Prozesse, die abweichendes Verhalten verhindern und einschränken sollen, bezeichnet man als soziale Kontrolle. Diese soziale Kontrolle war und ist in sog. egalitären Gesellschaften der Sippe oder dem Stamm als Ganzem übertragen. Mit der Entwicklung des Staatswesens lag hierin seine zentrale Funktion. Mit öffentlicher Sozialkontrolle bezeichnet man alle gesellschaftlichen Einrichtungen, Strategien und Sanktionen, mit denen eine Gesellschaft die Einhaltung der in ihr geltenden Normen und die soziale Integration ihrer Mitglieder bezweckt. Hierin lag für Max Weber das Wesen von Recht und Staat (Weber 1921, 18). Dieser bezwecke mit seinem Zwangsapparat die Einhaltung der Normen und die Ahndung der Normverletzungen. Dies kann als Ordnungsfunktion oder – mit einem eher negativ assoziierten Begriff – als „Herrschaftsfunktion“ des Rechts bezeichnet werden. Recht gibt also nicht nur verbindliche Orientierungen im Hinblick auf das menschliche Verhalten, sondern ist gleichzeitig ein Ordnungsrahmen. Zu den Mitteln der Sozialkontrolle zählen u. a. das Recht,Religion, Erziehung und Sanktionen. Wer gegen die Tischsitten verstößt, wird ggf. schief angesehen und nicht mehr eingeladen, wer „aus der Rolle fällt“, macht sich gesellschaftlich unmöglich. Das kann im Einzelfall die soziale Existenz eines Menschen empfindlich treffen, man wird gesellschaftlich „abgestraft“ und ausgegrenzt. Anders als Rechtsnormen lassen sich aber z. B. Tischsitten gesellschaftlich nicht erzwingen. Dagegen gehört – in der Tradition der Rechtsphilosophie Kants – zum Recht als Instrument der öffentlichen Sozialkontrolle notwendig der staatliche Zwang. Die Geltung und Einhaltung der Rechtsnormen werden – wenn es nicht anders geht – erzwungen. Auch die in der modernen Zivilgesellschaft wieder wichtiger werdende autonome, außergerichtliche Konfliktregelung (hierzu I-6) lebt davon, dass im Hintergrund Zwangsmittel bereitgehalten und zur Verteidigung des Rechts und zum Schutz des Schwachen aktiviert werden können (Trenczek 2005, 17). Entscheidend ist für einen modernen Rechtsstaat – wenn man überhaupt von einem „Schatten“ des Rechts sprechen will – dass „das Recht stärker durch seinen Schatten wirkt als durch den tatsächlich exekutierten Zwang“ (Frehsee 1991, 59).
In einem modernen Rechtsstaat begrenzt sich die Funktion des Rechts freilich nicht darauf, orientierende Leitlinie für das Sozialverhalten seiner Bürger zu sein, die Menschenwürde zu sichern, persönliche Freiheit zu gewährleisten und soziale Kontrolle rechtsstaatlich abzusichern (sog. Grenzziehungsauftrag und Herrschaftskontrolle). Wesentlich sind vor allem die Strukturierung des Gemeinwesens und seiner wesentlichen öffentlichen Institutionen (Ordnungsfunktion) sowie – im Zusammenspiel mit dem Sozialstaatsprinzip – der Auftrag zur Chancenermöglichung (Emanzipation und Aktivierung) und der Gewährung gesellschaftlicher Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn sich damit die Idee des Rechts an der Gerechtigkeit orientiert (hierzu 1.2), kann dieses Ziel immer nur ansatzweise erreicht werden, da im Widerstreit gesellschaftlicher und privater Interessen auch im besten Fall nur ein fairer Interessensausgleich geleistet werden kann.
1.1.2 Woher kommt das Recht? Die Genese der Rechtsnormen
Naturrecht
Bräuche und Sitten haben sich aufgrund der mit ihnen gemachten Erfahrungen gewohnheitsmäßig herausgebildet. Recht kann sich aus unterschiedlichen Quellen speisen. Als ungeschriebene Grundlage des Rechts wird häufig das sog. Naturrecht bezeichnet, also eine verbindliche Grundordnung, die der Mensch als gegeben hinnimmt, weil sie seiner Natur und seiner Vernunft entspricht. Hierauf basierte die Stoa, die 300 v. Chr. von Zenon dem Jüngeren gegründete Athener Denkschule, nach der das Recht nicht vom Staat begründet, sondern als ein allgemeines Naturgesetz angesehen wurde. Auch das für das heutige bürgerliche Recht in vieler Hinsicht einflussreiche Römische Recht basierte auf diesem Prinzip und es war in der modernen Rechtsgeschichte ein Dauerthema, wie viel „Natur“ das Recht besitzt bzw. verträgt. Uwe Wesel vergleicht das Naturrecht mit einem Zylinder, aus dem nur das herausgezaubert werden könne, was man vorher hineingelegt habe (Wesel 1994, 73). Mit der Natur hat man in der Vergangenheit alles Mögliche begründet, die Sklaverei genauso wie die Abschaffung der Sklaverei, die Gleichheit der Menschen wie die tiefste Barbarei. Insofern ist Zurückhaltung gegenüber naturrechtlichen Begründungen grds. angebracht. Dennoch muss gesehen werden, dass die klassischen Naturrechtskonstruktionen historisch insofern fortschrittlich sind, als sie die Vorstellung von einem „göttlichen Recht“ ablösen und zugleich, wie etwa bei Kant, darauf verweisen, dass das Recht nicht nur das Resultat rationaler Regelsetzung ist, sondern auch an empirische Voraussetzungen anknüpft. Hiermit ist vor allem die bei Kant so bezeichnete „Natur des Menschen“ gemeint, die der Vernunft zwar prinzipiell zugänglich ist, gleichwohl aber außerhalb und unabhängig von ihr existiert (Kant 1797, 345).
Universalitätsprinzipien
Auch unser heutiges mitteleuropäisches Rechtsverständnis ist von naturrechtlichen Vorstellungen beeinflusst, jedoch sind konkrete naturrechtlich begründete Glaubenssätze kaum noch zu finden. Gelegentlich wird allerdings die vom Grundgesetz als „natürliches Recht“ bezeichnete Erziehungsverantwortung der Eltern für ihre Kinder (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) zumindest teilweise als ein solcher angesehen (Gernhuber / Coester-Waltjen 2010, 38 f.).Tatsächlich handelt es sich bei Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG aber um positiv gesetztes Verfassungsrecht, das in der Rechtsprechung des BVerfG immer wieder auf faktische soziale Lebensverhältnisse bezogen wird, die einem permanenten Wandel unterliegen (hierzu ausführlich: Münder et al. 2013a, 34 ff.). Naturrechtliche Begründungen finden sich heute vornehmlich im Kontext der Menschenrechtsdiskurse, in denen von angeborenen Rechten des Menschen gesprochen wird, die in seiner Würde fundiert seien (hierzu: Opitz 2002, 12). Insofern werden Menschenrechte teilweise auch vom Standpunkt der Moral aus begründet (vgl. Tugendhat 1993, 336). In einer eher legalistischen Perspektive hingegen (z. B. Habermas 1992, 156) geht die heute angenommene universelle Geltung von Menschenrechten jedoch nicht aus ihrer naturrechtlichen Begründung hervor, sondern ergibt sich aus der „Bereitschaft der Staaten zum Abschluss entsprechender völkerrechtlich verbindlicher Vereinbarungen“ (Opitz 2002, 15). Solche heute als universell vereinbart geltende Menschenrechtsprinzipien finden sich z. B. in den Grundsätzen, die 1950 durch die Mitglieder des Europarates in der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten beschlossen wurden EMRK (u. a. Gewissens- und Religionsfreiheit, Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Unschuldsvermutung, Folterverbot), in der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 sowie in den beiden UN-Menschenrechtspakten vom 19.12.1966 (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; beide in Kraft seit 1976; hierzu 1.1.5.2). Allerdings zeigen auch die Jahresberichte von Amnesty International, dass die Universalität der Menschenrechte nicht überall akzeptiert, vielmehr auf der Welt täglich mit Füßen getreten wird. Daher war insb. in der Vergangenheit das aus dem universellen Geltungsanspruch der Menschenrechte abgeleitete, vor allem für das Völkerstrafrecht, aber auch das innerstaatliche Strafrecht (hierzu IV) bedeutsame sog. Universalitätsprinzip praktisch der einzige Anker, um rechtspositivistische Unrechtsregimes als Barbarei und gesetzliche Regelungen als Unrecht zu bezeichnen (vgl. z. B. die Frage der Rechtmäßigkeit des Schießbefehls an der DDR-Grenze nach § 27 Abs. 2 DDR-Grenzgesetz: BGH NJW 1993, 141; BVerfGE 95, 96 ff.; BVerfG 2 BvQ 60 / 99 – 11.01.2000). In diesem Zusammenhang hat der EGMR in seiner „Krenz“-Entscheidung (EGMR Nr. 1101 – 22.03.2001 – 34044 / 96) betont, dass sich selbst ein einfacher Soldat nicht blind auf Befehle berufen kann, die nicht nur krass gegen die innerstaatlichen gesetzlichen Grundsätze, sondern auch gegen die international geschützten Menschenrechte und vor allem gegen das Recht auf Leben, das höchste Rechtsgut in der Werteskala der Menschenrechte, verstoßen. Völkerrechtlich wird dem Universalitätsprinzip heute mittlerweile mit der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag Geltung verschafft, vor dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Anklage kommen.
Religion und Moral
Früher galten auch Religion und Moral als wichtige Quellen des Rechts (vgl. Wesel 1984, 194 ff.). Im Verständnis der katholischen Kirche basiert das Kanonische Kirchenrecht auf dem göttlichen Willen. Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte wurde durch philosophisch oder religiös begründete Moralvorstellungen von Gut und Böse und eine darauf basierende Sittenlehre festgelegt, was im Leben und in der Welt wertvoll ist. Die jeweils herrschenden Sitten und Moralvorstellungen wurden in eine Rechtsform gegossen. Bis in die Anfänge der Bundesrepublik (vgl. die Entscheidung des BGH 6, 46 ff. über die „Normen des Sittengesetzes“ und die „vorgegebenen und hinzunehmende Ordnung der Werte“ im Hinblick auf die Definition und Strafbarkeit der „Unzucht“) wurde auf eine ursprüngliche Einheit von Sitte und Recht, ja auch von Moral, Religion und Recht Bezug genommen. Dies konnte möglicherweise schon damals als Anachronismus gelten, handelt es sich hierbei doch eher um ein Kennzeichen sog. vorstaatlicher, oraler Gesellschaften. Allerdings beanspruchen auch heute in einer durch Internationalisierung und Migration gekennzeichneten Gesellschaft religiös (z. B. islamisch) geprägte Regelungen insb. im Internationalen Privatrecht (s. 1.1.6) wieder zunehmend Geltung.
Gerade mit Blick auf die permanenten Diskussionen über die Verschärfung des Strafrechts im Hinblick auf Prostitution und Kinderpornografie werden in der Öffentlichkeit wieder (vor)schnell moralische Kategorien zur Grundlage der Strafbarkeit erhoben. Weil Strafrecht (hierzu IV-1.3) aber ultima ratio, das letzte und (vermeintlich) schärfste Mittel des Rechts ist, darf es nicht ein Moralrecht sein. Seine Funktion darf nicht dahingehend ausgeweitet werden, dass mit ihm Meinungsverbote und Tabus durchgesetzt und als anstößig empfundenes künstlerisches Wirken verbannt werden (vgl. IV-2.3.3; ausführlich zum strafrechtlichen Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus: Hörnle 2004a). Begrenzungen der Handlungsfreiheit sind in den Schranken des Art. 2 Abs. 1 GG vor allem im Hinblick auf die schützenswerten „Rechte anderer“ legitim. Insoweit ist der Strafgesetzgeber zweifellos gefordert, das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung gerade in Bezug auf Kinder, die dies entwicklungsbedingt noch nicht selbst können, effektiv zu schützen. Aber auch hier gilt, dass nur das, was in grober Weise sozialschädlich und damit wirklich strafwürdig ist, unter Strafe zu stellen ist.
Erst später, als die Schrift dominierendes Kultur- und Kommunikationsmedium wurde, hat sich das Recht zunehmend als eigene Kategorie entwickelt und einen Prozess der Verrechtlichung der Gesellschaft eingeleitet, den Max Weber als einen Vorgang allgemeinen sozialen Rationalitätsgewinns beschreibt (Weber 1921, 563). Dabei hat die Trennung von Recht und Moral durchaus zwei Seiten: die Vergrößerung der persönlichen Freiheit einerseits und die mangelnde Verbindlichkeit sittlicher Maßstäbe andererseits. Rein rechtspositivistisch ist es vorstellbar, dass jemand aufgrund der geltenden Gesetze rechtmäßig handelt, gleichwohl aber unmoralisch. Uwe Wesel (1999, 388) nennt hier als Beispiel den Betreiber eines Kraftwerkes, welches die Umwelt verschmutzt. Die Organisation Greenpeace, welche sich hiergegen zur Wehr setzt, mag dabei die Gesetze übertreten, ihr Protest hat aber zumeist die Moral auf seiner Seite. Gerade am Beispiel des zivilen Ungehorsams, der gewaltfrei ist, sich jedoch häufig der Formen (symbolischer) Rechtsnormverletzungen bedient (etwa: Sitzblockaden – vgl. IV-2.1.2 –, früher auch die Totalverweigerung, in den USA vor allem der Steuerstreik), zeigt sich, dass rechtliche und moralische Bewertungen ein und desselben Verhaltens zu mitunter sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen können (im Einzelnen hierzu: Dreier 1991, 39 ff.). Allein die Tatsache, dass ein Einzelner oder eine Gruppe positiv gesetztes, d. h. durch das verfassungsmäßig vorgesehene Gesetzgebungsverfahren verfasstes Recht im konkreten Einzelfall als unzweckmäßig oder auch ungerecht erachten, wird dessen Geltung jedenfalls regelmäßig noch nicht außer Kraft setzen. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Strafrechtler und Kriminologe Gustav Radbruch (1878 –1949), der zugleich einer der bedeutendsten demokratischen Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts war. Für ihn verliert das positive Recht erst dann seinen Vorrang, wenn „der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als ‚unrichtiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu weichen hat“ (sog. Radbruch‘sche Formel; Radbruch 1946, 107). Ein derart eklatantes Auseinanderfallen von Gerechtigkeit und Recht, das nach dem Verständnis von Radbruch zugleich zu einer Zerstörung des Rechts selbst führen musste, wurde von ihm etwa für die Zeit der NS-Diktatur konstatiert, in der schlimmstes Unrecht in „positives“ Recht gesetzt wurde. Einen solchen Fall von „gesetzlichem Unrecht“, wie Radbruch dies nannte, im Zusammenhang mit heutigen Protesten gegen tatsächliche oder vermeintliche politische Fehlentscheidungen annehmen zu wollen, wäre allerdings nicht nur historisch unangemessen, sondern auch im theoretischen Ansatz falsch, weil die Grundbedingungen für wirksamen Protest, auch in den Formen des zivilen Ungehorsams, gerade erst durch den demokratischen Rechtsstaat gesetzt werden. Zwar ist nicht zu bestreiten, dass es sich als ausgesprochen schwierig erweisen kann, innerhalb des Rechts eine Lösung zu finden, wenn staatlich gesetztes Recht und das „Recht“ auf zivilen Ungehorsam oder Widerstand in ein Spannungsverhältnis geraten; umso bedeutsamer ist aber gerade in derartigen Fällen die Orientierung an grundlegenden Wert- und Verfassungsentscheidungen des deutschen Grundgesetzes (I-2) und der Europäischen Charta (1.1.5) sowie die daran anknüpfende rechtsstaatliche Kontrolle durch die Gerichte (I-5).
Gewohnheitsrecht
In einem modernen Rechtsstaat wird neues Recht grds. durch einen bewussten, verfahrensmäßig geregelten Rechtsetzungsakt (geschriebenes Recht) geschaffen. Das in der angelsächsischen Rechtstradition als Common Law lange vorherrschende, früher auch im deutschen Recht bedeutsame (ungeschriebene) Gewohnheitsrecht wirkt in einigen wenigen Bereichen noch fort, öffentlich-rechtlich z. B. im Schutz des Glockenläutens. Das früher einmal in Strafverfahren (vgl. BGHSt 11, 241 ff.) gewohnheitsrechtlich anerkannte „Züchtigungsrecht“ von Lehrern und Eltern ist mittlerweile durch die Schulgesetze und § 1631 Abs. 2 BGB aufgehoben worden. Eine Vorstufe des Gewohnheitsrechts bilden die Verkehrssitten und Handelsbräuche, also im Rechts- und Handelsverkehr akzeptierte Verhaltensnormen, deren Verbindlichkeit durch das Gesetz selbst bestätigt wird (vgl. §§ 138, 157, 242 BGB, § 346 HGB). Beispielsweise gilt unter Kaufleuten das Schweigen auf ein Bestätigungsschreiben als Vertragsannahme, während das Schweigen sonst im Rechtsverkehr keine Willenserklärung darstellt. Im Sozialbereich gibt es solche rechtlich anerkannten Verkehrssitten nicht.
Genese von Rechtsnormen
War früher das Recht inhaltlich stark moralisch aufgeladen, ist es heute zunehmend zu einem formalen Steuerungsinstrument gesellschaftlicher Regelungsprozesse geworden. Für ein Naturrecht bleibt hier nicht viel Platz. Das, was Recht und was Unrecht ist, wird in einem Prozess der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit (hierauf basiert erkenntnistheoretisch der sog. Konstruktivismus), im Prozess der Rechtssetzung und in den positiv-rechtlichen Regelungen einer Rechtsordnung manifest. Nach der sog. Konsenstheorie ist das gemeinsame Rechtsbewusstsein der Gesellschaftsmitglieder die Entstehungsgrundlage von Rechtsnormen. Damit wird einerseits an das Natur- und Gewohnheitsrecht angeknüpft, andererseits an die von Jean-Jacques Rousseau (1712 –1778) begründete Vorstellung des Contrat social (Gesellschaftsvertrag), in dem sich die Mitglieder einer Gesellschaft auf gemeinsame Werte und Ziele einigen und sich diesen unterwerfen. Der soziologische Klassiker dieser Auffassung war Emile Durkheim, demzufolge die von den Bürgern anerkannten Werte mithilfe des Rechts, insb. des Strafrechts, vor ihrer Verletzung geschützt werden:
„Man darf nicht sagen, daß eine Tat das gemeinsame Bewußtsein verletzt, weil sie kriminell ist, sondern sie ist kriminell, weil sie das gemeinsame Bewußtsein verletzt. Wir verurteilen sie nicht, weil sie ein Verbrechen ist, sondern sie ist ein Verbrechen, weil wir sie verurteilen“ (Durkheim 1977, 123).
Nach der Konsenstheorie bringt die Rechtsordnung die widersprüchlichen Ansprüche und Wünsche der Menschen miteinander in Einklang, sodass sie letztlich dem Wohle der Gesamtheit dienen. Das Recht enthält alle notwendigen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens, das Strafrecht (hierzu IV) alle Regeln, die von der Allgemeinheit für so wichtig gehalten werden, dass sie mit Sanktionen ausgestattet werden, um ihre Einhaltung zu garantieren. Danach erhält das Recht selbst eine konfliktlösende Funktion. Durch die Antizipation des Konsenses ist gewährleistet, dass widerstreitende Interessen bei der Normsetzung zu einem Ausgleich gebracht werden.