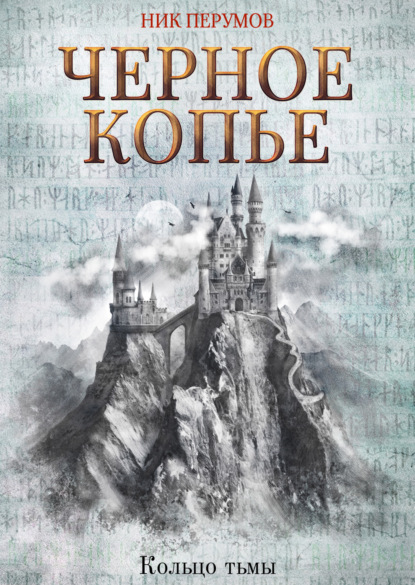- -
- 100%
- +
UN-Kinderrechtskonvention
Das UN-Übereinkommen über die Rechte der Kinder (UN-KRK vom 20.11. 1989, in Deutschland in Kraft getreten am 05.04.1992; vgl. hierzu Schorlemer / Schulte-Herbrüggen 2010) ist zunächst ebenfalls „nur“ ein völkerrechtlicher Vertrag. Die frühere Vorbehaltserklärung wurde durch die Bundesregierung am 15.07.2010 gegenüber der UN zurückgenommen, womit die Bundesrepublik Deutschland sich nun vorbehaltlos dazu verpflichtet hat, den in der UN-KRK niedergelegten Regelungen in Deutschland Geltung zu verschaffen. Die UN-KRK und die in ihr niedergelegten Prinzipien und Kinder-Grundrechte (insb. Schutz, Förderung und Entwicklung, Nichtdiskriminierung und Beteiligung) müssen nicht nur in der Kinder- und Jugendhilfe beachtet werden, sondern darüber hinaus ist nach Art. 3 Abs. 1 UN-KRK „bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, … das Wohl des Kindes,… vorrangig zu berücksichtigen“. In diesem Art. 3 UN-KRK schlummert ein gewaltiges und bislang noch weitgehend unberücksichtigtes Potenzial für die innerstaatliche Rechtsanwendung, sowohl in materiell- wie auch prozessrechtlicher Hinsicht (Cremer 2011; Lorz 2010). Es ist Pflicht und Aufgabe aller deutschen Behörden und Gerichte, dem Kindeswohlvorrang Geltung zu verschaffen, indem sie ihre Entscheidungspraxis an den Abwägungs- und Begründungserfordernissen der UNKRK ausrichten. Besonders relevant wird dies im Hinblick auf die Friktionen in der Rechtsstellung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen im Sozial- und Asylverfahrensrecht (Cremer 2006, s. III-3.4 u. III-7.3.2). Am 28.02.2013 hat Deutschland auch das Zusatzprotokoll zur UN-KRK vom 29.12.2011 ratifiziert, welches ein Individualbeschwerdeverfahren für Kinder und Jugendliche regelt, damit sie selbst die Verletzung von Kinderrechten nach der UN-KRK geltend machen können. Vorrangig ist aber der innerstaatliche Rechtsschutz. Darüber hinaus hat es sich die sog. National Coalition von mehr als 100 Organisationen und Initiativen zur Aufgabe gemacht, die Rechte der Kinder in Deutschland einzufordern.
UN-Behindertenkonvention
Das am 13.12.2006 von der UN beschlossene Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD; Resolution 61 / 106 der Generalversammlung der UN) ist in Deutschland nach Unterzeichnung (2007) und Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde am 26.03.2009 in Kraft getreten. Diese UN-Konvention zielt neben der Bestärkung der allgemeinen Menschenrechte (Recht auf Leben, Freiheit, Freizügigkeit etc.) auf eine verstärkte Selbstbestimmung, Teilhabe und damit soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen ab (Art. 3 CRPD). In Deutschland war dies bereits durch die Einführung des SGB IX im Jahr 2001 sowie durch das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Jahr 2005 (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG) rechtlich umgesetzt worden, wenn auch nur zum Teil. So wendet sich das BGG unmittelbar nur an öffentliche Träger (z. B. Benachteiligungsverbot, § 7 BGG) und verpflichtet diese im Wesentlichen nur, zur Herstellung der Barrierefreiheit (§ 4 BBG) Zielvereinbarungen mit Unternehmen oder Unternehmensverbänden zu schließen (§ 5 BGG). Hör- oder sprachbehinderte Menschen haben überdies grds. das Recht, mit Trägern öffentlicher Gewalt in deutscher Gebärdensprache oder über andere geeignete Kommunikationshilfen zu kommunizieren (§§ 6 und 9 BGG). Blinde und sehbehinderte Menschen können grds. (eingeschränkt durch eine entsprechende Rechtsverordnung) verlangen, dass ihnen z. B. Gerichtsdokumente, rechtlich relevante Bescheide und Vordrucke ohne zusätzliche Kosten in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden.
Die UN-Konvention geht über das BBG und SGB IX hinaus, begreift Behinderung nicht als ein persönliches Defizit (vgl. § 2 SGB IX), sondern vielmehr als Folge gesellschaftlicher Barrieren, die die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen be- bzw. verhindern. Zudem zielt die CRDP auf eine tatsächliche soziale Inklusion und verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, wirksame und geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen eine volle Einbeziehung (inclusion) und Teilhabe in der Gemeinschaft (participation) zu erleichtern. Dies erfordert für den einzelnen behinderten Menschen einen verbesserten Zugang zu ambulanten, gemeindenahen Unterstützungsleistungen und die Umstellung staatlicher Eingliederungshilfen in die Form eines sog. persönlichen Budgets gegenüber den öffentlichen Rehabilitationsträgern, mit dem die Selbstbestimmung des behinderten Menschen als „Kunden“ gestärkt werden soll (vgl. § 17 Abs. 2 SGB IX; hierzu s. III-5.4 zum Rehabilitationsrecht). Behinderungen dürfen kein Anlass für den Ausschluss (Exklusion) sein, insb. kein Grund für eine Freiheitsentziehung (Art. 14 CRPD; Einzelheiten hierzu in III-5) oder einer besonderen Beschulung. Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen werden deshalb künftig in allgemeinbildenden Schulen integriert (inklusiv) unterrichtet werden müssen (zur Umsetzung der CDP s. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013a u. III-5).
Darüber hinaus haben eine Reihe weiterer UN-Menschenrechtsabkommen Bedeutung für die Soziale Arbeit, die wir hier im Einzelnen nur nennen, aber nicht weiter erläutern können:
■ Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD) 1965, in Deutschland in Kraft seit 1969;
■ Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) 1979, in Deutschland in Kraft seit 1985;
■ Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT) 1984, in Deutschland in Kraft seit 1990;
■ Internationales Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen (ICRMW) vom 18.12.1990, in Deutschland noch nicht in Kraft;
■ Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen 2006, in Deutschland in Kraft seit 23.12.2010.
Europäische Sozialcharta
Schließlich wollen wir noch auf die Europäische Sozialcharta von 1961 hinweisen, in der sich die Mitgliedstaaten des Europarates zur gemeinsamen Anerkennung wesentlicher sozialpolitischer Grundsätze verpflichten. Auch die Sozialcharta ist kein unmittelbar geltendes EU-Recht, sondern eine multilateral völkerrechtliche Verpflichtung, die die Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist (ratifiziert 1964).

von Boetticher / Münder 2009; Borchardt 2015; Haltern 2017; Luhmann 1981 und 2006; Schulze et al. 2015; Wesel 1994 und 2014

www.national-coalition.de
www.institut-fuer-menschenrechte.de
www.disability-europe.net
1.1.6 Internationales Privatrecht
Auslandsbezug
Vom Begriff widersprüchlich erscheinend, ist das sog. Internationale Privatrecht (IPR) kein Teil des Völker- oder internationalen Rechts. Es ist vielmehr der in Deutschland im EGBGB geregelte Teil des nationalen (materiellen) Privatrechts, der in Fällen mit Auslandsbezug (oder sog. Auslandsberührung) bestimmt, welche nationale Rechtsordnung im Hinblick auf die zivilrechtlichen Fragen (z. B.Wirkungen der Ehe, Scheidungsvoraussetzungen, Sorgerechts- und Unterhaltsfragen) anzuwenden ist (ausführlich Ring / Olsen-Ring 2017). Davon zu unterscheiden sind die verfahrensrechtlichen Regelungen (formelles Recht), insb. die Zuständigkeit der deutschen Gerichtsbarkeit (s. nachfolgend), also ob deutsche Gerichte in diesen Streitsachen (zur Zuständigkeit der Strafgerichte vgl. Art. 1b EGStGB; §§ 3 ff. StGB; IV-1.3) überhaupt tätig werden dürfen. Letzteres wird gelegentlich als IPR im weiten Sinne bezeichnet. Beide Bereiche, das IPR im engen wie im weiten Sinn, knüpfen vorrangig an supra- und internationales Recht (insb. Europarecht, s. o. 1.1.5.1) und an internationale Abkommen (s. 1.1.5.2) an, bevor auf die Regelungen des EGBGB bzw. des GVG, der ZPO und des FamFG (hier insb. Abschnitt 9, §§ 97 ff. FamFG) zurückgegriffen wird. Das supranationale Recht verdrängt alle anderen Rechtsquellen, das internationale Recht (inklusive der vielfältigen bilateralen Abkommen) ist lex specialis gegenüber dem nationalen Recht (vgl.Art. 3 EGBGB).
Das IPR hat in Deutschland aufgrund der Einbindung in das sich vereinigende Europa und aufgrund der steigenden Zuwanderung eine zunehmende, von der Praxis vielfach unterschätzte Relevanz. Immer wenn in einem Fall irgendetwas, sei es die Staatsangehörigkeit der handelnden Personen, deren (gewöhnlicher) Aufenthalt oder der Ort des Geschehens, nicht ausschließlich deutsch ist (z. B. binationale Ehe, Heirat von Deutschen im Ausland, Anerkennung von Minderjährigenehen, grenzüberschreitende Tätigkeit der Kinder- und Jugendhilfe oder anderer Einrichtungen, Organisationen und Behörden, Aufenthalt einer deutschen Pflegefamilie im Ausland, Auslandsadoption, Arbeitsstelle oder Ferienhaus eines Deutschen im Ausland bzw. eines Nichtdeutschen in Deutschland), liegt ein Auslandsbezug vor, sodass zwingend die Zuständigkeit der nationalen Gerichte sowie die Fragen des IPR i. e. S. vorab zu klären sind, bevor man sich der inhaltlichen Lösung des Falles annehmen kann. Das IPR regelt das Verhältnis der mitunter konkurrierenden und zu unterschiedlichen Ergebnissen führenden nationalen Rechtsordnungen.
Internationale Zuständigkeit
Die sog. Brüssel-IIa-Verordnung von 2003 (Nr. 2201 / 2003 / EU) enthält Vorschriften über die Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Ehe- und Kindschaftssachen.
Nach dem Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ) von 1996 (in Deutschland seit 01.01.2011 über das IntFamRVG in Kraft) richtet sich die internationale Zuständigkeit für alle Schutzmaßnahmen für ein Kind, vor allem die Regelung der elterlichen Sorge und des Umgangsrechts bei Trennung und Scheidung der Eltern, nach dem gewöhnlichen Aufenthaltsort (= Lebensmittelpunkt) des Kindes (Art. 5 KSÜ). Für ihre Anordnungen wenden die zuständigen Behörden und Gerichte dann das Recht des Staates an, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (vgl. Art. 21 EGBGB).
Ergänzt wird das KSÜ durch das Europäische Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts vom 20.05.1980 (Europäisches Sorgerechtsübereinkommen – ESÜ), welches in Deutschland 1991 in Kraft getreten ist. Es regelt vor allem die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher oder behördlicher Sorgerechts- und Umgangsentscheidungen in Fällen von Kindesentziehung und anderen Sorgerechtsfällen.
Internationales Privatrecht i. e. S.
Das IPR im engeren Sinne betrifft materiell-rechtliche Fragen und regelt im zweiten Kapitel des EGBGB (Art. 3 – 46c EGBGB) durch sog.Kollisionsnormen (Welche Norm soll Anwendung finden?) höchst unterschiedliche Regelungsbereiche: Fragen der Rechts- und Geschäftsfähigkeit (Art. 7 EGBGB) gehören ebenso dazu wie das Namensrecht (Art. 10 EGBGB) und vor allem familien- (Art. 13 ff. EGBGB), erb- (Art. 25 ff. EGBGB) und sachenrechtliche (Art. 43 ff. EGBGB) Aspekte. Neben der Grundvorschrift des Art. 3 EGBGB über den Vorrang des supranationalen Rechts enthalten Art. 3a ff. EGBGB einige Verweisungs- und Rückverweisungsvorschriften (z. B. sog.Renvoi nach Art. 4 EGBGB). Das für die Behandlung zahlreicher Fragen maßgebende Personalstatut (Art. 5 EGBGB) wird in Deutschland durch die Staatsangehörigkeit bestimmt (hierzu III-8.5). Im 7. Abschnitt des EGBGB (Art. 46a ff. EGBGB) finden sich eine Vielzahl von besonderen Vorschriften zur Durchführung von Regelungen der EU, die nach Art. 3 EGBGB den nationalen Konkurrenzregelungen vorgehen (s. o. 1.5.1.1 und 1.5.1.2). Die sog. Rom-I-Verordnung (593 / 2008 / EU) regelt z. B. das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (nach Art. 3 Vorrang einvernehmlicher Rechtswahl). Seit Januar 2009 soll nach der sog. Rom-II-Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (864 / 2007 / EG) bei unerlaubten Handlungen i. d. R. das Recht des Staates zur Anwendung kommen, in dem der Schaden eingetreten ist. Mitte 2012 trat die sog. Rom-III-Verordnung (1259 / 2010 / EU) in allen EU-Mitgliedstaaten in Kraft, nach der im Hinblick auf das anzuwendende Recht bei Trennung von Ehen bzw. Ehescheidung stärker an den gewöhnlichen Aufenthalt und nicht vorrangig an die Staatsangehörigkeit angeknüpft wird und die insoweit auch ein (einvernehmliches) Wahlrecht der sich trennenden bzw. scheidenden Partner vorsieht. Aus einer Trennung / Scheidung resultierende Eigentums- und Unterhaltsfragen bleiben hiervon allerdings ebenso ausgeschlossen wie im Vorfeld zu klärende Aspekte (z. B. Gültigkeit der Ehe).
ordre public
Ein Beispielsfall: Das deutsch-französische Ehepaar Chantal und Fritz lebte mehrere Jahre zusammen mit seinem Kind in Jena. Die Eltern haben sich getrennt und möchten sich scheiden lassen. Nach Art. 14 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB in Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 1a Brüssel-IIa-Verordnung 1259 / 2010 / EU richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte bei binationalen Ehen nach deren gewöhnlichem Aufenthalt, hier ist also das Familiengericht in Jena zuständig (§§ 98 Abs. 1 Nr. 2, 122 Nr. 1 FamFG). Auch das im Hinblick auf die Scheidung des deutsch-französischen Ehepaars anzuwendende materielle Recht richtet sich entsprechend der Rom-III-Verordnung nach dem gewöhnlichen Aufenthalt, mithin ist das deutsche Recht anzuwenden. Anders ist dies z. B., wenn beide Ehepartner gleicher, nicht deutscher Staatsangehörigkeit sind. Dann kann es sein, dass das deutsche Gericht aufgrund der Regelungen des IPR das ausländische Privatrecht welchen Staates auch immer anwendet (mitunter auch die islamische Scharia; hierzu Muckel 2003; Rohe 2009 und 2011). Dies ist in Bezug auf Staaten der Fall, in denen die Scharia ausdrücklich als Rechtsquelle anerkannt ist (z. B. Ägypten, Bahrein, Jemen, Kuweit, Sudan, Syrien); darüber hinaus wird z. B. in Afghanistan, Saudi-Arabien und Pakistan die Scharia − von Ausnahmen in einzelnen Rechtsbereichen abgesehen – sogar mit der Rechtsordnung gleichgesetzt (Elger / Stolleis 2008/2017). Demgegenüber orientiert sich z. B. das Familienrecht der Türkei nicht an der Scharia, sondern am schweizerischen Familienrecht. Rein religiöse Normen, die nicht (auch) in staatliches Recht übernommen worden sind, können im Rahmen des IPR keine Geltung beanspruchen, allerdings durchaus unter Berücksichtigung der Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 2 GG) im Alltagshandeln gelebt werden, sofern dabei das deutsche Recht nicht verletzt wird (grds. nicht zulässig z. B. rituelles Schlachten / Schächten im Hinblick auf § 4 Tierschutzgesetz, möglich aber Ausnahmegenehmigung; Verbot der Doppelehe / Polygamie, § 172 StGB).
Aus dem IPR alleine ergibt sich schon die Bereitschaft des deutschen Gesetzgebers, die Regelungen anderer Staaten (also „fremdes Recht“) anzuerkennen, auch wenn sie im Ergebnis zu einer anderen Rechtsfolge als das deutsche Recht führen. Es gilt der international akzeptierte Grundsatz, dass das Recht zur Anwendung kommen soll, zu dem die Betroffenen den engsten Bezug haben, auch wenn der Aufenthaltsort (nur vorübergehend) gewechselt wird. Allerdings ist dies in einer Zuwanderungsgesellschaft problematisch für Menschen, die ihrer alten nationalen Rechtsordnung gerade entfliehen wollen. Nach Art. 6 EGBGB ist allerdings unter dem Begriff „ordre public“ eine Rechtsnorm eines anderen Staates nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung im konkreten Einzelfall zu einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist (vgl. z. B. BGH 06.10.2004 – XII ZR 225 / 01 – FamRZ 2004, 1952 für den Iran). Sie ist insb. nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten (hierzu 2.2) und Rechtsgrundsätzen unvereinbar ist. Nur in diesen extremen Fällen findet dann ersatzweise das deutsche Recht Anwendung.
Bundesamt für Justiz
Als zentrale Dienstleistungsbehörde der Bundesjustiz sowie als Anlaufstelle und Ansprechpartner für den internationalen Rechtsverkehr wurde 1997 das Bundesamt für Justiz (BfJ) in Bonn errichtet. Auf dessen Internetseite (http://www.bundesjustizamt.de ➝ Bürgerdienste ➝ Internationales Sorgerecht, 27.06.2017) findet man Formulare auf Deutsch und in zahlreichen anderen Sprachen für einen Antrag auf Kindesrückführung, Durchsetzung eines grenzüberschreitenden Umgangsrechts oder Anerkennung einer Sorge- oder Umgangsrechtsentscheidung.

Borchardt 2015; Pasche 2013; Schulze et al. 2015; Sievers / Bienentreu 2006
1.2 Recht und Gerechtigkeit
1.2.1 Zur Problemstellung
Nicht wenige, vielleicht sogar die meisten der in der Sozialen Arbeit beschäftigten Menschen finden einen Zugang zu ihrem Beruf gerade auch über die Thematisierung von Gerechtigkeitsfragen. Die Motive hierfür und die Standpunkte, die dabei eingenommen werden, können naturgemäß sehr unterschiedlich sein. Sie reichen von Gerechtigkeitsvorstellungen, die sich an der Ethik des Christentums orientieren, über eine durch individuelle Erfahrung erworbene Fähigkeit, an der Not des anderen tätig Anteil zu nehmen, bis hin zu politisch begründeten Gerechtigkeitsüberzeugungen, wie sie sich etwa innerhalb der aktuellen sozialen Bewegungen artikulieren. Doch ganz gleich, ob dabei in kämpferischer Weise auf der Schaffung einer neuen, gerechteren Weltordnung bestanden oder der eher stillen Sehnsucht Ausdruck verliehen wird, im mühseligen Kampf gegen die Folgen sozialer Ungleichheit möge gelegentlich ein wenig mehr Gerechtigkeit obwalten – eine allgemeine Skepsis in Bezug auf die Möglichkeiten des Rechts, einen wirksamen Beitrag zur Herstellung von Gerechtigkeit zu leisten, wird dabei zumeist nicht unbemerkt bleiben können. „Gerechtigkeit und Recht“, so hört man immer wieder von Studierenden an Fachbereichen für Soziale Arbeit, „das sind zwei verschiedene Dinge“.
Und in der Tat: Wenn G.F.W. Hegel formuliert, dass das Recht das sei, „was gleichgültig gegen die Besonderheit bleibt“ (Hegel 1821, § 49), so ist hierin möglicherweise schon ein Hinweis auf die Veranlassung einer solchen Attitüde enthalten. Bereits auf den ersten Blick legt eine derartige Charakterisierung nämlich schon mindestens zwei Eigenschaften von Recht nahe, die bei Menschen Befremden auszulösen vermögen, deren professionellem Selbstverständnis es entspricht, Empathie für ihre Mitmenschen zu entwickeln, sie also in ihrer jeweiligen Individualität anzunehmen. Das Problem steckt in dem Begriff „gleichgültig“. Dieser verweist nämlich zum einen auf eine Bedeutung im Sinne von „desinteressiert“. Und tatsächlich zeigt sich das Recht der individuellen Biografie des Einzelnen, seiner Besonderheit, wie Hegel es formuliert, gegenüber weitgehend desinteressiert: Nicht das konkrete Individuum in seiner jeweiligen psychosozialen Existenz, sondern eine abstrakte Rechtsperson ist das Subjekt im Recht. Zum anderen ist mit ihm aber auch angesprochen, dass das Recht unbeschadet aller je individuellen Besonderheit für jeden Einzelnen „gleich gültig“, also gleichermaßen gültig ist. Eine Gleichbehandlung von in ihrer sozialen Wirklichkeit erkennbar ungleichen Menschen jedoch wird im Ergebnis immer wieder auch soziale Ungleichheitsverhältnisse auf neuer Ebene entstehen lassen. Genau dies aber lässt es gerade sozial Engagierten wenig einleuchtend erscheinen, dass es sich hierbei um einen Vorgang handeln könnte, der auch noch in besonderer Weise als gerecht zu attribuieren wäre.
1.2.2 Gerechtigkeit und Gleichheit – die (rechts)philosophische Ausgangsfrage
Legitimität von Recht
Und doch ist es so, dass sich die Gerechtigkeitsdiskurse im Recht nun seit alters her um die Gleichheitsfrage drehen. Zwar ist der Dreh- und Angelpunkt des Rechts nach ganz vorherrschender Ansicht der von ihm ausgehende Zwang, soziale Verhältnisse nach seinen normativen Vorgaben zu gestalten (vgl. 1.1.1) – ein Zwang, der durch Verwaltungsbehörden mit polizeilichen Befugnissen, Justiz und Vollstreckungsorgane, den sog. Rechtsstab, abgesichert ist. Max Weber etwa bezeichnet diesen Erzwingungsstab als das entscheidende Kennzeichen von Recht (Weber 1921, 18, 185). Wird jedoch den Mitgliedern einer Gesellschaft auf Dauer zugemutet, sich einem derartigen Zwang zu unterwerfen, so bedarf dies einer für sie nachvollziehbaren, also mit ihrer Lebenswirklichkeit verbundenen Begründung dafür, weshalb dies so sein soll. Es geht dann also um die Legitimität von Recht. Genau an diesem Punkt entscheidet sich bereits, ob und inwieweit Recht überhaupt mit Gerechtigkeitsinhalten, -erwartungen oder -forderungen in Zusammenhang gebracht werden kann. Die Antwort auf die Frage nach der Legitimität von Recht kann nämlich einmal rein formal gegeben werden: Rechtsnormen müssen eingehalten werden, weil sie Rechtsnormen sind. Zur Begründung wird dann lediglich noch angeführt, dass diese Normen aus anderen Normen abgeleitet sind, etwa aus denen, die den Gang des verfassungsmäßig vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahrens festlegen. Dies kann man so lange fortführen, bis man schließlich zu einer – dann nicht mehr empirisch begründbaren – Grundnorm gelangt (Kelsen 1960, 196). „Legitimität durch Legalität“ wird dies genannt. Aber auch die Weiterführung dessen in der „Legitimation durch Verfahren“, wo Recht wesentlich auf Funktionalität reduziert ist (Luhmann 1981, 133; 2006), benutzt derartige rein formale Argumente. Die Gerechtigkeit wird in beiden Fällen als Legitimationsgrundlage des Rechts nicht benötigt.
Gleichheit der Person
Eine andere Perspektive eröffnet sich hingegen, sobald der soziale Kontext des Rechts mit in den Blick genommen wird, in dem sich seine gesellschaftliche Wirklichkeit erst konstituiert. Für Gustav Radbruch war Recht nicht nur der „Inbegriff der generellen Anordnungen für das menschliche Zusammenleben“, sondern auch „die Wirklichkeit, die den Sinn hat, der Gerechtigkeit zu dienen“ (Radbruch 1932, 34). Infolgedessen geht es dann bei der Begründung der Geltung von Recht, wie etwa auch bei Max Weber, um eine allgemeine Überzeugung von dessen Richtigkeit (Weber 1921, 181). Eine solche Form des Allgemeinen aber kann sich dem Inhalt nach zumindest in modernen, nicht auf personalen Herrschafts- bzw.Abhängigkeitsverhältnissen beruhenden Gesellschaften immer nur auf die Anerkenntnis der Gleichheit der Personen, deren prinzipielle Gleichwertigkeit und einen daraus resultierenden Gleichbehandlungsanspruch beziehen (zu Art. 3 GG vgl. 2.1.2.4). Rechtsphilosophen, die, wie etwa Gustav Radbruch, die Gerechtigkeit als die „Idee des Rechts“ schlechthin begreifen (Radbruch 1932, 34), kommen daher folgerichtig zu dem Ergebnis, dass genau dieser Gedanke der Gleichheit den „Kern der Gerechtigkeit“ ausmacht (Radbruch 1910, 37 – Hervorhebung im Original).
Recht und Moral
Die unterschiedlichen Problemansätze etwa bei Weber und Radbruch auf der einen und Kelsen und Luhmann auf der anderen Seite resultieren daraus, dass die Gerechtigkeitsfrage an einem Übergangsbereich von Recht und Moral angesiedelt ist (vgl. 1.1.2). Der Zugang zu ihr hängt demzufolge davon ab, ob man überhaupt einen derartigen Berührungspunkt theoretisch akzeptiert – bei Hans Kelsen und Niklas Luhmann ist dies erkennbar nicht der Fall – bzw. an welcher Stelle man ihn verortet. Allgemein gesprochen geht es also darum, ob und in welchem Maße Freiheit und ein friedliches, sicheres und geordnetes Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft (Recht) als notwendige Elemente eines guten und richtigen, d.h. auch gerechten Lebens (Moral) begriffen werden. Umgekehrt lautet die Frage, ob und in welchem Maße Freiheit, sozialer Frieden und Sicherheit außerhalb bestimmter sozialer Strukturen, die als gerecht bezeichnet werden können, überhaupt gesellschaftliche Realität zu beanspruchen imstande sind.
ausgleichende/austeilende Gerechtigkeit
In der Rechts- und Sozialphilosophie gibt es durch die Jahrhunderte hindurch kaum einmal einen Beantwortungsversuch zu dieser Frage, ohne dabei zumindest in irgendeiner Weise auf das zu reflektieren, was Aristoteles hierzu im V. Buch seiner Nikomachischen Ethik (330 v. Chr.) entwickelt hat. In ihr finden wir die berühmte Unterscheidung zwischen ausgleichender (kommutativer) und austeilender (distributiver) Gerechtigkeit. Die ausgleichende Gerechtigkeit wird auch in heutigen Darstellungen noch immer wieder gern anhand des bekannten Symbols der Göttin Justitia, der Waage, verdeutlicht. Ist zwischen beiden Waagschalen ein Ausgleich hergestellt, liegt also in jeder der beiden Schalen gleich viel, dann ist Gerechtigkeit hergestellt: Der Ware in der einen Schale entspricht der Preis in der anderen, dem Schaden in der einen der Schadensersatz in der anderen usw. Die austeilende Gerechtigkeit hingegen sorgt für eine verhältnismäßige Gleichbehandlung einer Mehrzahl von Personen durch eine verteilende Instanz. Der Unterschied zur ausgleichenden Gerechtigkeit ist demnach folgender: Bei der Letztgenannten geht es um eine arithmetische Gleichheit, wie sie typischerweise aus dem Austausch von Äquivalenten resultiert: Ein Brot gleich 2 €; wer mehr verlangt oder weniger geben will, verletzt das Gerechtigkeitsprinzip. Demgegenüber stellt die austeilende Gerechtigkeit eine geometrische Gleichheit her. Das Gesetz weist hier jedem das zu, was für ihn aufgrund bestimmter Kriterien, die häufig unter den Begriffen Leistung oder Verdienst zusammengefasst werden, aber natürlich auch das genaue Gegenteil hiervon bedeuten können, angemessen ist. Die Güter werden also proportional zu den erbrachten Leistungen verteilt: Wer mehr leistet, soll auch mehr bekommen. Oder auch: Wer leistungsfähiger ist, soll auch stärker (z. B. mit Steuern) belastet werden (vgl. hierzu Ritsert 1997, 23 f.). Auch hier erfolgt also eine Gleichbehandlung (etwa aller Personen mit einem bestimmten Einkommen, aller Familien mit Kindern oder aller Alg-II-Bezieher). Jedoch wurde der Maßstab dafür, wer in welcher Hinsicht als gleich zu betrachten und zu behandeln sei, unter sozialen Gesichtspunkten gewonnen und zur Anwendung gebracht. Die ausgleichende Gerechtigkeit hat demnach – idealtypisch betrachtet – als Minimum zwei Personen zur Voraussetzung, die rechtlich gleichgeordnet sind. Die austeilende Gerechtigkeit hingegen benötigt noch einen Dritten, nämlich die öffentliche Gewalt, die einen konkreten Gleichheitsmaßstab aus der jeweiligen geschichtlichen (d. h. sozial, ökonomisch, politisch, kulturell usw.) geprägten Situation heraus festlegt und zur Anwendung bringt. Auch die gleiche Rechtsstellung in ihrer abstraktesten Form als Person wird demnach den Beteiligten erst einmal zugeteilt. Deshalb auch hat Radbruch die austeilende Gerechtigkeit, das suum cuique tribuere („Jedem möge das Seine zuteilwerden“), wie es der römische Rechtsgelehrte Domitius Ulpianus (170 – 228 n. Chr.) auf eine berühmt gewordene Formel gebracht hat, als die Urform der Gerechtigkeit verstanden. Die ausgleichende Gerechtigkeit hingegen ist nur eine abgeleitete Form von ihr (Radbruch 1910, 37).