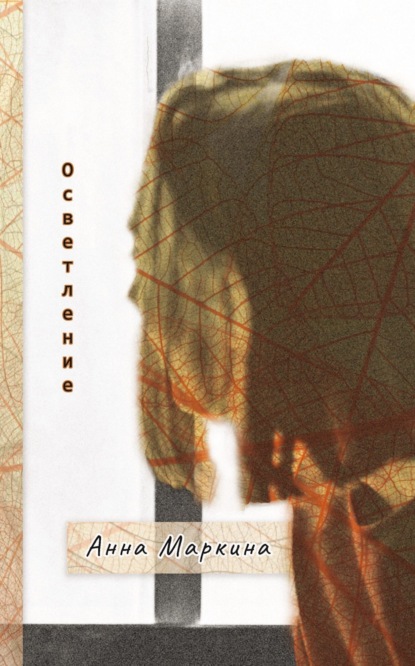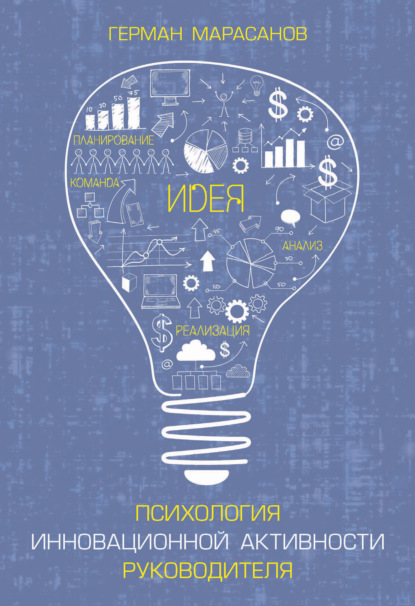- -
- 100%
- +
Dieser Befund nun impliziert bereits eine Reihe von grundlegenden Annahmen zur Gerechtigkeitsproblematik, die zunächst einmal in einer Art Zwischenergebnis festgehalten werden sollen:
1. Geht es bei der konkreten Beantwortung der Gerechtigkeitsfrage um die Festlegung darauf, unter welchem Aspekt, in welcher Hinsicht, inwieweit Menschen als Gleiche zu betrachten und zu behandeln sind, so wird hierbei zugleich immer auch eine Wertung darüber getroffen, welche faktischen (sozialen) Ungleichheitsaspekte dabei unbeachtet bleiben und demzufolge als gerechtigkeitsirrelevant behandelt werden sollen. Hier wird im sozialen Vorgang nur deutlich, was bereits begriffslogisch vorgegeben ist: Wir können von Gleichheit nicht sinnvoll sprechen, ohne zu sagen, von welchen Verschiedenheiten, Un-Gleichheiten also, wir dabei abstrahieren.
2. Genau das ist auch ein ganz wichtiger Erklärungsansatz dafür, weshalb unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen und mit unterschiedlichen sozialen, ökonomischen und politischen Interessen unterschiedliche Wertungen darüber abgeben, was als gerecht gelten soll. Natürlich wurden diese Wertungen dann auch in ihre jeweiligen philosophischen Gebilde mit hineintragen. Die Frage, ob Gerechtigkeit eine Kategorie universellen oder relativen Inhalts ist, formuliert daher (wie in der Philosophie regelmäßig, wenn man in vermittlungslosen gesellschaftsabgehobenen Gegensätzen denkt) eine Scheinalternative. Denn der universelle normative Inhalt der Gerechtigkeit, die Gleichheit, vermittelt sich stets innerhalb der Wirklichkeit konkreter sozialer Handlungskomplexe. Oder anders herum: Gerechtigkeit ist eine gesellschaftlich-historische Kategorie, die über einen universellen ethischen Kern – die Idee der Gleichheit – verfügt.
3. Selbst dann, wenn sich unser Interesse primär auf die Gerechtigkeit im engeren, formalrechtlichen Sinne richtet, kommen wir an der Kenntnisnahme ihres gesellschaftlichen Hintergrundes nicht vorbei. Denn von diesem sozialen Kontext hängt es letztlich ab, welche jeweilige konkrete Bedeutung der Satz in einer Gesellschaft hat, dass die Menschen gleich und als Gleiche zu behandeln seien.
1.2.3 Rechtliche und soziale Gerechtigkeit
Bereits diese Ableitungen unmittelbar im Anschluss an das aristotelische Gerechtigkeitsmodell legen nahe, dass es innerhalb des Gerechtigkeitsdiskurses offenbar darum geht, eine bestimmte soziale Spannung zu bearbeiten, nämlich die zwischen Gleichheit und Ungleichheit. Es kommt jedoch noch als weiteres Spannung erzeugendes Moment hinzu, dass sich bereits die oben skizzierten theoretischen Grundannahmen zur Gerechtigkeit regelmäßig an der Realität der politischen und sozialen Strukturen reiben. Dies war im Übrigen schon zur Zeit des Aristoteles so, wo die austeilende Gerechtigkeit eben keinesfalls erst einmal jedem Angehörigen der Polis eine abstrakt gleiche Rechtsstellung zuwies, sondern umstandslos Differenzierungen nach gesellschaftlicher Stellung, Geschlecht und Herkunft voraussetzte. Aus heutiger Sicht viel entscheidender ist jedoch, dass auch in der Realität des modernen westlichen Kapitalismus sozialstaatlicher Prägung die beiden Pfeiler der Gerechtigkeitskonstruktion – kommutative und distributive Gerechtigkeit – keineswegs auf unerschütterlichen empirischen Fundamenten stehen. Der konstitutive Bestandteil der kommutativen Gerechtigkeit nämlich, der „freie und gerechte Tausch“, darf zweifellos zu den „Kernlegenden des okzidentalen Kapitalismus“ (Ritsert 1997, 52) gezählt werden. Denken wir in diesem Zusammenhang nur an die zumindest im Jahr 2013 in Deutschland wiederum gesunkenen Reallöhne (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 437 v. 19.12.2013) gerade auch in sozialen Berufen bei (mindestens) gleichbleibendem Einsatz von Arbeitskraft. Und für die zentrale Kategorie der distributiven Gerechtigkeit, die Leistung, wird man vergeblich nach einer klaren Definition suchen, handelt es sich hierbei doch um einen politisch heftig umkämpften Begriff. Die Debatte um den sog. aktivierenden Sozialstaat hielte hierfür eine Reihe von Beispielen bereit.
Das aristotelische Gerechtigkeitsmodell wirft also zunehmend mehr Fragen auf, als es beantwortet. Dies ist nicht zuletzt deshalb so, weil das eingangs formulierte Problem des Verhältnisses zwischen gleichen rechtlichen Regeln für alle und einer damit verbundenen rechtlichen Gleichbehandlung einerseits und der moralischen Bewertung dieses Ergebnisses andererseits heute noch viel differenzierter besteht und dabei mitunter scharfe Gegensätze zwischen dem einen und dem anderen zum Ausdruck bringt: Wie etwa wäre die vieldiskutierte Steuergerechtigkeit herzustellen, wie eine gerechte Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme? Wie ist unter Gerechtigkeitsaspekten („Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“) das unterschiedliche Lohnniveau zwischen Ost und West zu interpretieren, wie die immer noch unterschiedlichen Lohneingruppierungspraxen bei Frauen und Männern? In welchem Umfang und in welcher Weise soll eine Verteilung nach der Leistung die unterschiedliche Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Menschen berücksichtigen und ggf. kompensieren? Es sind dies alles Fragen danach, welche Fallgruppen zu bilden wären, innerhalb derer intern eine Gleichbehandlung erfolgte, für die extern aber ein entsprechender Ausgleich zu schaffen wäre. Weiterhin ist damit nach den Kriterien gefragt, nach denen die einzelnen Menschen dann den entsprechenden Gruppen zuzuordnen wären. Spiegelbildlich stellt sich auf der Seite der Verteilung der Güter die Frage, welche Güter in welchem Umfang einer gleichen Verteilung unterliegen sollen. Sicher nicht alle, denn das Ergebnis wäre gleichermaßen absurd wie ungerecht.
All diese Fragestellungen, die im Übrigen auch für eine seit einiger Zeit zu konstatierende Tendenz stehen, Gerechtigkeitsfragen auch in der öffentlichen Debatte wieder verstärkt zu thematisieren, verweisen im Grunde auf eines: Sie zeigen, dass sich das Interesse der Teilnehmer an dieser Debatte keinesfalls schon in knappen Antworten auf juristische Gerechtigkeitsfragen erschöpft, sondern sich vor allem auf eine in einem weiteren Sinne soziale Gerechtigkeit richtet. Dies ist durchaus nachvollziehbar. Denn der Göttin Justitia mag man noch zugestehen, dass die Binde vor ihren Augen einigermaßen fest sitzt – obgleich man ihr durchaus auch den einen oder anderen Blick auf die soziale Wirklichkeit wünschen kann. Soziale Ungleichheit hingegen ist allenthalben mit Händen zu greifen und es stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen dann soziale Verhältnisse dennoch als gerecht beschrieben werden können und ob und in welcher Weise das Recht hierbei überhaupt mit heranzuziehen wäre.
Verteilungsgerechtigkeit und Aneignungsungerechtigkeit
Analysiert man diese Art von Fragestellungen, so zeigt sich, dass sie alle auf eine ganz bestimmte Ebene gesellschaftlicher Interaktion, nämlich die des Austausches von Gütern und Leistungen, gerichtet sind. Natürlich ist ein solcher Rekurs durchaus erst einmal naheliegend, denn er betrifft eine Gesellschaft, in der die sozialen Beziehungen der Menschen wesentlich über den Austausch von Waren und Geld, den sachlichen Austausch von Dingen, vermittelt sind. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob die Gerechtigkeitsproblematik innerhalb einer streng auf die Distributionssphäre ausgerichteten Perspektive wirklich voll ausgeleuchtet werden kann. Karl Marx’ Argument hierzu lautet, dass die Gleichheit der Menschen innerhalb der Verteilungsprozesse lediglich eine Folge ihrer Ungleichheit innerhalb der Aneignungsprozesse sei (Marx 1857, 167 f.). Wolle man daher die Gleichheit in der Verteilung verstehen, müsste zunächst die Ungleichheit bei der Aneignung erklärt sein. Hierbei aber fiele dann sofort auf, dass diese in ihrer geschichtlichen Entstehung und Wirkung regelmäßig an personale oder sachliche Macht- und Herrschaftsarrangements gebunden war – von der Versklavung von Menschen und der Okkupation fremder Territorien über die „Einhegungen“ von Gemeindeland etwa in England zur Zeit des Hochmittelalters bis zur ökonomischen Ausnutzung sachlicher Abhängigkeitsverhältnisse zur Aneignung von ökonomischen Werten, die andere geschaffen haben. Mit anderen Worten: Wir begegnen Aneignungsungerechtigkeiten regelmäßig in der Form des Erwerbs von Eigentum durch Enteignung. Dies alles vollzieht sich übrigens keineswegs in einem rechtsindifferenten Raum, denn, um das Bild der Göttin ein letztes Mal zu bemühen: Justitia hält nur in einer Hand die Waage, in der anderen aber hält sie das Schwert!
Was bedeutet es nun aber für die Bildung von Gerechtigkeitstheorien, wenn solche tragenden gesellschaftlichen Konstruktionselemente wie Aneignung und Eigentum einerseits und Macht und Herrschaft andererseits in ihnen weitgehend unthematisiert bleiben? Die Annahme liegt nahe, dass sich dies, wie wir bereits gesehen haben, in bestimmten Erklärungsdefiziten niederschlägt. Für Ungerechtigkeiten jedenfalls, „die dem Kontext von Macht und Appropriation (der Arbeitskraft, der Arbeitsprodukte, des Körpers und Willens) anderer Subjekte entstammen“, stellt auch für Jürgen Ritsert der klassische Akzent auf Verteilung, Anteiligkeit und Verteilungsalgebra keine ausreichende Perspektive dar (Ritsert 1997, 74 f.).
Mit der Kenntnisnahme von Ungerechtigkeiten in der Aneignungssphäre sind zugleich auch Erwartungen an die rechtliche Gerechtigkeit in eine realistische Perspektive gerückt. Denn es muss sich selbstredend auch in der normativen Forderung, gerecht zu tauschen, in irgendeiner Weise und an irgendeiner Stelle bemerkbar machen, wenn der Verteilung der Güter ungerechte Aneignungsverhältnisse vorausgehen. Jedoch ist es nicht nur so, dass die rechtliche Gerechtigkeit durch die Aneignungsungerechtigkeit faktisch begrenzt wird. Auf der anderen Seite verleiht sie ihr gleichzeitig auch eine gewisse gesellschaftliche Stabilität. Gerade die Analyse von Marx zeigt nämlich, dass die Gleichheit bei der Verteilung nichts anderes ist als eine spezifische Wahrnehmungsform der Ungleichheit in den Aneignungsverhältnissen (Marx 1857, 168 ff., 575). Dies aber bedeutet dann auch, dass Ungerechtigkeiten bei der Aneignung auf der Verteilungsebene in eben jenen rechtlichen Gleichheitsbeziehungen wahrnehmbar sind, die ihrerseits aber als gerecht gelten und deshalb insoweit für ein höchstmögliches Maß an gesellschaftlicher Akzeptanz sorgen.
Sind Gerechtigkeitsfragen in derartiger Weise gewendet, kann man in sie allerdings auch dann analytische Schärfe und damit durchaus ein kritisches Potenzial hineinlegen, wenn sie üblicherweise an der Verteilungsproblematik ansetzen.
Chancengleichheit
Dies versuchen die aktuellen Gerechtigkeitsdiskurse vornehmlich in einem Rekurs auf die Chancengleichheit. Auch hierbei geht es ja im Kern um Austauschprozesse mit dem Ziel der Umverteilung von Gütern und Leistungen zum Zweck der Kompensation ungleicher Ausgangsbedingungen. Ob und inwieweit damit jedoch wirklich der erhoffte Durchbruch in der Frage nach der sozialen Gerechtigkeit gelungen ist, muss offen bleiben. Denn zunächst wäre einmal zu entscheiden, was mit Chance und was mit Chancengleichheit gemeint sein soll: Eine Chance kann in einer tatsächlichen Gelegenheit bestehen, das zu erhalten, was man angestrebt oder gewünscht hat, aber auch darin, dass eine bestimmte Wahrscheinlichkeit besteht, dass der angestrebte Erfolg eintritt. Chancengleichheit wiederum kann man in Bezug auf die Lebensaussichten oder auch mit Blick auf den Mittelgebrauch zur Erreichung eines Ziels annehmen (Ritsert 1997, 81). Das Problem ist also, dass Chance und Chancengleichheit über keine hinlänglich ausgeprägte begriffliche Schärfe verfügen. Um es in der praktischen Konsequenz deutlich zu machen:

In der Bundesrepublik stehen weiterführende Schularten und höhere Bildungseinrichtungen den Kindern aus allen sozialen Schichten gleichermaßen offen. Verfügen Eltern über ein weniger hohes Einkommen, so erhalten ihre Kinder für die Zeit ihres Studiums sogar eine staatliche Ausbildungsförderung. Dennoch besteht, wie es der Bildungssoziologe Wulf Hopf formuliert, eine „auffällig enge Koppelung des Bildungserfolgs an den Schichtstatus der Familie“ (Hopf 2010, 21). Besteht also eine Gleichheit der Bildungschancen in Deutschland?
Das Nachdenken darüber, wie diese und viele ähnliche mehr oder weniger vertrackten Gerechtigkeitskonstellationen theoretisch wie praktisch aufgelöst werden können, bringt uns jenes Spannungsverhältnis zu Bewusstsein, in dem sich der Einzelne mit seinen je individuellen Freiheitsansprüchen und die Gesamtgesellschaft mit ihrem Bedürfnis nach einem für ihre innere Stabilität jeweils notwendigen Maß an Gleichheit / Gerechtigkeit zueinander befinden. Um es an den idealtypisch konstruierten Extremfällen (vgl. auch Radbruch 1932, 67) deutlich zu machen: In einer anarchistisch, radikal-liberal verfassten Gesellschaft mag der Einzelne über ein Höchstmaß an individueller Freiheit verfügen; eine gesellschaftliche Bindung, wie sie von Gleichheit und Gerechtigkeit ausgeht, wird man in ihr jedoch weitgehend vermissen. Umgekehrt verfügen sozialistische Gesellschaften leninistischer oder maoistischer Provenienz über eine vergleichsweise große gesellschaftliche Homogenität, also Gleichheit, jedoch kaum über individuelle Freiheiten für ihre Bürger.
Capability Approach
Eine Auflösung dieses Dilemmas wird aktuell vor allem vom sog. Fähigkeitsbzw. Verwirklichungsansatz (Capability Approach) erwartet, der u. a. auf den Ökonomen Amatya Sen und die Sozialphilosophin Martha Nussbaum zurückgeht. Begründet sind derartige Erwartungen dadurch, dass in diesem Ansatz der Chancengleichheits- und der Freiheitsaspekt insoweit zusammengeführt sind, als Freiheit als Chance der Menschen verstanden wird, jene Ziele verfolgen zu können, die sie sich vernünftigerweise gesetzt haben. Chancen hängen daher eng mit ihren individuellen, freilich sozial geprägten Fähigkeiten zusammen, also damit, wie die Befähigung einer Person beschaffen ist, „die Dinge zu tun, die sie mit gutem Grund (Hervorhebung d. Verf.) hochschätzt“ (Sen 2010, 253 ff. u. 259). Es ist dies nicht der Ort, den Capability Approach, der vor allem auch innerhalb entwicklungspolitischer Diskurse eine herausragende Bedeutung erlangt hat, einer umfassenden Kritik zu unterziehen. Unter den hier relevanten Gesichtspunkten soll es genügen, darauf hinzuweisen, dass der Fähigkeitsansatz selbst nach Einschätzung seiner Protagonisten zwar sagt, was unter seinen Gesichtspunkten gerecht oder ungerecht ist, er aber keinen entscheidenden Anknüpfungspunkt für die institutionelle Verankerung von Gerechtigkeitsregeln bietet (Sen 2010, 260). Eindrucksvoll macht Sen dies in seinem mittlerweile schon bekannten Gleichnis von den drei Kindern und der Flöte deutlich. In ihm geht es darum, unter Gerechtigkeitsaspekten zu entscheiden, welches der drei Kinder die eine zur Verfügung stehende Flöte bekommen soll. Jedes der Kinder hat gute Gründe, sie für sich zu beanspruchen: das erste, weil es die Flöte hergestellt hat, das zweite, weil keines der beiden anderen Kinder auf ihr zu spielen vermag, und das dritte, weil es als einziges von den dreien so arm ist, dass es, bekäme es die Flöte nicht, kein anderes Spielzeug besäße (Sen 2010, 41 ff.). Es liegt auf der Hand, dass es für eine derartige Konstellation nicht die Lösung, sondern immer nur gute Argumente für eine der Optionen (und damit zugleich gegen die beiden anderen) geben kann.
Gerechtigkeit als Fairness
Die nach wie vor wohl einflussreichste Gerechtigkeitstheorie innerhalb der sozialtheoretischen Diskurse stammt von dem 2002 verstorbenen amerikanischen Moralphilosophen John Rawls, der sie erstmals 1971 als „A Theory of Justice“ (dt.: Rawls 1979) vorlegte. Ihre außerordentliche Anziehungskraft verdankt sie vor allem dem Umstand, dass sie die liberale Freiheitsidee und die sozialstaatliche Idee des Ausgleichs sozialer Ungleichheit zumindest im Ansatz auf institutioneller Ebene zusammenbringt. Sie bietet damit nicht nur gemeinsame Anknüpfungspunkte für ansonsten recht unterschiedliche politische Strömungen und theoretische Denkrichtungen, sondern zielt eben auch und vor allem sehr genau auf konkrete Gerechtigkeitspotenziale (und -defizite!) moderner Gesellschaften. Auf den Punkt gebracht ist sie in zwei Gerechtigkeitsprinzipien, die in einem Neuentwurf, der 2001 unter dem Titel „Justice as Fairness“ erschien, wie folgt lauten (Rawls 2003, 78):
a) Jede Person hat den gleichen unabdingbaren Anspruch auf ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten, das mit demselben System von Freiheiten für alle vereinbar ist.
b) Soziale und ökonomische Ungleichheiten müssen zwei Bedingungen erfüllen: erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die unter den Bedingungen fairer Chancengleichheit allen offen stehen; und zweitens müssen sie den am wenigsten begünstigten Angehörigen der Gesellschaft den größten Vorteil bringen (Differenzprinzip).
Vervollständigt werden diese beiden Prinzipien noch durch zwei Vorrangsregeln. Die eine lautet, dass das erste Prinzip gegenüber dem zweiten Vorrang hat. Weiterhin hat innerhalb des zweiten Prinzips die Chancengleichheit Vorrang vor dem Differenzprinzip (Rawls 2003, 78). Diese Gerechtigkeitskonzeption soll Basisnormen für eine gerechte Gesellschaft aufstellen und begründen, die von der Ausgangsfrage her formulieren sollen, was „freie und vernünftige Menschen in ihrem eigenen Interesse in einer anfänglichen Situation der Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung annehmen würden“ (Rawls 1979, 28). Deshalb auch muss in ihr das Freiheitsprinzip Vorrang haben, weil nämlich erst die Gleichheit der politischen Freiheit und der Gedankenfreiheit den Bürgern die Möglichkeit geben zu bestimmen, wie die Gerechtigkeitsstruktur ihrer Gesellschaft gestaltet sein soll (vgl. Rawls 2003, 81 f., 130 f.).
Im zweiten Prinzip wird das Problem der Verteilungsgerechtigkeit formuliert. Es besteht darin, wie „langfristig und generationenübergreifend ein faires, leistungsfähiges und produktives System der Kooperation aufrechterhalten werden kann“ (Rawls 2003, 88). Hierauf gibt Rawls zwei Antworten: Zunächst durch eine faire Chancengleichheit nicht nur in dem Sinne, dass öffentliche Ämter und soziale Positionen formal allen gleichermaßen offenstehen, sondern darüber hinaus, dass alle eine faire Chance haben sollen, diese Ämter und Positionen auch tatsächlich zu bekleiden. Die institutionelle Herstellung einer derartigen Chancengleichheit stellt sich Rawls konsequenterweise wiederum marktförmig vor (Rawls 2003, 79 f.). Soziale und ökonomische Ungleichheit zwischen Menschen, die im Ergebnis hieraus entsteht, ist dann nicht ungerecht, denn sie ist nicht nur „nötig oder überaus effizient (…), wenn es darum geht, im Rahmen eines modernen Staates die Wirtschaftsordnung funktionsfähig zu erhalten“, sondern zudem auch moralisch gerechtfertigt, insofern als diejenigen, die ihre Chancen besser genutzt haben als andere, höhere Ansprüche auch tatsächlich verdient haben (Rawls 2003, 128 f.).
Während das erste Gerechtigkeitsprinzip für die Freiheitslosung und das Prinzip der fairen Chancengleichheit für die Gleichheitslosung der Französischen Revolution stehen, will das Differenzprinzip die Forderung nach Brüderlichkeit bzw. wie wir heute sagen würden: nach Solidarität einlösen. Es zielt auf die Bearbeitung jener gravierenden Ungleichheiten in den Einkommensverhältnissen, die, wie Rawls meint, mit drei Arten von Zufallsumständen in Zusammenhang stehen: erstens der sozialen Klasse, in die der Einzelne hineingeboren wurde und von der er sich nicht lösen kann, bis er selbst erwachsen ist, zweitens den angeborenen Begabungen sowie den von der ursprünglichen Klassenzugehörigkeit abhängigen Chancen zu ihrer Entfaltung und schließlich drittens Glück oder Pech im Leben, was etwa Krankheit, Arbeitslosigkeit oder die Auswirkung von Wirtschaftsflauten betrifft (Rawls 2003, 96). Diese sozialen Ungleichheiten sollen den von ihnen am stärksten negativ Betroffenen die größten Vorteile bringen, insofern und weil die im Freiheits- sowie im Gleichheitsprinzip beschriebene Hintergrundgerechtigkeit, wie Rawls sie in diesem Zusammenhang bezeichnet, institutionell hergestellt ist. Unter dieser Prämisse könnten staatliche Regulierungen etwa in Bereichen der Preisbildung, der Arbeitsmarktregulierung, der Absicherung eines Existenzminimums, der Besteuerung von hohen Vermögen oder der allgemeinen Besteuerung zur Aufbringung von Mitteln, die im Sinne einer gerechten Umverteilung eingesetzt werden müssen, als gerecht anerkannt werden. Denn eines ist für Rawls evident: Wenn Vermögensunterschiede eine gewisse Grenze überschreiten, dann werden die Institutionen zur Absicherung der Chancengleichheit gelähmt, verliert die politische Freiheit ihren Wert, und die repräsentative Regierungsform ist nur noch Schein (Rawls 1979, 312).
Erkennbar erhebt auch ein solches Gerechtigkeitskonzept nicht den Anspruch einer universellen Gültigkeit (Hofmann 2000, 210), sondern bezeichnet vielmehr präzise, welche Gleichheitsaspekte in der modernen westlich-kapitalistischen Gesellschaft Berücksichtigung finden sollen und welche nicht. Es verweist dabei im Übrigen implizit auch auf die Grenzen und Defizite marktförmiger Gesellschaftssteuerung, insofern es nämlich z. B. diejenigen, die überhaupt keinen Tauschwert in den gesellschaftlichen Austauschprozess einzubringen vermögen – etwa: arbeitsunfähige Behinderte, dauernd Beschäftigungslose, Nichtsesshafte, Kinder – schlicht ausblendet. Insgesamt – mit ihren produktiven Fragestellungen wie mit ihren blinden Flecken – steht jedenfalls auch diese Gerechtigkeitskonzeption dafür, dass der kategoriale Inhalt von (sozialer) Gerechtigkeit keineswegs einmal vorgegeben und von da an für alle Zeiten feststehend ist. Zwar wird er sich im Kern immer über Gleichheitsfragen bestimmen lassen müssen; welche Gleichheits- bzw. Ungleichheitsverhältnisse jedoch innerhalb eines konkreten sozialen Zusammenhanges, einer konkreten Gesellschaft jeweils als gerechtigkeitsrelevant ausgemacht werden, ist damit, wie auch hier deutlich werden konnte, allerdings noch längst nicht entschieden. Oder, um es in den Worten des amerikanischen Sozialphilosophen Michael Walzer zu sagen: „Gerechtigkeit ist ein menschliches Konstrukt; und es steht keineswegs fest, dass sie nur auf eine einzige Weise hergestellt werden kann“ (Walzer 1994, 30).
1.2.4 Juristische Gerechtigkeit
Die soziale Dimension von Gerechtigkeit weist also deutlich über rechtliche Fragestellungen im engeren Sinn hinaus und begrenzt zugleich deren soziale Wirkungsmacht. Dennoch kommt dem Recht, wie eingangs gesehen, eine Schlüsselstellung innerhalb der Gerechtigkeitsproblematik zu. Denn die unterschiedlichen Möglichkeiten, Gerechtigkeit zu begreifen, d. h. also aus den realen gesellschaftlichen Ungleichheitsrelationen heraus Maßstäbe der Gleichheit und der Gleichbehandlung zu formulieren, sind im Recht in der Gleichheit der Person auf ihre abstrakteste Ausdrucksmöglichkeit zurückgeführt.
Einzelfallgerechtigkeit
Für die gesellschaftliche Wirklichkeit des Rechts, die gelebten rechtlichen Beziehungen (also etwa die Beziehungen zwischen Vertragspartnern, zwischen Schadensverursacher und Geschädigtem oder zwischen Behörde und Leistungsbezieher) bedeutet dies, dass in ihr der Gerechtigkeitsgedanke unter einem stark formalisierten Aspekt abgehandelt ist. Daran ändert sich auch prinzipiell nichts, wenn wir die sehr abstrakten Ebenen der Gleichstellung der Individuen als Rechtspersonen, z. B. als Staatsbürger, als Eigentümer oder bei der Abgabe einer Willenserklärung verlassen und bestimmte Kategorisierungen der Rechtsbeteiligten vornehmen: als Wahlberechtigte, ArbN, Verbraucher, Bezieher von Sozialleistungen, Verheiratete o. Ä. Stets neigen wir dazu, im rechtlichen Sinne immer genau dann von Gerechtigkeit zu sprechen, wenn innerhalb ein und derselben Kategorie für alle die gleichen Regeln zur Anwendung kommen. Jene abstrakte, formale Gerechtigkeit ist demnach „ein Handlungsprinzip, nach welchem die Wesen derselben Wesenskategorie auf dieselbe Art und Weise behandelt werden müssen“ (Perelman 1967, 28). Mit anderen Worten kann sich auch die Betrachtung des Einzelfalles, sofern sie unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten erfolgen soll, stets nur an der allgemeinen Norm orientieren. In rechtsphilosophischer Hinsicht hiervon zu unterscheiden wäre dann die Billigkeit, die, freilich auch in einer Weise, die letztlich wieder verallgemeinerbar sein muss, ihre rechtliche Bewertung unmittelbar an-hand des Einzelfalles, d. h. auch unter Berücksichtigung seiner Besonderheit, vielleicht sogar Einmaligkeit, abgibt. Insofern kann man mit Radbruch die Billigkeit als die Gerechtigkeit des Einzelfalles bezeichnen (Radbruch 1932, 37).