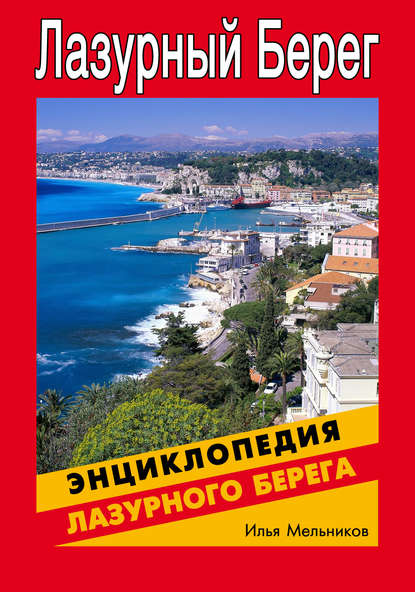- -
- 100%
- +
Kuhschnappel
Die Zeit verstrich und mein Zustand besserte sich nicht. Wie ein Geschenk des Himmels empfand ich daher einen Anruf, der mich zunächst noch mehr in Unruhe versetzte. Das Telefon hatte geklingelt und ich hatte aufgeatmet. Endlich würde ich die Gelegenheit haben, Klarheit in Sachen Jenseits zu schaffen. Doch schon am Display hatte ich gesehen, dass am anderen Ende nicht diese Fremde war.
„Hallo“, sagte ich.
„Hallo, Herr Professor,“ tönte da eine angenehme Stimme.
„Ja?“ meinte ich vorsichtig, aber schon wieder mit abstrusen Gedanken im Kopf. Wer mochte das sein? Wieder eine Frau, das hatte ich gehört. Aber welche? Und mit welchen Hintergedanken?
„Ich bin Bärbel Runge, eine ehemalige Studentin von Ihnen.“
„Aha!“ sagte ich irritiert. Dachte da wirklich eine ehemalige Studentin an mich? Was wollte sie von mir?
„Es geht um Ihre Methode! Ich will über Vor- und Nachteile von Inszenierungspraktiken promovieren. Angefangen bei Ekhof bis zu Stanislawski und Brecht. Vielleicht auch aus jüngerer Geschichte, Langhoff, Stein oder Müller. Ich weiß noch nicht. Ihre Ansichten wären mir sehr wichtig.“
„Kompliment!“ musste ich da erst einmal feststellen, „da haben Sie sich ja eine heroische Aufgabe gestellt.“
„Danke!“ meinte sie und knüpfte an, „ja, ich bin nämlich zur Wissenschaft abgewandert, aber vom Schauspielen nicht losgekommen.“
„Wenn ich Ihnen helfen kann.“
„Das könnten Sie. Ich habe bisher gefunden, dass Ihre Auffassung, wie mir scheint, am brauchbarsten für ein originäres Theaterspiel ist.“
„Danke!“ sagte ich.
„Aber ich habe natürlich Fragen. Ob ich das eine oder andere richtig verstanden habe, ob ich nicht Dinge hinein interpretiere, die Ihrer Theorie widersprechen würden.“
„So schlimm wird es nicht sein,“ meinte ich. Die Praktiker kümmern sich ohnehin nicht darum, wollte ich hinzufügen, unterließ es aber, um ihr nicht Mut und Elan zu nehmen. Meine Erfahrung war, dass selbst an Schulen nicht nach einer allgemein gültigen, weil richtigen Methode ausgebildet wird, sondern an jeder Schule der jeweilige Guru herrscht, und zwar mit seinen mehr oder weniger gut funktionierenden subjektiven, wenn nicht gar subjektivistischen Ansichten und Praktiken.
„Ja, wäre schön!“ antwortete Frau Runge und fügte hinzu, „es wäre wunderbar und würde meiner Arbeit voran helfen, wenn ich mich einmal mit Ihnen unterhalten könnnte. Ich bitte darum.“
Einen Damenbesuch konnte ich im Moment wahrhaftig nicht gebrauchen. Andererseits wäre er wahrscheinlich eine wohltuende Abwechslung. Obendrein zu einem Thema, das mir natürlich nach wie vor am Herzen lag. Ich zögerte mit der Antwort.
„Sind Sie noch da?“ hörte ich.
„Ja“, sagte ich, „ich überlege nur gerade, wie ich Sie in meinem Terminplan unterbringen könnte.“ Das war zwar gelogen; denn ich hatte so gut wie keine Termine, verschaffte mir aber Gelegenheit, die ganze Sache flux noch einmal abzuwägen. Und ich kam zu dem Schluß, mich auf ein Gespräch einzulassen.
„Ich kann mich ganz nach Ihnen richten,“ reagierte sie, „ich wohne zwar in München, bin jetzt aber in Berlin. Und Sie wohnen ja wohl irgendwo am Rande im Speckgürtel.“
Das war nun freilich eine verdächtige Anmerkung. Die Frau hatte offenbar Erkundungen angestellt. Interessierte sie sich gar nicht für Theorie, sondern für Praxis, und zwar für persönliche Annäherung? Ich spürte zwar sofort, dass ich schon wieder einigermaßen irre spekulierte, aber der Verdacht war aufgekommen, und so schnell ließ er sich auch nicht wieder ausräumen. Schließlich war irgendwelche profane irdische Annäherung immer noch wahrscheinlicher als ein Flirt mit dem Jenseits.
„Machen Sie einen Vorschlag,“ forderte ich Sie auf, „am besten vielleicht an einem frühen Nachmittag.“
Nach einem kurzen Hin und Her einigten wir uns auf einen Termin. Ich grüßte noch einmal, versprach neugierige Erwartung und legte auf. Was hatte ich mir da eingebrockt? Eine Studentin Runge war mir nur sehr schwach in Erinnerung. Sie war durchweg unauffällig geblieben, hatte weder verquere noch produktive Diskussionen provoziert. Und als Schauspielerin würde sie, das war schon während des Studiums abzusehen, zum Fußvolk gehören, zu jenen nötigen Unentwegten, die Tag für Tag auf der Bühne rackern und nur selten wirklich Anerkennung erfahren.
Zwangsläufig verbrachte ich von Stund an wieder höchst unruhige Tage. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die Münchnerin etwas mit der Anruferin zu tun haben könnte, äußerst gering war, litt ich unter der Ungewissheit. Die plötzlich und unerwartet noch einmal geradezu unheimlich eskalierte.
Ausgerechnet an dem Tag, an dem das Gespräch mit der ehemaligen Studentin stattfinden sollte, stieß ich beim morgendlichen Zeitungslesen auf eine Notiz, die mir von jetzt auf gleich allen Boden unter den Füßen wegzog. An diskreter Stelle wurde dort mit wenigen Zeilen berichtet, dass man eine Frau aus dem sächsischen Kuhschnappel ins Krankenhaus gebracht habe, weil sie immer wieder behauptet habe, von ihrem Mann aus dem Jenseits angerufen worden zu sein. Der Arzt habe schließlich keine andere Entscheidung treffen können, da die Frau hartnäckig bei ihrer Behauptung geblieben sei. Ganz offensichtlich hatte ein einfaches Gemüt die nervliche Belastung nicht aushalten können und hatte sich einer Nachbarin anvertraut. Und die wiederum hatten keine andere Wahl gehabt, als den Arzt zu rufen. Denn Anrufe aus dem Jenseits, die konnte es einfach nicht geben.
Für mich aber stand seit diesem Morgen fest, dass es tatsächlich Anrufe gab. Vermutlich sogar viel mehr, als bislang öffentlich benannt. Unter Umständen wurde von den Behörden sogar alles unternommen, um Informationen über die mysteriösen Vorgänge nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Denn die Obrigkeit hatten letztlich kein Mittel, die Verbreitung der Kunde zu verhindern, noch gar den Kontakt mit dem Jenseits zu unterbinden.
Nach dieser ungeheuerlichen Information schien mir mein weiterer Umgang mit der Anruferin auf einmal ziemlich klar. Es blieb mir nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich nahm mir vor, beim nächsten Telefonat zwar meine Fragen noch zu stellen, sozusagen in einem letzten Gefecht, ansonsten aber möglichst gesund und aufnahmefähig auf die zweifellos historische Herausforderung einzugehen.
Mich überkam überraschend eine erwartungsvolle Zufriedenheit. Zweifel daran, dass die Zeitungsmeldung ein Art Aprilscherz gewesen sein könnte oder eine Fake-News, kamen mir nicht. Im Gegenteil, ich fand es auf einmal positiv aufregend, offenbar zu den Auserwählten zu gehören, zu denen das Jenseits Kontakt aufnahm. Wahrscheinlich war von dort so etwas wie eine ideologische Offensive gestartet worden. Die Errrungenschaften modernster Technik machten es möglich.
Ich war mithin am Tage des Gespräches mit Frau Runge äußerst unkonzentriert. Eigentlich hätte ich ihr absagen müssen, denn ich hatte wirklich ganz andere Dinge im Kopf, musste und wollte meine Sicht aufs Jenseits und jene Frau, die meine Frau sein wollte, neu sortieren. So plante ich ein möglichst kurzes Gespräch mit Frau Runge; ging daher auch nicht zum Bäcker, sondern stellte demonstrativ nur zwei Gläser und eine Flasche Stilles Wasser auf den Tisch. Das Wetter war leidlich, die Temperatur im Rahmen – Gemütlichkeit würde nicht aufkommen. Und wenn, müsste ich dagegen steuern.
Frau Runge, stellte ich sofort fest, war eine schöne Frau! So auffallend attraktiv hatte ich sie gar nicht in Erinnerung. Als ich ihr mein Gartentor öffnete, überkam mich sofort eine stille Sehnsucht. Ich hatte mein Leben lang immer wieder überrascht registriert, dass mein Wahrnehmungssystem in Sachen Weiblichkeit von aufregender Sensibilität war. Es konnte mir widerfahren, dass ich auf der Straße eine Frau sah und sofort erotische Regungen hatte, ein Verlangen und Begehren, das lästig sein konnte, weil es stets Wünsche provozierte, die nicht erfüllbar waren. Mit dem Alter war dieser erotische Mechanismus gewissermaßen eingerostet, aber jetzt schien er wieder mobil zu sein und drängte erst einmal alle übrige Welt in den Hintergrund.
Die Besucherin hatte mein Aufmerken offenbar registriert. Ich sah heimliche Genugtuung und wachsende Zuversicht.
„Guten Tag, junge Frau,“ sagte ich.
„Ich grüße Sie und bedanke mich sehr!“ sagte sie ergeben und trat ein. Ich geleitete sie zur Terrasse. Vor mir her lief federnden Schrittes ein Weib in den besten Jahren. Ihr kurzes Kleid gab den Blick frei auf ihre energischen Waden, die mir partout etwas zu mächtig geraten schienen. Ich amüsierte mich über meine noch immer funktionierende Neigung, Vorzüge und Nachteile des anderen Geschlechts spontan zu analysieren und schöne Anblicke mehr oder weniger zu genießen. Schon waren wir auf der Terrasse angekommen und mein Gast nahm resolut Platz, packte hurtig ein Notebook vor sich hin und schaute mich erwartungsvoll an.
„Oh, gleich zur Sache!“ sagte ich respektvoll und durchaus zugleich darum bemüht, die Besuchszeit knapp zu halten. Der kurze kleine Trip in erotische Gefilde war ohnehin vorbei. Wie sie nun so saß, schien sie mir denn doch etwas zu korpulent geraten. In der Wissenschaft war sie ohne Zweifel besser aufgehoben als auf der Bühne.
„Ja,“ sagte sie gedehnt und fragte, „kann ich gleich zu meiner wichtigsten Frage kommen? Sie brennt mir auf der Zunge.“
„Aber bitte,“ entgegnete ich und setzte mich. „Vorher aber ein bisschen Wasser, falls die Frage etwas umfangreich sein sollte“, fügte ich augenzwinkernd hinzu und goss ihr Wasser ins Glas.
„Danke, sehr aufmerksam“, reagierte sie und nahm einen Schluck. Dann holte sie betont theatralisch Luft und fragte: „Kann es sein, dass Sie Ihre Methode eigentlich nicht zu Ende gedacht haben?“
Ich war überrascht, denn sie traf voll ins Schwarze.
„Ja!“ sagte ich ehrlich, wie ich nun einmal bin.
Bestätigt durch meine Antwort holte sie erneut tief Luft und fuhr fort. „Sie projizieren Hegels Negation der Negation auf die Schauspielkunst, bleiben aber bei der Hälfte stehen. Sie untersuchen die erste Negation, die von der Improvisation zur Fixation, wie sie diese Phase zu Recht nennen. Aber Sie untersuchen nicht die zweite Phase, die von der Fixation zur Improvisation auf höherer Ebene, die ja möglicherweise und überhaupt die wichtigste ist.“
„Stimmt!“ meinte ich beeindruckt. Sie hatte tatsächlich einen wunden Punkt getroffen. Ich hatte, als ich damals schrieb, Neuland betreten, nämlich eine bislang nicht übliche Sicht aufs Schauspielen als Arbeit. Diese Arbeit, stellte ich fest, hatte sich in der Geschichte des Bühnenspiels von der Improvisation, dem antiken Mimus, der ursprünglich ohne geschriebenen Text ablief, hin entwickelt zu fixiertem Spiel. Weil nämlich einst der aufgeschriebene, also nicht mehr spontan auf der Bühne erfundene Text mit lebendiger Handlung versehen werden musste. Die Untersuchung dieser höchst komplexen Problematik hatte meine ganze Aufmerksamkeit erfordert und ich war einfach nicht dazu gekommen, meine eigene Überlegung bis zu Ende zu denken. Also zu untersuchen, was geschieht, wenn der Schauspieler sein letztlich eingeübtes und festgelegtes Handeln Abend für Abend wiederholen muss. Er fängt dann bewusst oder auch unbewusst an, sich im Rahmen des Festgelegten frei zu bewegen, also auf höherer artifizieller Ebene zu improvisieren, und zwar nun Details und Feinheiten seines Bühnenhandelns solo oder mit Partnern. Frau Runge hatte da in der Tat meine Untersuchungen weiter gedacht. Und ich war gern bereit, ihr das zu bestätigen. Was ihr selbstverständlich sehr genehm war. Euphorisiert tippte sie sich irgendetwas in ihren Leptop. Ohne meine Zustimmung dankend zu kommentieren fuhr sie fort:
„Mein Problem ist jetzt, diese von uns gefundende Grundstruktur des Arbeitsprozesses in Bezug auf den Regisseur zu untersuchen. Die Frage ist: Analysiere ich erst einmal die Arbeitsweise jedes einzelnen Regisseurs und prüfe erst dann, ob sie übereinstimmt mit der von Ihnen gefundenen und von mir übernommenen Maxime, oder lege ich diese Maxime a priori wie eine Art Schablone darüber.“
„So ungefähr“, meinte ich.
„Und etwas eindeutiger?“ fragte sie.
„Fällt mir schwer. Wenn ich überlege, wie ich vorgehen würde, dann muss ich sagen, dass ich erst einmal versuchen würde, die Arbeisweise jedes einzelnen Regisseurs zu untersuchen. Und dann würde ich die Ergebnisse mit meinen Erkundungen vergleichen. Fatal wäre es, wenn sich kaum Übereinstimmung ergeben würde. Was ich freilich nicht annehme.“
„Ich neige auch zu diesem Herangehen,“ sagte sie.
In dem Moment schrillte das Telefon. Ich entschuldigte mich, ging ins Haus, nahm den Hörer und sah sofort am Display, dass es die Jenseitserin sein musste.
„Keine Zeit im Moment, rufen Sie später noch einmal an,“ rief ich ins Mikrophon und legte auf. Meine Besucherin hatte meine brüske Reaktion natürlich gehört und empfing mich mit großen Augen.
„Ich störe doch hoffentlich nicht?“ stellte sie fest.
„Keineswegs,“ antwortete ich karg und setzte mich wieder. Aber der Faden unseres Diskurses war gerissen.
„Ja,“ meinte sie nach kurzer Zwangspause, „eigentlich habe ich ja erfahren, was mir am Herzen lag und was ich erhofft hatte. Habe ich dann nur noch eine, zugegeben, unbescheidene Frage.“
„Bitte!“
„Könnte ich Ihnen mein Manuskript zu gegebener Zeit einmal vorlegen?“
Mit dieser Frage brachte sie mich in arge Verlegenheit. Ich hatte im Moment und wahrscheinlich auch in naher Zukunft überhaupt keine Lust, mich mit eine Dissertation zu beschäftigen. Andererseits war die Aussicht, dass sich eine junge Wissenschaftlerin ausgiebig und gewogen mit meinem wissenschaftlichen Werk befassen würde, äußerst angenehm. Ich konnte nicht nein sagen, wich dennoch erst einmal aus.
„Wenn es mich dann noch gibt,“ antwortete ich.
„Herr Professor, natürlich gibt es Sie dann noch!“
„Einverstanden,“ meinte ich.
„Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich und verabschiede mich. Bleiben Sie gesund.“
Meine Besucherin erhob sich resolut, und ich unternahm nichts, was ihren Aufenthalt verlängert hätte. Nach kurzem Zeremoniell an der Gartentür bestieg sie ihr Auto und fuhr davon.
Und ich setzte mich ans Telefon und dachte an Kuhschnappel.
Heiliger Bimbam
Wie lange ich am Telefon gesessen habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich wieder einmal aberwitzige Spekulationen angestellt habe. Plötzlich hatte ich das Bedürfnis, mir diese seltsame Zeitungsmeldung noch einmal anzusehen. Hatte ich überhaupt gelesen, worüber ich so angestrengt nachdachte? Stand das tatsächlich schwarz auf weiß auf dem Papier? Und vor allem: War es wirklich nur eine kurze Notiz? Hätte es nicht eine Aufmachung auf der ersten Seite sein müssen? Schließlich war die Behauptung der Frau, bei der sie offenbar hartnäckig geblieben war, keine Kleinigkeit, eigentlich viel mehr als beispielsweise ein Unfall auf der Autobahn. Ich schlug die Zeitung noch einmal auf. Und es stand noch immer da, schwarz auf weiß, klein geschrieben ganz unten rechts in der Ecke:
„Ungewöhnliche Erkrankung. Eine Rentnerin aus dem sächsischen Kuhschnappel wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie immer wieder behauptete, von ihrem verstorbenen Mann aus dem Jenseits angerufen worden zu sein. Sie habe sich darüber sehr gefreut und mehrmals mit ihm gesprochen.“
Einmal mehr machte ich mir bewusst: Die Redaktion der Zeitung war über das Ereignis hinweg gegangen als sei es gewöhnlicher Alltag, hatte einen absolut grotesken, ja abnormen Vorgang zwar vorsorglich gemeldet, aber gleichzeitig zur Bedeutungslosigkeit bagatellisiert. Hatte sie eine Anweisung von oben? Oder hatte sie eigenständig so entschieden?
Auch nach Tagen stand kein weiterer Beitrag in der Zeitung. Echter Journalismus, fand ich, hätte längst für ein ausführliches Interview mit dieser Frau sorgen müssen. Das hätte die Zeitung von heute auf morgen weltbekannt gemacht. Aber sie scheuten offenbar das Risiko. Zu fatal wäre gewesen, wenn dann früher oder später unwiderlegbar herausgekommen wäre, dass diese Frau einfach gelogen hatte. Nur ich wusste, dass das nicht der Fall gewesen war. Sollte ich einen Leserbrief schreiben? Nein doch! Welch dummer Gedanke. Auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gehen. Es war überhaupt nicht zu erwarten, irgendein Verständnis zu finden. Im Gegenteil, ich hätte mit einem freundlichen Irrenarzt rechnen können.
Ich schlief wieder einmal sehr unruhig. Und als das Telefon weit nach Mitternacht klingelte, war ich just hellwach. Ich griff zum Hörer und sah, da war keine Nummer auf dem Display. Die Jenseitserin!
„Ja, bitte!“ sagte ich.
„Entschuldige!“ bat die Stimme, „ich hätte längst wieder anrufen müssen. Aber hier geht alles drunter und drüber.“
„Und hier ist Mitternacht!“
„Ach du lieber Himmel! Entschuldige, entschuldige! Ich ruf später wieder an!“
„Moment!“ rief ich entschlossen. Die Gelegenheit schien mir günstig, endgültig Klarheit zu schaffen. „Hören Sie! Wie war das mit unserer Hochzeit? Welche Gäste hatten wir?“
„Was ist los?“
„Ich frage Sie, wie das mit unserer Hochzeit war. Welche Gäste hatten wir?“
„Aber Dad! Das weißt du doch genau!“
„Natürlich! Aber ich will es von Ihnen wissen!“
„Dad, wir hatten keine Gäste!“
„Keine?“
„Nein doch! Wir mussten schnell zurück zu unserem Sohn. Der lag in Windeln in seinem Körbchen, und die Wirtin war bereit gewesen, ab und zu nachzusehen.“
Heiliger Bimbam! Das waren mehrere stimmige Details in einem Satz. Ich gab mich geschlagen. „Schatz“, hauchte ich ins Telefon, „du scheinst es wirklich zu sein.“
„Ich bin es!“
„Dass es so etwas gibt!“ murmelte ich, noch immer ungläubig, aber mich den Fakten beugend.
„Pass auf,“ sagte sie, „schlaf du dich jetzt erst einmal aus. Nur noch so viel: Ich freue mich auf dich! Habe viel zu erzählen. Gute Nacht!“
Stille! Das Jenseits schwieg. Und ich fand natürlich keine Ruhe. Ich hatte mit gewehrt, ja, ich hatte das Unmögliche nicht für möglich halten wollen, und musste zugeben, die Beweise waren unwiderlegbar, dass da am anderen Ende der Leitung meine Frau sprach, in welchem Zustand auch immer. Es könnte ihr wacher Geist sein. Das wäre noch eine Erklärung. Aber wahrscheinlich war es nicht. Es konnte nach menschlichem Ermessen einfach nicht wahrscheinlich sein.
An Schlaf war nicht zu denken. Es waren quälende Stunden. Völlig unausgeschlafen registrierte ich den erwachenden Tag. Ich trat ans Fenster, blickte verschlafen hinaus und sah, wie doch tatsächlich in eben diesem Moment ein Graureiher auf der Wiese landete. Er verharrte einen Moment, dann stolzierte er gravitätisch zum Teich. Sollte ich ihn gewähren lassen? War das alles noch von irgendeiner Bedeutung? Waren irdische Angelegenheiten überhaupt von Belang? Jetzt, zu einer Zeit, in der ich Kontakt mit dem Jenseits aufgenommen hatte und mehr oder weniger bereit war, auch anzuerkennen, was ich da erlebte? Ich beschloss, Petra beim nächsten Mal sozusagen eine letzte klärende Frage zu stellen. Dann öffnete ich das Fenster und verscheuchte den Reiher.
Schon während des Frühstücks griff ich zur Zeitung. Irgendwann, fand ich, müsste sachlich und ausführlich über das supergroteske Phänomen „Rufe aus dem Jenseits“ berichtet werden. Aber die Redaktion hatte ganz andere Aufmerksamkeiten, ganz und gar nicht so grotesk wie mein Problem, aber grotesk genug für den gesunden Menschenverstand. Ausführlich wurde erörtert, ob es nicht endlich an der Zeit sei, das weibliche Geschlecht auch in der Sprache gleichberechtigt anzuerkennen. Die Tendenz war, und sogar die Herausgeber des Dudens hatten sich wohl schon angeschlossen, männliche Namen mit einem Sternchen am Ende zu versehen, um damit auszudrücken, dass auch Frauen damit gemeint seien. Welch Poblem! Sogar Parteien wälzten es hin und her. Ich kam nicht umhin zu konstatieren, dass die menschliche Gesellschaft ganz offensichtlich an einem Scheidepunkt angelangt scheint. Man macht neuerdings zur Sorge, was eigentlich eine nichtige Fragestellung ist, und vermag es so, den wahren Sorgen aus dem Wege zu gehen. Oh bitte, das Jenseits, ist es eine wahre Sorge? Noch ehe ich mir eine Antwort geben konnte, meldete es sich schon wieder.
„Ja!“, sagte ich.
„Stör ich?“ fragte sie.
„Nein, bin gerade fertig mit dem Frühstück.“
„Schön!“
„Habe nur noch eine Frage!“ sagte ich bestimmt.
„Dacht ich mir,“ meinte sie.
„Was machte unser Sohn, als wir nach unserer Hochzeit wieder bei ihm waren?“
„Du hast ihn trocken gelegt, und er hat dich in hohem Bogen angepinkelt.“
Was blieb mir nun? Ich zitterte nicht mehr! Petra hatte mich damals, und ich erinnerte mich gut, vergnügt an die Front geschickt. Und als ich meine Bewährungsprobe als Vater bestanden hatte, waren wir hurtig ins Bett gesprungen.
„Zufrieden?“ fragte sie jetzt.
„Ja,“ sagte ich und zitterte wieder.
„Und wie geht es dir?“
„Tja, du kennst ja meinen Zustand. Wird sich nicht mehr bessern. Ich schleppe mich so durch die Zeit.“
„Herz und Nieren.“
„Und Prostata.“
„Du lässt aber auch nichts aus.“
„Man gibt sich Mühe.“
„Weiß ich auch keinen Trost. Das Leben ist schon schön. Halt es fest, so lange du kannst.“
„Sehr schwierig ohne dich!“
„Musst du durch!“
„Ich muss dir noch den Kuss geben.“
„Welchen Kuss?“ fragte sie.
„Als du mich einen Tag vor deinem Tod im Krankenhaus besucht hast und zum Abschied sagtest ‚noch ein Kussel‘. Und ich dir den Kuss aus Sorge, ich könnte dich irgendwie anstecken, nur auf die Wange gegeben habe.“
„Ja, ich erinnere mich. Das war irgendwie symbolisch für unsere Beziehung. Immer herzlich, immer lieb, aber auch spröde und widersprüchlich.“
„Kannst du mir verzeihen?“
„Ja doch!“
Mir schossen Tränen in die Augen. „Danke!“ sagte ich gerührt und zwang mich, nicht sentimental zu werden. Das hätte ihr nicht behagt. In komplizierten Situationen in unserer Ehe, in der ich geneigt war, rührselig zu werden, hatte sie stets rational und sachlich reagiert und mich damit indirekt zurechtgewiesen. Sie mochte keine wehmütige Sentimentalität und konnte bezaubernd cool sein..
„Hör mal,“ fuhr sie jetzt fort. „Ehe wir über mich reden, sag mir bitte noch schnell, wie es unseren Kindern geht.“
„Sie sind gesund. Das ist mir das Wichtigste. Ansonsten läuft es im Moment ganz passabel. Martina ist zur Zeit in San Francisco und inszeniert „Alcina“ von „Händel“. Ihr Chef kommt am Schluß dazu, bastelt noch ein bisschen am Ergebnis herum und gibt es dann als seine Inszenierung aus. Und Martin ist mit seiner Puppentruppe für vier Wochen in Südkorea auf einem Festival in der Provinz. Sein Eumel ist da so etwas wie das Maskottchen des Festials. Es gefällt ihm sehr, sie haben Erfolg.“
„War er da nicht schon einmal?“
„Ja, er ist jetzt schon zum viertel Mal dort.“
„Verstehe das bitte, aber ich möchte sie nicht anrufen. Da sie meine Kinder sind, könnte ich das zwar, aber ich möchte sie nicht dieser psychischen Belastung aussetzen.“
„Das ist gut,“ sagte ich sofort.
„Fast alle hier telefonieren inzwischen mit ihren Verwandten. Und die, die keine mehr auf der Erde haben, sind traurig.“
„Ist ja irre!“
„Alles irre – aus menschlicher Sicht. Aber eigentlich ganz normal. Alle Toten landen im Jenseits und finden hier ihre geistige Existenz für die Ewigkeit.“
„Wie geht das denn?“
„Frag mich das nicht. Ich weiß es nicht. Aus allen Jahrhunderten geistern hier ehemalige Menschen herum. Eine illustre Gesellschaft. Geist und Seele sind in einer Hülle, die unserer irdischen Gestalt gleichkommt. Körperlose Wesen, sichtbar, aber nicht greifbar. Unser Dasein besteht aus Denken, und da jeder sein Wissen und seine Erfahrung mitbringt, kannst du dir vielleicht vorstellen, was hier los ist. Nicht trinken, essen, schlafen – nur denken.
„Mir schwirrt der Kopf.“
„Soll ich erst einmal aufhören.“
„Aus allen Jahrhunderten?“
„Ja. Aber die Jahrhunderte bleiben meist unter sich. Man hat sich gegenseitig wenig zu sagen. Die meisten Turbulenzen gibt es in den letzten drei Jahrhunderten. So mit Goethe geht es los. Meist lange Debatten über die Ohnmacht des Humanismus. Um Gott oder Götter geht es auch oft. Das letzte Jahrhundert ist ein absoluter Aufreger.“