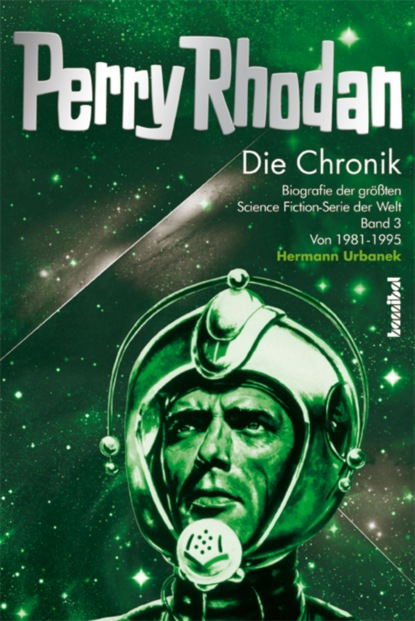- -
- 100%
- +
Eines der großen Highlights im Sekundärprogramm des SFCU waren und sind aber die ZEITRAFFER-Bände, die 1991 mit der Herausgabe des ersten PERRY RHODAN-Zeitraffers gestartet wurden, in dem Michael Thiesen sehr detailliert auf die Inhalte und inneren Zusammenhänge der PERRY RHODAN-Hefte einging. Hans-Dieter Schabacker hatte völlig recht, als er in seinem Vorwort schrieb: »Es schlummern immer noch unentdeckte Talente im deutschen Fandom, eines davon ist Michael Thiesen aus Kaiserslautern. Der vorliegende Sonderdruck wurde textlich von ihm erstellt, und auch das hervorragende Seitenlayout stammt von ihm – und dies alles hat ihm auch noch Spaß gemacht, wie er mir schrieb. Da bleibt zu hoffen, dass das vorliegende Werk auch euch Spaß macht und dass Michael noch lange so weitermacht und wir Fortsetzungen dazu herausgeben können.« Dieser Wunsch wurde erfüllt. Nicht nur hat Michael Thiesen im Lauf der seither verstrichenen mehr als zwei Jahrzehnte alle PERY RHODAN- und mit Ausnahme des »König von Atlantis« alle ATLAN-Zyklen erfasst, die ZEITRAFFER wurden auch immer wieder überarbeitet, mit neuen Erkenntnissen erweitert und optisch immer wieder verbessert. Damit haben Michael Thiesen, der zwischenzeitlich zu einem wichtigen freien Mitarbeiter der PERRY RHODAN-Redaktion geworden ist, und der SFCU nicht nur den Fans interessante und tiefschürfende Publikationen an die Hand gegeben, sondern auch den Autoren wichtige Grundlagen für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. Auch für Neuleser sind die »Zeitraffer«-Bände ein fast unentbehrlicher Ratgeber für den erfolgreichen Einstieg in die größte und längstlaufende SF-Serie der Welt.
Kurzbiografie: Michael Thiesen
Michael Thiesen wurde am 23. Mai 1956 in Trier an der Mosel geboren, wo er auch aufwuchs und 1975 das Abitur machte. Danach studierte er Biologie und Chemie für das Lehramt an Gymnasien.
Bereits als 13-Jähriger kam er mit PERRY RHODAN in Kontakt. »Seit meiner Kindheit bin ich ein konsequenter Leser und Sammler von SF aller Art«, beschreibt Thiesen selbst sein Interesse. »Von Anfang an hatte es mir speziell die Kunst der SF-Illustration und die Visualisierung phantastischer Themen in Filmen und Comics angetan.« Den Kontakt zu PERRY RHODAN fand er 1970 über Band 126 »Die Schatten greifen an«. Besonders fasziniert war er von William Voltz, da dieser viele Personen in der Handlung, besonders aber Alaska Saedelaere, als einsame Antihelden darstellen konnte.
Mitte der siebziger Jahre kam er erstmals mit dem Fandom in Berührung und arbeitete an Fanzines mit, unter anderem Michael Nagulas THINK OVER und COLLOQUIUM sowie W.K. Giesas TIME GLADIATOR.
Obwohl er zweimal die Lektüre der PERRY RHODAN-Serie abgebrochen hatte, kam er jedes Mal »reumütig« – so Thiesens eigene Formulierung – zurück. »Irgendwann habe ich es einfach aufgegeben, aussteigen zu wollen«, sagt er selbst. Er blieb seiner Lektüre treu, wenngleich er immer wieder kritische Worte zur aktuellen Handlung und zu aktuellen Romanen findet. 1990 startete er das ambitionierte Projekt PERRY RHODAN-ZEITRAFFER, das aus einzelnen Paperbacks besteht, die jeweils die Romane eines Zyklus ausführlich zusammenfassen und miteinander in einen Kontext stellen. Das Nachschlagewerk besteht aus mittlerweile 22 Einzelbänden zur Hauptserie sowie einer zu PERRY RHODAN ACTION, wurde mehrfach überarbeitet, auf CD-ROMs herausgegeben und immer wieder aktualisiert. Zuletzt wurde der ursprüngliche Band 1 mit den Heften 1–200 stark erweitert und als Band 1A und 1B neu herausgegeben. Dabei war der Anfang der Arbeit vergleichsweise untypisch: »Ich suchte nach einer Möglichkeit, um auf unterhaltsame Weise mit dem Schreibprogramm Word – damals noch in der Version 4.0 für DOS – vertraut zu werden.« Im Lauf der Jahre hat er sich durch seine zahllosen, sachkundigen Artikel und Zusammenfassungen, wie sie auch regelmäßig im PERRY RHODAN JAHRBUCH erscheinen, durch seine ZEITRAFFER-Bände und durch seine Zusammenarbeit mit dem Autorenteam längst zu einem unentbehrlichen Berater im Hintergrund entwickelt.
Angeregt durch entsprechende Veröffentlichungen Ernst Vlceks im PERRY RHODAN-Report, begann Thiesen damit, eigene Schauplatzkarten zur PERRY RHODAN- und ATLAN-Serie zu entwerfen, die er immer mehr optimierte und von denen bereits einige auf den Report-Seiten veröffentlicht wurden. Zudem gewann er mit seiner Story »Herbstlaub« den 2. Platz des Kurzgeschichten-Wettbewerbs »Begegnung an der Großen Leere«, steuerte eine Kurzgeschichte zu dem 1999 erschienen vierten Band der ATLAN-TRAVERSAN-Buchausgabe bei, verfasste zu jedem der 23 Bände der bei HJB erschienenen PERRY RHODAN GOLD-EDITION ein informatives Nachwort und stellt regelmäßig für die SOL, das Magazin der PERRY RHODAN-FANZENTRALE, ein Völker-Datenblatt zusammen.
Michael Thiesen ist von Beruf Lehrer und lebt mit seiner Familie in Kaiserslautern.
Das zweite Highlight bei den Veröffentlichungen des SFCU ist das PERRY RHODAN JAHRBUCH, das erstmals 1993 für das Jahr 1992 erschienen ist. Neben Michael Thiesens Zeitraffer der in diesem Jahr erschienenen PERRY RHODAN-Romane, der auch in jedem der Folgebände zu finden war, gab es eine Übersicht über die 1992 erschienenen Taschenbücher von Marcus Kubach, Andrew Acrus stellte die Silberbände und das erste ATLAN-Hardcover vor, es gab Jahresrückblicke von Uwe Anton, Rüdiger Schäfer, Hans-Dieter Schabacker und dem Chronisten, ein Interview mit Dr. Florian Marzin, einen Nachruf von Michael Thiesen auf Günter M. Schelwokat sowie einen Text zum Ausstieg von Marianne Sydow aus dem PR-Team, Artikel zum Wiedereinstieg von Horst Hoffmann und Peter Terrid sowie zur PERRY RHODAN SIMULATION, und Rüdiger Schäfer informierte über seine ATLAN FANZINE-Serie im Besprechungsjahr; hinzu kamen jede Menge Statistiken. Das PERRY RHODAN JAHRBUCH erschien im SFC Universum bis zur Ausgabe für 1996, dann übernahm die PERRY RHODAN-FANZENTRALE ihre Herausgabe. Nach drei Ausgaben beendete die PRFZ seine Publikation. Nachdem es längere Zeit kein PR-JAHRBUCH mehr gegeben hatte, übernahm der SFCU im Jahr 2006 wieder die Herausgabe des wichtigen Sekundärwerks. Unter der Regie von Frank Zeiger und Andreas Schweitzer werden die PR-Fans seither wieder über alles informiert, was innerhalb eines Jahres wichtiges im Perryversum geschehen oder erschienen ist
Nicht vergessen werden dürfen bei der Aufzählung der SFCU-Publikationen zwei Hefte, die der Erinnerung an zwei Autoren gewidmet waren und die kurz nach deren Ableben erschienen sind: »K.H. Scheer – Einer von uns« und »Begegnungen – Zur Erinnerung an Kurt Mahr«. Und natürlich auch nicht der von Klaus Bollhöfener zusammengestellte Band »Die etwas anderen PR-Autoren«, in dem die wenig bekannten Autoren vorgestellt wurden, die nicht an der PR-Serie mitgeschrieben, sondern »nur« PR-Taschenbücher veröffentlicht haben.
Und für noch etwas ist der SFCU berühmt: Seit den 80er Jahren gab es keinen vom Verlag auf die Beine gestellten PERRY RHODAN-Con, bei dem nicht die Mitglieder des SFCU unermüdlich als verlässliche Helfer bereitgestanden hätten und ohne deren tatkräftige Mitarbeit bei den Vorbereitungsarbeiten oder der Abwicklung des Programms und der Betreuung der Ehrengäste und Referenten alle diese Veranstaltungen nicht so reibungslos und für die Besucher so angenehm abgelaufen wären, wie es der Fall war!
Fünf Jahre nach dem SFC Universum betrat dann der ATLAN CLUB DEUTSCHLAND die Szene.
Der schwierige Weg in die Buchhandlungen
Schon lange war es das Bestreben des Bauer-Konzerns gewesen, die Taschenbücher seiner Verlage nicht nur über Kioske und Bahnhofsbuchhandlungen verkaufen zu können, sondern auch im Buchhandel Fuß zu fassen. Was mit den vielen Pabel-Taschenbüchern nicht möglich war, da diese von den Buchhändlern nicht akzeptiert wurden, weil sie von einem Romanheft-Verlag stammten. Diese Überlegungen hatten handfeste finanzielle Gründe, gab es doch bei den Buchhandlungen im Gegensatz zum Zeitschriftenmarkt, wo die unverkauften Titel einfach retourniert wurden und nur die verkauften Exemplare zur Verrechnung gelangten, nur ein beschränktes und genau definiertes Rückgaberecht. Und die Remittenden waren zu dieser Zeit ein finanzielles und logistisches Problem, speziell im Taschenbuchbereich. Bei den Heften hatten die Verlage die Lösung gefunden, diese in Dreierpacks zusammenzufassen und in dieser Form nochmals zum Schnäppchenpreis auf den Markt zu bringen, sofern sie nicht den Lesern, wie bei Pabel und Moewig lange Zeit üblich, die Möglichkeit boten, früher erschienenen Hefte direkt beim Verlag nachzubestellen, solange es von diesen noch einen Lagerbestand gab.
Mit dem 1979 neu gegründeten Moewig Verlag wurde die Basis geschaffen, neue Taschenbuchkonzepte zu entwickeln und einen neuen Versuch zu starten, sich im heiß umkämpften Buchmarkt einen Teil vom Kuchen zu holen. Als Verlagsleiter wurde der ehemalige Heyne-Lektor Egon Flörchinger gewonnen, der das neu aus der Taufe zu hebende Taschenbuchprogramm auf zwei Label aufteilte: die unter »Moewig« firmierenden Reihen und Titel und ein unter dem Label »Playboy« erscheinendes Programm. Unter Letzterem erschienen bereits ab Frühjahr 1980 – also ein halbes Jahr früher als die eigentlichen Moewig-Taschenbücher und im gleichen Überformat wie diese – pro Monat sechs Titel, aufgeteilt in Subreihen wie ROMAN, REPORT, EROTIK, ESPRIT, STORY, PARTYWITZE UND CARTOONS und SCIENCE FICTION. Die PLAYBOY SF-Reihe blieb – mit Ausnahme des Romans zum ersten Star Trek-Film – ausschließlich Anthologien und Erzählbänden bekannter SF-Größen vorbehalten. Die Gestaltung war einheitlich hellblau mit kleinem Titelbild und nach außen versetzter Titelschrift. Wurden die zumeist sehr umfangreichen Originalbände anfangs ungekürzt wiedergegeben, so kam es in der Folge aus finanziellen Gründen zu teilweise extremen Kürzungen, die bis zur Hälfte des Originals gingen. Bis zum September 1982 erschien monatlich ein Band, dann wurde die Reihe für ein Jahr eingestellt. Unter der Federführung von Hans Joachim Alpers belebte man sie im Herbst 1983 wieder, der neue Erscheinungsrhythmus war zweimonatlich.
Die Reihe hatte an sich schon mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass sich Kurzgeschichtenbände, Anthologien wie Collections gleichermaßen, im deutschen Sprachraum ungleich schwerer verkaufen als Romane und Zyklen, der Todesstoß wurde ihr aber versetzt, als sich ein als »Highlights«-Band angekündigter Aktionstitel als »Rupfbuch« mit Neuherausgaben von Lagerbeständen entpuppte, denen man die ursprünglichen Cover entfernt (»gerupft«) hatte und die mit neuem Umschlag nochmals an drei Seiten geschnitten wurden. Erschwerend kam noch dazu, dass der Klappentext überhaupt nichts mit dem tatsächlichen Inhalt zu tun hatte. Der darauf folgende Band wurde zwar noch publiziert, die weiteren für 1986 eingeplanten und angekündigten Titel sind dann nicht mehr erschienen.
Für die Reihe MOEWIG SCIENCE FICTION, die mit vier Titeln im Monat einen Schwerpunkt im Verlagsprogramm darstellte, verpflichtete Verlagsleiter Flörchinger den Fachmann und literarischen Agenten Hans Joachim Alpers. Alpers hatte zuvor die mit einem Band pro Monat laufende Reihe KNAUR SCIENCE FICTION von Start weg betreut und trennte sich von Knaur, weil ihm die neue Aufgabe mehr Möglichkeiten bot. Nach längerer Vorbereitung, die Alpers für den gezielten Einkauf noch nicht auf Deutsch erschienener Titel bekannter Genre-Autoren nutzte, wurden die ersten Bände der neuen SF-Reihe im Oktober 1980 publiziert. Von Oktober bis Dezember kamen drei Titel pro Monat heraus, dann wurde der monatliche Ausstoß auf vier Bände gesteigert. Alpers’ Konzept sah so aus, dass jeden Monat der Spitzentitel eines bekannten und eines weniger bekannten Autors, eine Anthologie oder Storysammlung und ein weniger anspruchsvoller Titel eingeplant wurden. Besonderes Augenmerk richtete er in der Anthologienreihe KOPERNIKUS und dem jährlichen ALMANACH auf die deutsche SF. 1982 erschien das erste SCIENCE FICTION JAHRBUCH, dem noch vier weitere folgten. Die Aufmachung war einheitlich bunt und in kräftigen Farben gehalten: blauer Buchrücken mit weißer Schrift und einem großen, weiß umrandeten »Moewig«-Schriftzug. Für die Titelbilder wurden die bekanntesten internationalen Künstler gewonnen. Und jeder Band enthielt auch ein informatives Nachwort, das auf Autor und Werk näher einging.
Doch es wurde bald deutlich, dass sich die Taschenbücher nicht so gut verkauften, wie von Konzernseite her erwartet worden war, wobei sich die SF-Bände noch am bestens schlugen. Hauptursache dafür war, dass die Buchhändler Probleme hatten, die Bände verkaufsfördernd zu platzieren. Die Moewig- und Playboy-Taschenbücher hatten nämlich ein anderes Format als die sonst im Handel befindlichen Taschenbücher, und was ein exklusives Merkmal sein sollte, erwies sich jetzt als verkaufshemmend; die Bücher passten nicht in die herkömmlichen Displayständer, die in jeder Buchhandlung zu finden waren. Aus heutiger Sicht war Flörchinger mit diesem neuen Format seiner Zeit zu weit voraus. Heutzutage sind zahlreiche unterschiedliche Formate auf dem Markt, sogar innerhalb von Reihen, und das, auch ohne die Paperbacks zu berücksichtigen, die in den letzten Jahren sehr an Marktanteilen gewonnen haben. Dazu kam, dass die Preise der Moewig-Taschenbücher über denen der Wettbewerber lagen und die Startauflagen viel zu hoch angesetzt waren. Der Verlag sah sich schließlich gezwungen, darauf entsprechend zu reagieren. Deshalb erschienen ab Januar 1983 statt vier nur noch zwei Bände im Monat. In erster Linie von der Programmkürzung betroffen war die deutsche Ausgabe des US-Magazins ANALOG.
Kurzbiografie: Hans Joachim Alpers
Hans Joachim Alpers wurde am 14. Juli 1943 in Wesermünde/Niedersachsen geboren, das 1945 Bremerhaven zugeschlagen wurde. Er arbeitete nach einer Lehre als Schiffsschlosser und einem Ingenieursstudium in Bremen einige Zeit als Maschinenbauingenieur und studierte anschließend noch Politik und Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Das Studium gab er schließlich auf, um sein Hobby zum Beruf zu machen und sich künftig mit literarischen Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Für die SF interessierte er sich schon in jungen Jahren. Er veröffentlichte in Fanzines, übernahm 1968 als Chefredakteur und Herausgeber das SF-Fanzine SCIENCE FICTION TIMES, das unter seiner Leitung zu einem kritischen semiprofessionellen Fachblatt wurde, und war 1970 Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Spekulative Thematik (AST). Die eingehende Beschäftigung mit der Literatur führte schließlich zur Veröffentlichung eigener Texte für den Profimarkt, beginnend mit dem unter dem Pseudonym Jürgen Andreas 1967 publizierten SF-Storyband »Erde ohne Menschen«. Am Beginn seiner schriftstellerischen Karriere nahmen die Jugendbücher einen breiten Raum ein, von denen einige in Zusammenarbeit mit seinem Freund und Kollegen Ronald M. Hahn entstanden und für die das Gemeinschaftspseudonym Daniel Herbst verwendet wurde. Unter seinem richtigen Namen veröffentlichte er die gemeinsam mit Ronald M. Hahn konzipierte und geschriebene, sechs Bände umfassende SF-Jugendbuch-Serie DAS RAUMSCHIFF DER KINDER. Weitere Pseudonyme waren Thorn Forrester, unter dem auch andere Autoren veröffentlichten, Mischa Morrison, P. T. Vieton und Jörn de Vries. Auch zu Basteis SF-Serie COMMANDER SCOTT steuerte er einen Roman unter dem Verlagspseudonym Gregory Kern bei.
Zu Beginn der 70er Jahre kam es durch ihn und seine Freunde und Kollegen Ronald M. Hahn und Werner Fuchs zur Gründung der literarischen Agentur UTOPROP, die neben deutschen Nachwuchsautoren auch zahlreiche SF-Schriftsteller aus dem Ausland vertrat, und für Alpers in der Folge zu ersten redaktionellen Arbeiten im Profibereich, beginnend 1977 als Lektor für Kelters SF-Reihe GEMINI und dazu dann als Redakteur beim SF-Magazin COMET. Von 1978 bis 1980 gab er die SF-Reihe von Knaur heraus, die von Werner Fuchs übernommen wurde, als er das Angebot erhielt, für die neuen Moewig-Taschenbücher die Reihe MOEWIG SCIENCE FICTION zu konzipieren und zu betreuen, für die er ebenso wie für die Reihe PLAYBOY SCIENCE FICTION und MOEWIG PHANTASTIKA bis 1986 verantwortlich zeichnete. Die MOEWIG SF brillierte mit renommierten Autoren und exzellenten Anthologien, die großartigen »Kopernikus«-Bände, die von ihm ebenso zusammengestellt und herausgegeben wurden wie der »Moewig Science Fiction Almanach«, das »Moewig Science Fiction Jahrbuch« oder die Auswahlbände aus dem renommierten amerikanischen SF-Magazin »Analog«. Die Auswahl war hervorragend, nur war das das generelle Konzept des Moewig-Taschenbuchprogramms mit dem für die damalige Zeit ungewöhnlich großen Format letztlich nicht vor Erfolg gekrönt. Ebenfalls exzellent die Anfang der 80er Jahre gemeinsam mit Hahn und Fuchs für Hohenheim liebevoll zusammengestellte Reihe der »Science Fiction Anthologien«, in denen etliche Kleinode aus dem Goldenen Zeitalter der amerikanischen Science Fiction erstmals dem deutsche Leser präsentiert wurden.
1978 erschien auch der erste von etlichen bahnbrechenden Sekundärbänden, die von Alpers mit herausgeben wurden: der prächtige Bildband »Dokumentation der Science Fiction ab 1926 in Wort und Bild«. 1980 folgte bei Heyne als erster Meilenstein das zweibändige »Lexikon der Science Fiction Literatur«, das 1988 in einer aktualisierten einbändigen Ausgabe nochmals auf den Markt kam, und 1982 »Reclams Science Fiction Führer«. 1999 erschien unter seiner Federführung das »Lexikon der Horrorliteratur«, 2005 gefolgt vom »Lexikon der Fantasy-Literatur«. Eine ursprünglich geplante aktualisierte Neufassung des SF-Lexikons wurde leider nicht mehr realisiert. Glanzlichter der SF-Sekundärliteratur waren auch seine Sachbücher über Isaac Asimov und Marion Zimmer Bradley (beide 1983).
1984 konzipierte er gemeinsam mit Ulrich Kiesow und Werner Fuchs das größte deutsche Rollenspiel DAS SCHWARZE AUGE. Dafür schrieb er 1996/97 die Trilogie DIE PIRATEN DES SÜDMEERS und entwickelte die im DSA-Universum spielende Serie RHIANA DIE AMAZONE, zu der er vier Romane beisteuerte; ein bereits angekündigter fünfter wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Und zu SHADOWRUN verfasste er die Trilogie DEUTSCHLAND IN DEN SCHATTEN. Darüber hinaus publizierte er mehrere Romane der Jugendbuch-Serie DIE ÖKOBANDE und schrieb er auch an Basteis Krimi-Serie CHICAGO mit, die ohne Autorennennung erschien. Auch bei PERRY RHODAN gab er 2007 mit dem 3. ARA-TOXIN-Band »Necrogenesis« ein Gastspiel.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends übersiedelte Alpers nach Nordfriesland, wo er ein Bauernhaus nach seinen Wünschen umbaute und dort sehr zurückgezogen seiner Sammelleidenschaft frönte, mit Schwerpunkt auf deutschsprachige Vorkriegs-SF. Für seine Leistungen als Autor und Herausgeber wurde er mehrmals mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet, für das »Lexikon der Fantasy-Literatur« erhielt er den »Deutschen Fantasy-Preis«. Am 16. Februar 2011 starb er nach kurzer schwerer Krankheit im Wilhelminen-Hospiz in Niebüll an Krebs.
Sparen bei den Zeichnern …
Um die Ausgaben besser in den Griff zu bekommen, wurde vonseiten des Pabel-Verlags analysiert, wo Einsparungspotenziale vorhanden sein könnten. Eine der Maßnahmen, zu denen man sich schließlich entschloss, war, die Honorare für die Zeichner der Serien PERRY RHODAN und ATLAN zu kürzen. Doch nicht alle der davon betroffenen Künstler konnten sich mit den neuen Bedingungen anfreunden. So setzte William Voltz, dem die undankbare Aufgabe übertragen worden war, die Zeichner von der Maßnahme des Verlags in Kenntnis zu setzen und ihre Bereitschaft, auch zu geringerem Honorar weiterzuarbeiten, auszuloten, Walter A. Fuchs am 27. Januar 1981 über die Ergebnisse seiner Gespräche in Kenntnis:
»Die Antworten der Illustratoren sehen so aus:
T. Kannelakis zeichnet nicht weiter (allerdings soll er lt. eigener Aussage im Auftrag von Herrn Bernhardt weiterzeichnen, bis neue Zeichner gefunden sind).
Dirk Geiling zeichnet weiter, möchte aber bei seinen Zeichnungen eine Form entwickeln, die weniger zeitraubend ist, um einen Ausgleich zu erzielen, was das Honorar angeht.
Alfred Kelsner zeichnet weiter.
Die Illustrationen für PR I und IV von Kannelakis liefen direkt über München, so dass ich nicht weiß, wie die Termine stehen.
Die Illustrationen von Geiling und Kelsner für ATLAN laufen über mich, da geht alles klar. Die Illustrationen von Kannelakis für ATLAN laufen direkt über München, so dass ich nicht weiß, was geliefert ist.«
Die Koordination war zu diesem Zeitpunkt insofern sehr schwierig, als sich der Verlag mit Walter A. Fuchs in Rastatt befand, Kurt Bernhardt und die Redaktion aber immer noch in München. Der Cheflektor wehrte sich mit Händen und Füßen gegen eine Übersiedlung nach Baden. Nachdem er zum Jahresende 1981 aus Altersgründen in Pension geschickt worden war, wurde das Münchener Büro aufgelöst und alle verlegerischen Tätigkeiten in Rastatt konzentriert. Bernhardt, der lieber weitergearbeitet hätte, blieb der Serie auch nach seiner Pensionierung verbunden. Seinen Ruhestand konnte er nur jedenfalls nur kurz genießen, denn er starb am 13. Juli 1983 im Alter von nur 67 Jahren.
… und beim Kopieren
Nicht nur bei den Zeichnern wurde gespart, auch in anderen Bereichen wurden Maßnahmen getroffen, die Kosten zu reduzieren. So schrieb Willi Voltz am 31. August 1981 an alle PERRY RHODAN- und ATLAN-Mitarbeiter:
»Das Fotokopieren von Exposés und Romanmanuskripten hat sich für den Verlag zu einem erheblichen Kosten- und Zeitfaktor entwickelt. Es wurden daher einige neue Regelungen getroffen, die vorsehen:
PERRY RHODAN-Manuskripte werden weiterhin fotokopiert und verteilt. Jeder Autor macht fünf Kopien für: Verlag, GMS1, Dolenc, Bruck und WiVo. (Wer eine Kopie seines Romanes behalten möchte, muss sechs Kopien machen). Die genannten Kopien sind direkt und sofort nach Fertigstellung des Romans zu verschicken.
ATLAN-Manuskripte werden nicht mehr fotokopiert. Jeder Autor macht vier Kopien für: GMS, WiVo/Griese, Bruck, Nachfolgeautor (also den, der den Anschlussband schreibt), Wer eine Kopie seines Romanes behalten möchte, muss fünf Kopien machen.
Die Seitenzahl der PERRY RHODAN- und ATLAN-Exposés soll dadurch verringert werden, dass die Papierfläche voll für den Text genutzt wird (Manuskriptform).«
Man sieht also, mit welchen Problemen sich Autoren und Verlag in diesem vor-elektronischen Zeitalter zu Beginn der 1980er Jahre noch herumschlagen mussten. Damals mussten die Kopien mit Kohlepapier hergestellt werden (Kopieren mit Kopierapparaten war noch umständlich und sehr teuer, zudem standen diese normalerweise nur in Firmenbüros, auf Postämtern und dergleichen), dann wurden die Manuskripte eingetütet, und es ging ab zur Post. Danach dauerte es wieder einige Tage, bis die Sendungen beim Empfänger ankamen. Heute ist das eine Angelegenheit von Minuten, mit einem einfachen Mausklick.
Startvorbereitungen für das neue Lexikon
Es war allen Verantwortlichen klar, dass so schnell wie möglich mit den Arbeiten an einem aktuellen Lexikon begonnen werden musste, da seine Erstellung für den oder die damit Betrauten einen enormen Arbeitsaufwand mit sich bringen würde. So wandte sich Kurt Bernhardt in Beantwortung des Schreibens von Peter Griese vom 9. April 1980 an diesen und ersuchte ihn um seine Vorstellungen. Peter Griese antwortete darauf prompt am 11. April:
»Ihr Schreiben vom 9.4.1980 betr. PR-Lexikon habe ich erhalten. Da ich auch schon mit Herrn Voltz über dieses Thema gesprochen habe, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, die man klären sollte, bevor eine neue Arbeit begonnen wird.
Das alte Lexikon ist stark überholungsbedürftig. Daran besteht wohl kein Zweifel. Auch enthält es eine Vielzahl von kleineren Fehlern und Ungenauigkeiten.
Ich weiß aber nicht, ob es richtig wäre, dieses Lexikon nur zu überarbeiten und neu herauszubringen. Natürlich kann ich das machen. Ich vermute aber, dass der große Leserkreis, der im Besitz des alten Lexikons ist, sich das neue überhaupt nicht kaufen wird. Ich räume ein, dass dies nur eine Überlegung ist, da ich nicht weiß, in welchem Umfang sich das alte Lexikon verkauft hat und wie viel Vorrat noch beim Verlag besteht.
Nicht nur aus dieser Überlegung heraus erschient es mir zweckmäßiger, wenn man statt der Überarbeitung von Lexikon I und der späteren Erarbeitung eines Lexikon II (Band 501 bis 1000) einen anderen Weg geht. Dieser Weg wär ein Lexikon, das Band 1 bis 1000 inhaltlich umfasst, also sozusagen das alte Lexikon mit beinhaltet. Die Entscheidung darüber liegt natürlich bei Ihnen. Vielleicht wäre ein klärendes Gespräch mit kompetenten Leuten erforderlich. Man sollte die Meinungen von Herrn Schelwokat und Herrn Voltz wohl dazu hören.