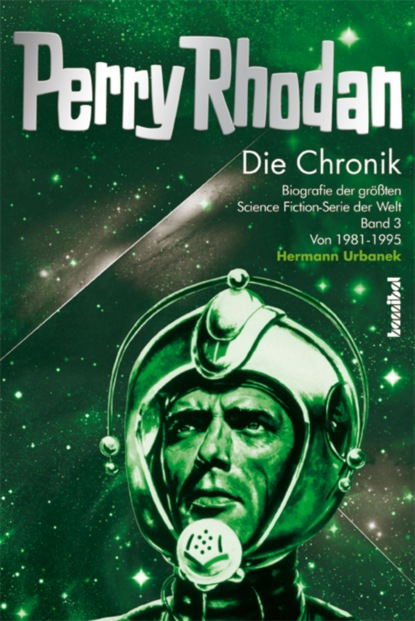- -
- 100%
- +
Aber er fühlte sich seit einigen Jahren wieder erstmals in der Lage und war auch willens, wieder bei PERRY RHODAN einzusteigen. Und so schrieb Willi Voltz am 14. August 1981 folgenden Brief an Walter Fuchs im Pabelhaus in Rastatt:
»Wie ich telefonisch bei Dir und gestern im Gespräch mit Herrn Blach, Herrn Zenkert und Dir ankündigte, will ich K.H. Scheer wieder als Co-Autor für die PR-Serie gewinnen. Skepsis und Bedenken des Verlags sind mir bekannt, vor allem was die Einhaltung der Termine angeht. Ich habe nun mehrfach mit K.H. Scheer gesprochen und bin der Überzeugung, dass er gerne wieder PR-Romane schreiben will und schreiben wird. Die Verantwortung für die Termineinhaltung übernehme ich. (…) Was die Grundthemen der Serie angeht, werde ich in einem Gespräch mit Herrn Scheer darüber sprechen, dass Dinge wie Waffenfetischismus, Rassenverherrlichung (Terraner) und undifferenziertes Supermanngehabe darin nichts mehr zu suchen haben. Auch werde ich K.H. Scheer dazu anhalten, sich positiv hinter die Serie zu stellen.
Grundsätzlich glaube ich, dass K.H. Scheer eine Bereicherung für die Serie sein wird und dass man mit der Reaktivierung der speziellen Scheer-Anhänger PR I (trotz der allg. Wirtschaftslage und der damit verbundenen Probleme, von denen Herr Blach gestern sprach) auch weiterhin unbeschadet durch sinkende Verkaufszahlen, die andere Serien und Reihen heimsuchen, bringen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich erleichtert darauf hinweisen, dass auch Marianne Sydow (die, wenn auch thematisch aus einer ganz anderen Richtung kommend) die Arbeit bei PR wiederaufgenommen hat – und damit ein spezielles Publikum anspricht.«
Tatsächlich war Scheer nicht glücklich darüber, wie sich die Serie unter der Federführung von Willi Voltz entwickelt hatte, und hatte das in Gesprächen und Interviews auch zum Ausdruck gebracht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre Perry Rhodan in der laufenden Handlung immer noch Großadministrator des Solaren Imperiums gewesen. Nichtsdestotrotz nahm er die Arbeit an PERRY RHODAN auf, nicht ohne in seinem ersten neuen Roman nach zehnjähriger Abwesenheit eine neue Figur einzuführen, die an die alten Kämpen aus der Frühzeit der Serie erinnerte und auch aus dieser stammte: Clifton Callamon.
Mit ihr wollte Scheer dem Pazifismus, der in PERRY RHODAN mit Band 1000 ausgebrochen war, einen Antipoden entgegenstellen. In einem Interview, das Matthias Hofmann und Rüdiger Schäfer 1990 mit Scheer führten (K.H. Scheer Interview – Sonderbeilage zu COSMOS 5 – Ein Fanzine des PRC Ruf der Kosmokraten; 1991) meinte Scheer zum Thema MdI und Pazifismus: »Ihr vergesst immer wieder im Hinterstübchen, dass es hier um eine abenteuerlich gefärbte Science Fiction-Serie geht, die neben bei auch verkauft werden soll und Erfolg haben muss! Wie will ich beispielsweise einen Zyklus von nur 25 Bänden ausschließlich nach der total pazifistischen Richtung aufbauen, es muss doch auch einmal etwas passieren! Wir waren schon so weit, dass keiner sich mehr ein Bein brechen durfte. Das geht nicht. Wir haben hier eine kommerzielle Romanserie, die möglichst vielen Leuten gefallen soll. Wenn gar nichts mehr passiert, wenn die Leute auf fremden Planeten gelandet sind und nicht einmal ein Taschenmesser dabeihatten, weil das als verpönt galt, dann führt das zu weit. Das hat mich damals verleitet, dieses Uraltgeschöpf Clifton Callamon ins Spiel zu bringen.«
Die ersten Marktbereinigungen
Nachdem die siebziger Jahre von immer neuen Serienstarts geprägt gewesen waren, neigte sich jetzt zu Beginn der 80er Jahre der Boom beim Horror langsam, aber beständig seinem Ende entgegen. Zumindest bei Pabel-Moewig, das auch in diesem literarischen Segment eine Vormachtstellung innegehabt hatte, und das trotz der enormen Konkurrenz durch Zauberkreis und Bastei mit Dan Shockers LARRY BRENT und MACABROS bzw. JOHN SINCLAIR und dem GESPENSTER-KRIMI. Dazu kam noch, dass Pabel-Moewig mit anderen Objekten viel Geld verloren hatte. Deshalb wurden verlagsintern alle Reihen und Serien auf ihre Rentabilität geprüft. Und es stellte sich heraus, dass bei einigen die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr aufging.
So wurde die Heftreihe VAMPIR, die im September 1972 als erste Horror-Heftreihe in Deutschland auf den Markt gebracht worden war, im Oktober 1981 nach neunjähriger Existenz eingestellt. In VAMPIR hatte nicht nur die legendäre DÄMONENKILLER-Serie von Ernst Vlcek und Kurt Luif ihren Anfang genommen, es wurden hier auch zahlreiche andere Mini-Serien und Zyklen dem deutschen Leser präsentiert, wie die FRANKENSTEIN-Romane von Donald F. Glut, BARNABAS, DER VAMPIR von Marilyn Ross oder der ebenfalls von Ernst Vlcek und Kurt Luif als Nachfolgeserie des mittlerweile eingestellten DÄMONENKILLERS geplante HEXENHAMMER. An Einzeltiteln, hin und wieder auch mit wiederkehrenden Protagonisten, gab es neben Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen auch Grusel- und Horror-Romane bekannter deutscher Autoren, darunter Hugh Walker alias Hubert Straßl, Frank Sky alias Hans Gerd Franciskowsky, Earl Warren alias Walter Appel, James R. Burcette alias Kurt Luif und Hivar Kelasker alias Hans Kneifel. Die VAMPIR-Taschenbücher und die DÄMONENKILLER-Taschenbücher waren wegen Unrentabilität bereits im März bzw. Mai 1980 mit Band 81 bzw. 63 vom Markt genommen worden.
Auch die von Hugh Walker mustergültig herausgegebene TERRA FANTASY-Taschenbuchreihe blieb von dieser Marktbereinigung nicht verschont: Zwar erhielt die Erstauflage noch eine Schonfrist bis zum Frühjahr 1982, die 2. Auflage beendete aber bereits im Juli 1981 mit der Nr. 53 ihr Erscheinen.
Der Blick über den Tellerrand
Bei anderen Verlagen, die im Genre publizierten, sah es nicht viel anders aus. Kelter nahm die Reihe GEISTER-KRIMI, die seit 1974 gelaufen war und in der die Serienfiguren MARK TATE von W. A. Hary und RICK MASTERS von Andrew Hathaway (Richard Wunderer) ihre ersten Abenteuer erlebt hatten, mit Heft 405 aus dem Programm. In ihrer Blütezeit war die Reihe so erfolgreich gewesen, dass es auch gleichnamige Taschenbücher gab. Gegen Ende zu jedoch wurden viele der früheren Titel unter neuer Nummer nochmals aufgelegt. Bastei stellte die SF-Serie DIE TERRANAUTEN mit Heft 99 ein, führte die Geschichte aber in loser Folge im Taschenbuch weiter. Und Boje beendete die Publikation von SF-Jugendbüchern. Aber noch hatten generell die neuen Reihen und Serien das Übergewicht. Bastei startete im Taschenbuch den SF-Klassiker CAPTAIN FUTURE, der es bis zu seiner Einstellung 1984 auf immerhin fünfzehn Ausgaben brachte, sowie die Reihe BASTEI PHANTASTISCHE LITERATUR, in der angloamerikanische und deutsche Klassiker dem deutschen Leser ebenso vorgestellt wurden wie neuere Werke, so auch Thomas Zieglers erste, kurze Fassung seines späteren Romans »Die Stimmen der Nacht«, und erweiterte zudem sein SF-Programm noch durch die neue Reihe BASTEI SCIENCE FICTION ABENTEUER. »Hohenheim« startete im Hardcover die EDITION SF und Heyne die renommierte BIBLIOTHEK DER SCIENCE FICTION LITERATUR, in der bis zum Jahr 1995 Meilensteine dieser Literaturgattung in deutscher Erstveröffentlichung oder erstmals ungekürzt, zum Teil auch mit informativen Nachworten versehen, veröffentlicht wurden. Edmond Hamiltons CAPTAIN FUTURE erlebt seit 2011 eine Renaissance im Berliner Golkonda Verlag, wo eine komplette Ausgabe der Serie in 22 Paperbacks einschließlich der Illustrationen und Zusatztexte aus den Original-US-Magazinen geplant ist; bei Redaktionsschluss lagen bereits drei Bände vor.
Ein neuer SF-Preis wird vergeben
Eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr 1981 war die erstmalige Verleihung des Kurd-Laßwitz-Preises. Dieser undotierte Preis, der jährlich von professionell im Bereich der Science-Fiction arbeitenden, deutschsprachigen Personen vergeben wird, wurde 1980 nach dem Vorbild des amerikanischen Nebula Award ins Leben gerufen und nach dem deutschen Science-Fiction-Autor Kurd Laßwitz benannt. Ausgezeichnet wird jährlich die jeweils beste Produktion des Vorjahres. Damit sollen herausragende Leistungen vor allem im Bereich der deutschsprachigen Science Fiction geehrt werden, um die Preisträger und die deutschsprachige Science Fiction zu unterstützen.
Der Preis wurde zunächst in sechs Kategorien vergeben (»Roman«, »Erzählung«, »Kurzgeschichte«, »Übersetzer«, »Graphiker« sowie »Sonderpreis«); 1983 wurde die Kategorie »Bester ausländischer Roman« eingeführt. 1987 folgten die Kategorien »Hörspiel« und »Film«. Während die Kategorie »Hörspiel« seit 1993 eine eigene Jury besitzt, wurde die Kategorie »Film« 1996 in die Kategorie »Sonderpreis« integriert. 1997 wurden die Kategorien »Erzählung« und »Kurzgeschichte« zu einer zusammengefasst, und seit 2001 entscheidet in der Kategorie »Übersetzung« eine Fachjury.
Nominierung und Abstimmung erfolgt durch die im Bereich der Science Fiction professionell tätigen Autoren, Übersetzer, Grafiker, Lektoren, Verleger, Fachjournalisten und ehemaligen Preisträger.
Die ersten Preisträger waren Georg Zauner für den Roman »Die Enkel der Raketenbauer«, Thomas Ziegler für die Erzählung »Die sensitiven Jahre«, Ronald M. Hahn für die Kurzgeschichte »Auf dem großen Strom«, Horst Pukallus als bester Übersetzer und Thomas Franke als bester Grafiker, den Sonderpreis erhielten Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronals M. Hahn und Wolfgang Jeschke für die Herausgabe des »Lexikon der Science Fiction Literatur«.
Neues von den Planetenromanen
1981 erschienen wieder zwölf PERRY RHODAN-Taschenbücher, damals noch PLANETENROMANE genannt. (Nicht zu verwechseln mit den heutzutage (2012/2013) erscheinenden Taschenheften dieses Namens, in denen – und hier ist der Name Programm – ausgewählte Titel aus den Taschenbüchern nochmals aufgelegt werden.)
Den Reigen eröffnete der Walty-Klackton-Roman »Kosmischer Grenzfall« von Ernst Vlcek, in dem der ehemalige Schrecken der USO sein erstes Abenteuer in den Diensten Roi Dantons, des Königs der Freihändler, erlebte, gefolgt von »Der genetische Krieg« von H.G. Ewers, dem 4. Roman um Kyron Barrakun alias Computer-Kid, der diesmal herausfinden musste, wer für die ungeheuerlichen Mutationen auf Ertrus und Siga verantwortlich war, wo eine aus den Fugen geratene Biologie alles Leben bedrohte. Peter Griese war gleich mit zwei Bänden vertreten: In »Welt der Flibustier« trafen Orbiter und Menschen auf einem einsamen Planeten im Zentrum der Galaxis auf eine Wesenheit, die nach neuer Macht trachtete, und in »Findelkinder der Galaxis« begab sich Reginald Bull auf die Suche nach dem Heimatplaneten der rund zwölfhundert Xisrapenkinder, die im Babyalter auf verschiedenen Sauerstoffplaneten ausgesetzt worden waren. Hans Kneifel ließ in »Das Mittelmeer-Inferno« den Arkoniden Atlan eine neue Geschichte aus seiner Vergangenheit auf der Erde erzählen, während in Horst Hoffmanns »Tödliche Fracht für Terra« der Mausbiber Gucky wieder den Retter der Erde und des Vereinten Imperiums spielen durfte. Kurt Mahr schilderte in »Bote des Unsterblichen«, wie ES im Auftrag der Kosmokraten einen Boten in geheimer Mission ausschickt, der dafür sorgen soll, dass das Geheimnis der kosmischen Burgen gewahrt bleibt, und präsentierte mit »Eiswelt Cyrglar« den vierten Roman um Langlon Brak und sein Team vom Geheimdienst SOLEFT. In »Die Macht des Götzen« von Harvey Patton geriet Reginald Bull, der als Rhodans Stellvertreter einen Staatsbesuch absolvierte, in den Bann eines dunklen Götzen aus der Vergangenheit, Clark Darlton ließ in »Die andere Welt« Perry Rhodan und den Teleporter Ras Tschubai bei der Nutzung des Nullzeit-Deformators auf einer Alternativerde stranden, auf der die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hat, H.G. Francis schilderte in »Der Waffenhändler« das vierte Abenteuer mit Ronald Tekener und Sinclair Marout Kennon, den Spezialisten der USO, und in Arndt Ellmers »Die Verschwundenen von Arkona« wurde Perry Rhodan entführt und sollte nur gegen Zahlung einer hohen Lösegeldes von seinem Entführer wieder freigelassen werden. Breit gefächert wie die Inhalte waren auch die Handlungszeiten der einzelnen Bände; die Bandbreite reichte vom Altertum bis zum Jahr 1 NGZ.
Bei den Titelbildern gab es eine Änderung: Johnny Bruck, sonst für alle Objekte mit PR-Bezug der Titelbildgestalter, lieferte für Band 217 sein für längere Zeit letztes Cover; von ihm stammte später nur mehr das Titelbild für das zu Zeiten Napoleons spielende Atlan-Abenteuer »Das Buch der Kriege« (Band 325). Ab Band 218 wurde er durch einen neuen Coverzeichner ersetzt, einen Künstler, der mit seinen vorgelegten Arbeiten begeistert hatte und der nach dem Tod von Bruck einer der regelmäßigen neuen Cover-Künstler werden sollte, die abwechselnd die Titelbilder der Hauptserie gestalten. Sein Name: Alfred Kelsner.
Kurzbiografie: Alfred Kelsner
Alfred Kelsner wurde am 24. Mai 1949 in Bünde, Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen, geboren. Schon früh begann er mit der Malerei; nach eigenen Angaben bereits im Vorschulalter. Während er sich als Kind vor allem für Ritterzeichnungen begeistern konnte, änderten sich Kelsners Vorlieben als Jugendlicher: Er kaufte sich Astronomie-Bücher und ein Teleskop, wurde begeisterter Hobby-Astronom, woraus sich seine Passion für die Science Fiction-Malerei entwickelte. Nach einer Lehre als Schilder- und Reklamemaler studierte Kelsner an der Fachhochschule Köln und wurde Grafik-Designer. Seit 1978 ist er als freischaffender Grafiker und Illustrator tätig. Ende der 70er Jahre hatte ihn ein PERRY RHODAN-Roman von William Voltz so begeistert, dass er dem PR-Chefautor einige Bilder schickte. Das Ergebnis war, dass er mit diesem gemeinsam den Bildband »Zeitsplitter« entwickelte, ein großformatiges Buch mit Bildern Kelsners, von denen sich Voltz zu Kurzgeschichten inspirieren ließ. Kelsner übernahm die PERRY RHODAN PLANETENROMANE, zu denen er von Band 218 bis Band 403 bis auf die Ausgaben 253, 254, 325, 336, 339 und 340 alle Cover gestaltete. Daneben schuf er noch Titelbilder für die ATLAN-Miniserien TRAVERSAN und CENTAURI, die AUTORENBIBLIOTHEK und MYTHOR und fertigte auch Innenillustrationen für die PERRY RHODAN- und die klassische ATLAN-Serie an. Seit Band 1800 ist Kelsner neben Swen Papenbrock, Ralph Voltz und Dirk Schultz einer der sich abwechselnden Titelbildkünstler der PERRY RHODAN-Heftserie.
Zeitsplitter – Gedankensplitter
Willi Voltz war von Kelsners Bildern begeistert, wie er in der Einführung zu dem aufwendig gestalteten Bildband »Zeitsplitter« anmerkte, der sich optisch an den PERRY RHODAN-Silberbänden orientierte und im September 1981 zur Auslieferung gelangte:
»Als ich zum ersten Mal Bilder von Alfred Kelsner sah (es waren drei winzige Fotos, die er zusammen mit einem Leserbrief an den Verlag geschickt hatte), war ich auf Anhieb davon überzeugt, dass der Welt der Science Fiction eine Entdeckung bevorstand. Und ebenso spontan packte mich die Idee, zusammen mit Alfred Kelsner diesen Band zu produzieren, den ersten Bildband dieser Art, den ein deutscher SF-Grafiker und ein deutscher SF-Autor zusammen geschaffen haben. Meine Helden, so sagt man mir gerne nach, sind melancholische Einzelgänger, und vielleicht beruht meine Begeisterung für die Bilder von Alfred Kelsner darin, dass diese Helden in ihnen eine grafische Entsprechung gefunden haben. Ein großer Teil dieser Bilder drückt sehr genau das aus, was ich im Umgang mit den hauptsächlichen Themen meiner Geschichten empfinde. Deshalb fiel es mir auch leicht, für diesen Band etwas zu tun, was ich in anderer Form eigentlich ablehne: Geschichten zu einer Bildvorlage zu schreiben. Natürlich liegt der Schwerpunkt dieses Buches auf seinem grafischen Teil; es gibt darin zwei in sich abgeschlossene Portfolios, bei denen ich mich auf die Zusammenstellung und den Titel zu den einzelnen Bildern beschränkte: VOM MYTHOS DES FLIEGENS und DIE ANDEREN. Zu achtzehn anderen Bildern habe ich sogenannte Short-Stories geschrieben, die ich (in Ableitung des Buchtitels) als Gedankensplitter bezeichnen möchte.«
Fünf Bilder aus diesem Prachtband fanden 1991 als Titelbilder für das neue fünfbändige Lexikon Verwendung. Und als die Storys im Rahmen der »Gesammelten Kurzgeschichten von William Voltz« in Band 60 der Reihe UTOPIA CLASSICS neu aufgelegt wurden, da zierte auch ein Bild aus »Zeitsplitter« das Cover.
Eine bahnbrechende Risszeichnung
Seit ihrem ersten Auftreten in PERRY RHODAN-Heft 192 sind die Risszeichnungen ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Perryversums, der sich von seinen Anfängen heraus bis heute immer weiter entwickelt hat und von einigen Generationen von Risszeichnern geprägt wurde. Zumeist folgten die in den PR-Heften vorgestellten Raumschiffe Vorgaben aus der Heftserie, bisweilen wurden aber auch eher ungewöhnliche Eigenkonstruktionen präsentiert. Die war beispielsweise der Fall bei dem in PERRY RHODAN Band 1059 »Fels der Einsamkeit« gezeigten »Abfangjäger der neuen REDHORSE-Baureihe«. Er entstammte dem Ideenreichtum und der Spontanität von Jürgen Rudig, der nur wenige seiner Kreationen im PERRY RHODAN MAGAZIN und in der Heftserie veröffentlichte, bevor er 1982 sein letztes Werk ablieferte. Nach Veröffentlichung der RZ des Redhorse-Jägers kam es zu massiver Kritik der Leser auf der LKS, wobei einige Fans bemängelten, dass die Zeichnung mit der freien Hand durchgeführt worden war, Worte wie ein »Fliegender Schrotthaufen« oder »Risszeichnung« als Beleidigung machten die Runde. Es war das erste Mal, dass die Leser sich derart kontrovers zu einer RZ äußerten. Rudigs Kollege Gregor Sedlag machte sich 2011 vor dem WeltCon in Mannheim auf die Spurensuche und wusste in seinem Internet-Blog über den Zeichner und seine so gemischt aufgenommene Eigenkreation Interessantes zu berichten:
Interview: Alles nur ein Spaß? 30 Jahre Redhorse-Jäger – Ein Interview mit Jürgen Rudig, geführt von Gregor Sedlag
Die beste RZ aller Zeiten? Terranische Raumschiffe: Abfangjäger der neuen »Redhorse«-Baureihe, Rudig 1981; Source: PR I, Band 1059 »Fels der Einsamkeit«
Als ich mir im Spätherbst 1981 an einem üblichen Dienstagmorgen vor Schulbeginn PERRY RHODAN 1. Auflage Band 1059 »Fels der Einsamkeit« am Kiosk kaufte, war ich wie alle vier Wochen insbesondere auf die neue Risszeichnung gespannt. Noch vor Ort schlug ich mit klopfenden Herzen die Heftmitte auf – und sofort wieder zu! Mein Leben war von diesem Augenblick an ein anderes. Noch nie in meinem Leben hatte ich etwas Seltsameres und Fremdartigeres gesehen als Jürgen Rudigs Abfangjäger der neuen »Redhorse«-Baureihe.
Zu dieser Zeit hatte ich schon erste Veröffentlichungen meiner eigenen Risszeichnungen als »Leser-RZ« erlebt, aber mir wurde in diesem Moment schlagartig klar, dass ich meinen Zeichenstil komplett würde umstellen müssen, um wirklich die Risszeichnungen anzufertigen, die ich mir bis dahin aber nur vage vorzustellen gewagt hatte.
Das ist jetzt beinahe 30 Jahre her, und im Zuge der Wiederbelebung dieses Blogs und des bevorstehenden WeltCons in Mannheim zum 50-jährigen Jubiläum der PERRY RHODAN-Serie hielt ich es für eine gute Idee, Kontakt mit Jürgen Rudig zu suchen, um ihn selber zu fragen, wie er das damals erlebt hat.
Wir haben kurz miteinander telefoniert und dann das folgende Interview per E-Mail geführt.
Jürgen Rudig ist Jahrgang 1958, verheiratet, hat zwei halbwegs erwachsene Kinder, ist seit fast 30 Jahren im öffentlichen Dienst, inzwischen Schulleiter einer weiterführenden Schule irgendwo im Hinterland von Aachen. Er hatte seit vielen Jahren kaum noch Kontakt mit PERRY RHODAN und dem SF-Fandom; umso mehr freut es mich, dass er hier Rede und Antwort stand.
Wie kam es zum »Redhorse-Jäger« – einer Risszeichnung, die auch im Vergleich zu deinen vorhergehenden Veröffentlichungen heraussticht?
Vor über 30 Jahren stand ich mitten im Studium in Aachen – Kunst und Deutsch – und wollte eventuell Lehrer werden. Mittelprächtig begabt, hatte ich neben dem Studium schon etliches verkaufen können und verdiente für einen Burschen von Anfang zwanzig gar nicht mal schlecht damit: Ölporträts nach Vorlage, Buchillustrationen für kleine regionale Verlage, Raumabwicklungen für Architekten, und – ja, klar – natürlich diese Risszeichnungen. Wie ich dazu kam, ein andermal. Es soll hier und heute ja vornehmlich um diesen vermaledeiten »Redhorse-Jäger« gehen, der wohl einigen Staub aufgewirbelt hat und mehr oder weniger das Ende meiner kurzen »Karriere« als Risszeichner einläutete.
Der »Redhorse-Jäger« war ja eine typische freie Arbeit, die mit dem »Perryversum« nur über die Namensgebung verbunden war, aber sie war nicht im luftleeren Raum entstanden.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass ich das Ding bei Jim Burns abgekupfert haben soll – oder zumindest davon motiviert gewesen wäre. Da ist sogar ein bisschen was dran, obwohl ich beim Zeichnen dieses Jägers – soweit ich das in der Erinnerung noch zusammenbekomme – schwer unter dem Eindruck von einer anderen illustren Größe der damaligen Zeit stand: Möbius.
Das nehme ich dir sofort ab. Die beiden verdutzten Piloten vorm Jäger könnten direkt aus der hermetischen Garage gesprungen sein!
Über die ersten Hefte von Metal Hurlant – »Schwermetall« – stolperte ich beim Stöbern im Katalog des Volksverlages, das muss 1979 gewesen sein. Die Möbius-Storys haben mich umgehauen – so locker, so dermaßen gekonnt, erkennbar mit einem Filzer hingeworfen … In einer Rezension las ich dann, dass Möbius angeblich einfach draufloszeichne, ohne konkreten Plan, ohne Vorzeichnung, eben einfach mit dem Filzer. Das wollte ich unbedingt auch versuchen, mit eigenen Comics, aber eben auch mit Risszeichnungen. Ich malte und zeichnete zu der Zeit sowieso sehr viel, probierte nun auch in dieser Richtung herum, entwarf großformatige Arbeiten – halb Comic, halb Risszeichnung –, kombinierte die Rotring-Feder mit dem Edding 3000. Die Ergebnisse waren eher zwiespältig und liegen zum Teil heute noch in meiner Sammlung vergraben.
Das ist eine gute Nachricht!
Ich nicht weiß, warum es eine gute Nachricht sei soll, dass ich noch alte RZs irgendwo vergraben habe. Ist es gut, dass die noch da sind? Oder ist es gut, dass sie so tief vergraben sind?
Spaß beiseite – ungefähr zur gleichen Zeit war ich dann mal wieder zu Besuch bei Willi Voltz zu Hause, um eine eher übliche Risszeichnung – ich weiß nicht mehr welche – abzuliefern, sauber eingerollt in eine Papprolle und fast 300 Kilometer im klapprigen Käfer meiner Freundin transportiert. Willi Voltz fand die RZ prima und nahm sie sofort, und dann schenkte er mir etwas: die beiden Bände »Mechanismo« und »Planeten Story« – beide Bücher habe ich heute noch.
Ich will nicht abstreiten, dass Jim Burns auf mich Eindruck machte (wie gesagt, ein bisschen was mag dran sein, dass der Gaussi-Jäger meinen »Redhorse« beeinflusste), aber – großes Aber! – siehe oben: Zu dem Zeitpunkt waren meine Ideen von halbschrottigen Raumschiffen, die von skurrilen Typen mehr improvisiert als geflogen wurden, von Raumfahrzeugen, denen man einen harten Arbeitsalltag ansah und die mit lockerer Hand eher hingeworfen als durchkonstruiert schienen, schon sehr weit gediehen.
OK, aber eine Risszeichnung ist zuerst einmal keine Comic-Illustration. Gewisse »Freiheiten« hattest du dir in deinen Arbeiten bis dahin immer herausgenommen, aber eben auch durch deine handwerklichen Qualitäten z. B. beim Setzen von Schraffuren so geschickt kaschiert, dass der Eindruck der technischen »Blaupause« immer erhalten geblieben ist. Beim »Redhorse-Jäger« hatte ich den Eindruck, dass du uns sagen wolltest: »Das mache ich jetzt extra schief und absurd!« Damit keiner mehr auf die Idee kommt, das Ding könnte es wirklich mal geben.
Ich war des von mir zumindest so empfundenen Bierernsts der Szene um die RHODAN-Serie eigentlich satt. Als begeisterter, kritischer Leser von Lem, den Strugatzkis u. a. hatte ich den Hype (so würde man heute wohl sagen) um diese Weltraumserie sowieso nie ganz begriffen. Auch wollte ich eigentlich weg von der ganzen Matrosen-Ästhetik mit »Decks«, »Geschützpforten«, »Kommandoständen«, »Außenschotts« etc. Ich war immer der Meinung, Raumschiffe – und die Typen, die sie fliegen – sehen in zweitausend Jahren ganz anders aus als für uns vorstellbar. Raumschiff Orion mit seiner ganz eigenen Ästhetik imponierte mir z.B. viel mehr als der ganze Star Wars-Kram.
Also, langer Rede kurzer Sinn: Es musste mal was Spaßiges, was anderes her, und zudem lebte ich in dem Gottvertrauen darauf, dass man mir auch »so was« im wahrsten Sinne des Wortes abkaufen würde, vielleicht sogar Verständnis dafür hätte, mich unterstützen würde … Ansonsten konnte ich ja noch genug alte Omas und Kommunionskinder in Öl produzieren.