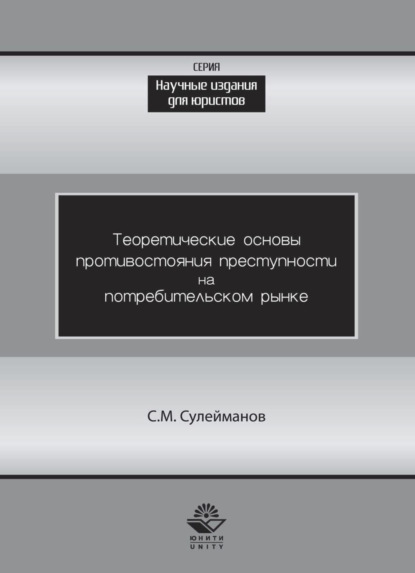- -
- 100%
- +
Nur von einem solchen Verständnis aus, das die Geschichte der vorangegangenen Grundverständnisse von Literatur reflektiert und in sich aufgenommen hat, lässt sich sinnvoll darüber reden, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten die literarische Rede generell eröffnet und auf welchem Wege diese Potentiale am besten genutzt werden könnten. Es ist also nicht nur im Sinne eines umfassenden wissenschaftlichen Vorgehens, sondern auch im Sinne der ganz gewöhnlichen Leseerfahrung nützlich
[16]
und notwendig, sich in die Reflexionsinstrumente des Literaturbegriffs einzuüben. Jedes literarische Werk führt die Geschichte der Einzelwerke, Gattungen, Epochen und Literaturvorstellungen virtuell mit sich und entsteht immer auch aus der Auseinandersetzung mit seinen historischen Vorgaben, die es bestätigt, relativiert, transformiert oder revolutioniert. Somit kommt nur der Leser befriedigend an die Potentiale der singulären, unmittelbaren ästhetischen Erfahrung heran, die sich in ihm einstellen, wenn er sich die Mühe macht, den Hintergrund der Begriffsbildung zu vergegenwärtigen, an dem sich das Werk bis in seine konkretesten und sinnlichsten Details hinein abarbeitet.
1.3

Warum muss dieses Nachdenken über Literatur aber als „Theorie“ stattfinden? Was ist der Vorteil einer „theoretischen“ Erschließung gegenüber einem nichttheoretischen Denken, das es zweifelsohne gibt und das sogar den „Normalfall“ der denkenden Betrachtung darstellt? Um dies zu beantworten, ist es notwendig, sich in aller Kürze darüber zu verständigen, was denn „Theorie“ in diesem Zusammenhang bedeutet und was sie leistet (zum antiken Sinn von „Theorie“ bei Aristoteles informativ Welsch 1996, S. 855 – 859). Dabei ist es sinnvoll, von den unzähligen wissenschaftlichen Zusammenhängen, in denen der Theoriebegriff eine jeweils etwas andere Rolle spielt, abzusehen, und sich stattdessen auf generelle Eigenschaften theoretischer Rede zu konzentrieren.
Jede Wissenschaft ist dort, wo sie ihre einzelnen Forschungsergebnisse in möglichst umfassender Weise deuten und begreifen will, auf Theoriebildung angewiesen: also darauf, nicht beim Einzelnen stehenzubleiben, sondern Gesetze, Regeln, Zusammenhänge, Bedingungen, Funktionen und Folgen bezüglich ihres Gegenstandsbereiches festzustellen. Umgekehrt lässt sich in keiner Wissenschaft überhaupt irgend etwas beobachten, solange man nicht durch theoretische Arbeit die Beobachtungsinstrumente erzeugt hat: Wissenschaftstheoretiker sprechen dabei von der „Theoriebeladenheit der Beobachtung“ (Carrier 2009,
[17]
S. 19; vgl. Breidbach 2005). Die Dinge und Sachverhalte der Lebenswelt, um die wir uns denkend kümmern, führen ihre begrifflichen Erschließungsmöglichkeiten nicht wie wahrnehmbare Tatsachen mit sich: Wir nehmen die verschiedenen Möglichkeiten, bspw. Bäume begrifflich zu beschreiben, nicht in derselben mühelosen Weise wahr, wie wir Bäume selbst in ihrer reinen Wirklichkeitspräsenz ohne jede weitere Anstrengung als körperliche Dinge von bestimmter Form, Größe und Farbe erfahren. Theoretische Arbeit steht also am Anfang und am Ende jedes wissenschaftlichen Arbeitsprozesses. Sie bildet die Klammer um die Gegenstandserkenntnis und macht es möglich, einzelnen Ergebnissen einen übertragbaren Rahmen zu geben: d. h. das Einzelne als Teil eines rationalen Zusammenhangs von Ursachen und Gründen zu begreifen.
Dabei kann man schematisch vier Erkenntnisinteressen von Theoriebildung unterscheiden (in leichter Abwandlung von Eberhard 1999, S. 16): das phänomenale, das kausale, das rationale und das aktionale. „Phänomenal“ erzeugen Theorien „Hypothesen und Thesen über das Erscheinungsbild des Erkenntnisgegenstandes“ (ebd.). Sie denken darüber nach, auf welche Weise und mit welchen (begrifflichen) Mitteln sich die Eigenart des Gegenstandes am genauesten und angemessensten beschreiben lässt. „Kausal“ stellen Theorien ihren Gegenstand in ein Geflecht äußerer Ursachen und fragen nach seinem Zustandekommen. „Rational“ fragen Theorien nach dem Zusammenhang von Gründen, der ihren Gegenstand so bestimmt hat, das er ist, wie er ist. Und „aktional“ denken Theorien über „Einwirkungsmöglichkeiten“ auf den Gegenstand nach, also darüber, wie man ihn erzeugen, beeinflussen oder verhindern könnte. Schließlich müsste man noch eine fünfte Dimension hinzufügen, die man das „historische“ oder auch das „metatheoretische“ Interesse der Theorie nennen kann. Theorien müssen sich in hohem Maße auch dafür interessieren, in welcher Weise bisherige Theorien ihren Gegenstand erforscht haben. Denn es hat sich gezeigt, dass in größeren zeitlichen Abständen oftmals „wissenschaftliche Revolutionen“ stattfinden, die deutlich machen, dass selbst in den Naturwissenschaften die grundlegendsten und anerkanntesten Theorien eines Gegenstandsbereiches veränderbar oder sogar vollständig revidierbar sind. Thomas Kuhn hat in einem „Klassiker“ der Wissenschaftstheorie mit dem Titel Die Struktur
[18]
wissenschaftlicher Revolutionen deshalb von „Paradigmen“ gesprochen und die Gesetze ihres historischen Wechsels untersucht. Dabei meint er mit Paradigma „die ganze Konstellation von Meinungen, Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden.“ (Kuhn 1977, S. 389f.)
Wissenschaft basiert also in hohem Maße auf der Idee der Veränderlichkeit noch ihrer letzten und sichersten Grundannahmen; Umstürze in unserem Weltbild wie die durch Nikolaus Kopernikus oder Albert Einstein zeugen davon. Satirisch zugespitzt kommt dies in einem Ausspruch von Lichtenberg zum Vorschein: „Ich habe nun noch […] eine Theorie, die aber nicht mehr zu gebrauchen, denn sie ist vom vorigen Jahr.“ (Lichtenberg 1998, Bd. 3, S. 532). Das sollte man jedoch nicht nur negativ verstehen: Die Veränderlichkeit von Theorien sichert ihre Leistungsfähigkeit ab. Denn das Ideal jeder Wissenschaft ist in einem bestimmten Maß von der Idee des „Fortschritts“ abhängig. Theorien schließen an die Kette der schon bestehenden Theorien über ihren Gegenstand an, um aus deren Ergebnissen wie möglichen Fehlentwicklungen weiterführende und idealerweise genauere Gegenstandserkenntnisse zu erarbeiten. Die Klage über die Theorienvielfalt, die seit einigen Jahrzehnten in der Literaturwissenschaft geführt wird, hat eher damit zu tun, dass es hier kein evolutionäres Nacheinander von Theorien wie in den Naturwissenschaften gibt, sondern ein egalitäres Nebeneinander. Es scheint so, als habe eine geschichtsphilosophische Idee des 18. Jh. Eingang in die gegenwärtige Theorienlandschaft gefunden. Damals war man überzeugt, dass es einen echten Fortschritt und damit eine Überlegenheit der „Moderne“ gegenüber der „Antike“ nur auf dem Gebiet der Wissenschaften, nicht auf dem Gebiet der Künste geben könne, da in den Künsten die antiken Muster unübertrefflich seien, wohingegen die epistemische und technische Überlegenheit der Neuzeit nicht zu leugnen war (vgl. Jaumann 2007). Später hat sich diese Idee dahingehend gewandelt, dass man daraus einen Gegensatz von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften machte, demzufolge es einen Fortschritt im Sinne einer „Überwindung“ vorhergehenden Wissens nur auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, nicht für die Geisteswissenschaften gibt (vgl. Gadamer 1986, S. 288f. [268]).
[19]
Eine große Vielfalt konkurrierender Theorieprofile streitet sich heute auf diesem Feld darum, welches wohl die angemessenste Beschreibung des Gegenstandes „Literatur“ bereitstellt (Kap. 14.2). Inwiefern diese Pluralität von Paradigmen in der Literaturwissenschaft jedoch durch den Gegenstand bedingt ist oder nur eine Fehlentwicklung der Wissenschaftslandschaft darstellt, ist selbst eine theoretische, stark umkämpfte Frage. Die hier vorgeschlagene Tätigkeit einer „literarischen Ästhetik“ hat unter anderem den Vorteil, dass sie als Grundlagentheorie der Literatur den einzelnen Methoden vorgeschaltet sein soll. Sie entscheidet deshalb nicht, welche „richtig“ ist, sondern erarbeitet die vormethodischen Fragehorizonte des Gegenstandes, ohne jedoch ihre eigene Theoriehaftigkeit zu leugnen. Auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Nachdenkens gibt es keine Alternative zur Theoriebildung: Man kann Theorien nur mit Theorien vergleichen, Theorien nur durch Theorien kritisieren (vgl. Neurath 1979). Das bedeutet aber keine Beliebigkeit oder willkürliche Freiheit, bloß den eigenen Einfällen und Launen zu folgen.
Denn Theoriebildung in der Wissenschaft steht unter drei unbedingten Forderungen: weitestmögliche Begründbarkeit – höchstmögliche Differenziertheit – umfassendste Systematizität (vgl. Hoyningen-Huene 2009). Ihre Ergebnisse müssen sich demnach vor der Gemeinschaft einer ganzen Wissenschaft („scientific community“) rechtfertigen können: ob sie auch den Gegenstand in all seinen inneren Unterscheidungen und Einzelheiten angemessen erfassen und ob sie das Netz der Gründe und Beziehungen, in dem er in der Welt steht, herausstellen. Deshalb lässt sich definitorisch festhalten: Theorie ist ein System von Sätzen, durch welches sich ein relativ kohärenter Frage-, Begriffs- und Urteilszusammenhang über seinen Objektbereich ergibt, das einen umfassenden Erklärungs- und Begründungsanspruch bezüglich dieses Objektbereiches erhebt und das bestimmten Anforderungen an Genauigkeit, Rationalität und Systematizität genügen muss.
Alle diese Bewegungen der Theoriebildung zielen demnach darauf, den Gegenstand nicht bloß isoliert für sich zu betrachten, sondern ihn in umfassender Weise, und das heißt stets im Ganzen seiner Bedingungen, Strukturen und Wirkungen zu begreifen. Die Theorie der Literatur macht da prinzipiell keine Ausnahme – und darf es auch nicht, will sie den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit nicht ablegen müssen. Trotzdem
[20]
ist die Theoriefähigkeit der Literatur seit der bereits skizzierten Wende der „Autonomieästhetik“ im 18. Jh. stark umstritten. Es gibt auch heute eine eigene, durchaus anregende Theorie der Theorieunfähigkeit von Literatur, die sich durch verschiedene Methoden und Literaturtheorien zieht (Werkimmanente Methode, Diskursanalyse, Dekonstruktion). Die Leistung von Literatur liege demnach darin, als „Gegendiskurs“ (Foucault 1971, S. 76) gerade das rationalistische Ideal der Wissenschaft zu unterlaufen und damit die „letztlich nicht aufhebbare Differenz zwischen Literatur und Wissen“ (Geisenhanslüke 2003, S. 8) zum Ausdruck zu bringen. Diese für das Wissenschaftsverständnis der Literaturwissenschaft problematische Grunddifferenz, die besagt, dass sie ihren Gegenstand irgendwie auch immer schon verfehlt, findet sich auch in „Supertheorien“ wie der Systemtheorie wieder, für die „Literatur und Literaturwissenschaft […] wechselseitig Umwelt füreinander“ (Ort 2002, S. 202) und deshalb bis zu einem gewissen Grad einander unzugänglich sind. Diese Ansicht von Kunst und Literatur liegt in der Ursprungsgeschichte der Disziplin „Ästhetik“ begründet (Kap. 2). Sie kann insofern verallgemeinert und zu einem Grundpfeiler der Theorie von Literatur gemacht werden, als sie Literatur als etwas wesentlich Nicht-Selbstverständliches fasst. Damit aber qualifiziert sich Literatur sogar in besonderer Weise als theoriefähig, wenn man Theoriebildung als verstehende Erweiterung des Gegenstandes über sein bloßes Dasein hinaus begreift, wie oben skizziert wurde.
Denn Literatur ist zum einen das Nicht-Selbstverständliche, weil sie seit dem 18. Jh. durchgängig als Diskurs gefasst wird, der eingefahrene Verstehensmuster und Überzeugungen kritisch hinterfragt und gegebenenfalls auflöst. Literatur ist zum anderen das Nicht-Selbstverständliche, weil sie nicht völlig aus sich selbst heraus verstehbar ist (eine Gegenposition dazu ist neuerdings Mussil 2006): weil sie das Verständnis der historisch-epochalen Rahmenbedingungen ihrer Produktion benötigt, um vollends erfasst zu werden (Kap. 13.1). Literatur ist drittens das Nicht-Selbstverständliche, weil die Art und Weise, wie das einzelne Werk erscheint, stets die „Warum“-Frage an den Leser stellt: Warum bin ich so und nicht anders gestaltet? Aus welchem Grund verknüpfe ich die Elemente in dieser Weise und nicht in einer anderen, warum rede ich so von meinen Gegenständen und nicht anders? Für Kunstwerke ist näm-
[21]
lich die funktionale oder kausale Erklärung, die wir bei solchen Fragen in der Lebenswelt heranziehen würden, sinnlos oder wenigstens höchst unbefriedigend. Es mag richtig sein, die Form eines Hammers mit seiner besonders großen Schlagwirkung oder die Schärfe einer Speise mit der Vorliebe der Köchin für Gewürze zu erklären und das in Frage stehende Phänomen damit zu „verstehen“. Für literarische Werke ist jedoch wenig damit gewonnen, ihr Sosein aus den Bedingungen ihrer Entstehung oder ihres Zwecks heraus zu erklären: Man hat Goethes Wahlverwandtschaften weder verstanden, wenn man herausfindet, wozu ein solcher Roman alles gebraucht werden kann, noch dann, wenn einem klar ist, wie bestimmte Inhalte auf bestimmte Eigenschaften, Meinungen oder Absichten Goethes zurückzuführen sind. Im Kapitel zum „Verstehen“ und zur „Interpretation“ werden wir uns diesen Fragen genauer widmen. Festzuhalten bleibt: Literatur ist also in besonderer Weise theoriefähig, weil sie sich durch eine spezielle Grundspannung auszeichnet. Die ästhetische Erfahrung des literarischen Werkes beruht ganz wesentlich auf seinem individuellen Gestaltungszusammenhang und weist doch auch ständig über diesen hinaus.
Literatur zielt so von sich aus darauf, in größere historische Zusammenhänge gestellt zu werden („Systematizität“) und nach besonderen wie allgemeinen Gründen ihres So-Seins zu fragen („Rationalität“); dies aber stets im Dienst einer möglichst großen Differenziertheit, mit der jeder Einzelheit der Gestaltung des Werkes Aufmerksamkeit geschenkt werden soll („Genauigkeit“). Ob diese Theorieaffinität von Literatur wiederum dazu führen muss, dass man von ihr einen genauen Begriff finden kann, der notwendige und hinreichende Merkmale zusammenfasst, ist eine Frage, die unabhängig davon zu behandeln ist. Wichtig ist deshalb, dass man diese beide Fragen prinzipiell voneinander trennt – was nicht heißt, dass die Antwort auf beide sie nicht doch wieder zusammenführt. Aber Literatur als etwas der theoretischen Begriffsbildung Entgegengesetztes zu betrachten, ist nur eine mögliche Antwort auf die generelle und unabweisbare theoretische Frage, die jedes einzelne literarische Werk selbst (dar)stellt und die direkt mit seiner literarischen Form zusammenhängt: Was bin ich? Die Literaturerfahrung selbst ist bereits unabweisbar theoretisch.
[22]
1.4

Warum aber heißt das Unternehmen, das hier vorgestellt wird, denn nun „literarische Ästhetik“ und nicht „Literaturtheorie“, da eben gerade soviel von „Theorie“ die Rede war? Mit der Antwort auf diese Frage kommt man zum Problem des „Anfangens“ zurück, dass gleich zu Beginn dieses Kapitels besprochen wurde. Beide Begriffe – „Ästhetik“ und „Literaturtheorie“ – entspringen jeweils einer bestimmten Epoche und tragen auch deshalb eine bestimmte, etwas anders gelagerte historische Bedeutung an sich. Zum Begriff der „Ästhetik“ wird Kapitel 2 informieren. Es ist aber bereits anzumerken, dass „Ästhetik“ hier im Sinn von „Kunstphilosophie“ – also hier „Philosophie der Literatur“ –, nicht aber als Begriff für die Reflexion über das Sinnliche oder die Wahrnehmung gebraucht wird. (Alle drei Bedeutungen verschränken sich im Begriffsgebrauch des späten 18. Jh.)
Der Begriff der „Literaturtheorie“ bezieht sich historisch auf Theorien, die sich seit den 50er Jahren des 20. Jh. entwickelt haben (Hermeneutik, Psychoanalyse, Strukturalismus, Kritische Theorie, Diskursanalyse, Dekonstruktion, gender studies etc.) und denen mindestens drei Punkte gemeinsam sind: A) Bis auf die sogenannte „Werkimmanente Methode“ (Emil Staiger, Wolfgang Kayser) sind diese Theorien dadurch gekennzeichnet, dass sie dezidiert für andere bzw. weitergefasste kulturwissenschaftliche Gebiete als nur die Literatur entwickelt wurden (Soziologie, Semiotik, Hermeneutik, Ethnologie, Phänomenologie etc.), dann aber für die theoretische Erschließung literarischer Phänomene fruchtbar gemacht worden sind. Daran lässt sich sehen, in welcher Weise die Literaturwissenschaft des 20. Jh. immer schon auf kulturwissenschaftliche Weise mit anderen Disziplinen vernetzt gewesen ist und wie sie aus kulturtheoretischen Ansätzen literaturtheoretisches Potential zu schöpfen vermochte. Beispielsweise hat die Dekonstruktion die Literaturwissenschaft auf ganze neue Weise „das Lesen gelehrt“: indem sie auf die „Ränder“ der Texte, d. h. das in ihnen Verdrängte und scheinbar Unwesentliche aufmerksam gemacht hat. B) Diese Theorien stehen zueinander in einem Verhältnis „zugelassener Pluralität“. Keine kann wirklich und letztgültig beanspruchen, die alleinige Erklärung zu besitzen, was Literatur ist. Vielmehr muss
[23]
von einem Ergänzungsverhältnis gesprochen werden. Dort, wo die eine Theorie bspw. stärker die negativistischen, auf Bedeutungszersetzung gerichteten Energien literarischer Texte betont (Dekonstruktion), kann die andere die sinnstabilisierenden, zweifellos ebenso realen Potentiale von Literatur dagegen halten (Hermeneutik). Die Widersprüche, aus denen bestimmte Theorieprofile hervorgehen (Strukturalismus – Poststrukturalismus, Hermeneutik – Dekonstruktion), sind so in der historischen Gesamtschau vielmehr als Ergänzungen zu verstehen, die der Komplexität des in sich widerspruchsvollen Phänomens „Literatur“ gerecht zu werden suchen. Die Theorie der Theoriebildung spricht hier von „irreduzibler Paradigmenpluralität“: „Unterschiedliche Paradigmen vertreten abweichende Grundvorstellungen von dem Rationalitätstyp, für den sie stehen. Mangels eines Metakriteriums läßt sich zwischen diesen Optionen aber keine verbindliche Entscheidung mehr treffen, so daß die Pluralität der Paradigmen und Optionen unbeendbar ist.“ (Welsch 1996, S. 606). C) Diesen Literaturtheorien ist es gemein, dass sie sich der Literatur zwar nicht ausschließlich, aber doch in beträchtlichem Maße unter einer methodologischen Fragestellung nähern. Sie zielen letztlich darauf, Anleitungen zu geben, mit welchen Instrumenten und auf welche Weise man sich der Literatur am angemessensten nähern soll. Diese „technische“ Ausrichtung bedingt viele Blickschärfungen auf das Phänomen, aber ebenso zahlreiche Ausschlüsse. Literaturtheoretische Fragen, die nicht unmittelbar methodologisch nutzbar zu machen sind, können dort nur unzureichend aufgenommen und diskutiert werden. Literaturtheorien sind also selektive, durch theoretische Kontexte und Interessen gefilterte und methodisch ausgerichtete Antworten auf die Liste von Fragen, die mit dem Literaturbegriff zusammenhängen.
Demgegenüber soll der Terminus „literarische Ästhetik“ in diesem Band eine historische wie systematische Vorzeitigkeit gegenüber den „Literaturtheorien“ deutlich machen. Zum einen wird mit diesem Begriff nämlich auf die historische „Vorgeschichte“ der neueren Literaturtheorien im 18./ 19. Jh. rekurriert und so deutlich gemacht, dass diese trotz aller Neueinsätze und Differenzen nur aus den Fragestellungen und Begriffsgeschichten dieses Kontinuums zu begreifen sind. Zum anderen will die „literarische Ästhetik“ ein Unternehmen sein, dass systematisch
[24]
die Grundlagen für methodische Literaturtheorien bereitstellt: indem sie kategoriale Fragen des Literaturbegriffs aufstellt und in ihren Antwortmöglichkeiten diskutiert. Diese Fragen liegen den methodischen, aus bestimmten Theoriegebäuden abgeleiteten Überlegungen der verschiedenen Literaturtheorien zugrunde. Sie bilden den Gesamthorizont, vor dessen Hintergrund die Literaturtheorien ihre Begriffe von Literatur bilden können, den sie aber deshalb immer nur partiell realisieren. Zudem ist mit der Bezeichnung „literarische Ästhetik“ auch der Gegenstandsbereich dessen, worauf sich die vorgestellten theoretischen Perspektiven beziehen, in seinem Bestand mit eingegrenzt: Objekt und Grundlage sind die Werke der „modernen“ Literatur, wenn man mit „Moderne“ die Großepoche seit der europäischen „Aufklärung“ des 18. Jh. meint. Das bedeutet keinesfalls, dass die im Folgenden erörterten Begriffs- und Problemdimensionen einzig und ausschließlich für literarische Werke seit dem 18. Jh. gelten können; aber man muss beachten, dass zahlreiche Zuspitzungen durchaus damit zu tun haben, dass sich in der Disziplin der „Ästhetik“ als Philosophie der Kunst die kulturelle Moderne Europas wesentlich mit begründet und deshalb das Interesse darauf gerichtet ist, der Modernität des Literarischen theoretisch zu genügen.
„Kategorie“ ist seit Aristoteles als Aussageschema definiert (Aristoteles 1998, 2a): Das sind Grundbegriffe, die in unserem Sprechen immer schon verwendet werden, damit wir überhaupt „Etwas“ sagen können, die aber selbst nicht mehr auf grundlegendere Begriffe zurückgeführt werden können. Man könnte sie somit als die Grammatik des Seienden bezeichnen. So ist laut Aristoteles bspw. ohne die Kategorie „Substanz“ kein sinnvolles Sprechen möglich. Wenn wir über Wirklichkeit reden, müssen wir diese in der Form fester, sich von Augenblick zu Augenblick nicht völlig verändernder Gegenstände – eben „Substanzen“ – ansprechen. Sonst könnten wir nicht sagen, über was wir da eigentlich reden und wem wir irgendwelche Eigenschaften zusprechen. Dieses innere Netz an Bestimmungen, das dem Gegenstand erst seinen Halt in der Wirklichkeit gibt, ist der „Anfang vor dem Anfang“: das, was nicht weggedacht werden kann, ohne den Gegenstand aufzuheben. Die „literarische Ästhetik“ will diese Grundbegriffe von Literatur in Form von Fragehorizonten auf übersichtliche Weise herausarbeiten.
[25]
Der Umgang mit derartigen kategorialen Fragen ist im Rahmen des Studiums der Literaturwissenschaft eine Bedingung der „Mündigkeit“ gegenüber dem Gegenstand (Literatur) wie auch gegenüber der Forschung. Das Wissen darüber, was Literatur ist und kann, sowie die Fähigkeit, Theoriezusammenhänge eigenständig zu durchdenken und möglicherweise zu verändern oder gar zu revidieren, sind dabei zwei Seiten wissenschaftlicher Freiheit. Nur mit einem solchen kategorialen Wissen und der Fähigkeit seiner reflektierten Anwendung erarbeitet man sich die nötige Distanz gegenüber dem Gegenstand, die unabdingbare Voraussetzung gerade der größten Nähe des Verstehens zu ihm ist. Im Sinne einer solchen Denkanleitung will das vorliegende Buch für den, welcher sich derartigen Fragen bisher nicht oder nur zögerlich genähert hat, einen Anfang möglich machen. Dabei ist es mit einer Landkarte vergleichbar: Es verzeichnet den Grundriss des Geländes, die begehbaren und unbegehbaren Wege, die Hauptverkehrsstraßen und Abzweigungen. Es ist nur so detailliert wie notwendig, um ein in sich hinreichend bestimmtes Wissen vom Verhältnis des Ganzen zu allen wesentlichen Teilen zu gewinnen (darin übrigens aller guten Philosophie vergleichbar; Wiesing 2009, S. 15). Aber es nimmt einem nicht ab, hinzugehen und sich das Gelände anzuschauen, wenn man es wirklich kennenlernen will.
Kontrollfragen:
1. Erläutern Sie den historischen Unterschied zwischen „Literaturtheorie“ und „literarischer Ästhetik“!
2. Was versteht man unter „Theorie“?
3. Warum ist Theoriebildung für das vertiefte Verständnis von Literatur notwendig?
Literaturempfehlungen:
Szondi, Peter: Über philologische Erkenntnis. In: Szondi 1978, Bd. 1, S. 263 – 286.
Eagleton, Terry: Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart, Weimar 4 1997, S. 1 – 19 (Kap. 1)
Culler, Jonathan: Literaturtheorie. Eine ganz kurze Einführung. Stuttgart 2002, S. 9 – 64 (Kap. 1 und Kap. 2)
[26]
2

2.1

Die Geschichte der modernen Ästhetik beginnt mit Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 – 1762), einem Professor für Philosophie in Halle und Frankfurt/ Oder, der historisch der „Deutschen Schulphilosophie“, dem deutschen Zweig des Rationalismus, zuzuordnen ist. Als Rationalismus bezeichnet man historisch eine philosophische Richtung des 17. und 18. Jh., die den Verstand und die Vernunft als die wesentlichen Kräfte des Subjekts und der Weltordnung begreift. Demgegenüber hält der Rationalismus die sinnlich-natürliche Seite scheinbar für unwesentlich(er): Das reine Denken, nicht die sinnliche Erfahrung, wird als Medium wahrer Erkenntnis angesehen. In der rationalistischen Philosophie entspringt das moderne Denken: Von René Descartes (1596 – 1650) über Baruch de Spinoza (1632 – 1677) und Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) bis eben zu Baumgarten und Immanuel Kant (1724 – 1804), der die Paradigmen des Rationalismus und des ihm entgegengesetzten Empirismus zu vereinigen sucht, erstreckt sich eine (allerdings nicht völlig homogene) Traditionslinie, in der die Philosophie aus ihren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Voraussetzungen heraustritt.