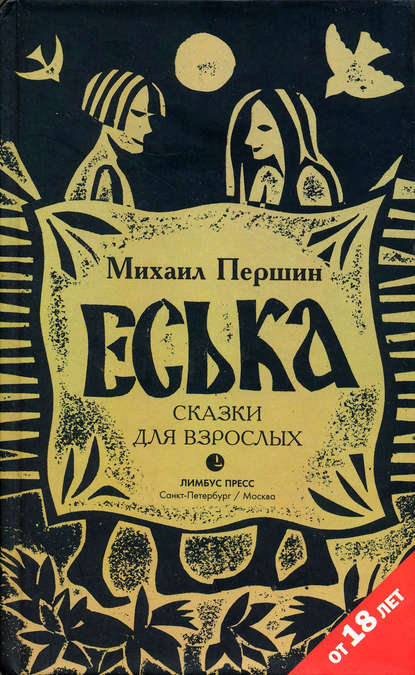- -
- 100%
- +
Mit Hegel tritt die Idee des Kunstwerks als organisch geschlossene, harmonisch geordnete Ganzheit in den Vordergrund, in der sich die Gegensätze von Subjektivität und Objektivität, Geistigkeit und Sinnlichkeit, Einzelnem und Ganzem versöhnen. Damit soll im Schönen des Kunstwerks als Ausdruck dieser Versöhnung das ‚Absolute‘ selbst zur Anschauung kommen; eine Idee, die bei Schiller (Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795) und Schelling (System des transzendentalen Idealismus, 1800) bereits angedacht und in zahlreichen weiteren ästhetischen Entwürfen der Goethezeit (bspw. Karl Philipp Moritz) leitend geworden ist. Das konstitutive Bezogensein der verschiedenen thematischen Dimensionen der neuen Disziplin Ästhetik auf das Schöne, dem allerdings nicht erst mit der Rezeption von Edmund Burkes Schrift Philosophische Untersuchungen über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen (1757) das Erhabene an die Seite tritt, bestimmt den Raum der klassischen Ästhetik der Goethezeit.
Der Verlust des gemeinsamen Horizonts des Schönen bezeichnet hingegen im 19. Jh. den Eintritt in die ‚moderne‘ Ästhetik. Der Aus-
[38]
druck ist allerdings mit Vorsicht zu gebrauchen. Es ist nämlich gerade das Kennzeichen der ästhetischen Entwürfe der nachgoetheschen Ära, anstelle der thematischen Einheitlichkeit und begrifflichen Übersichtlichkeit der klassischen Ästhetiken des späten 18. und frühen 19. Jh. eine unübersichtliche Vielzahl kleinteiliger Kategorien zu setzen. Diese sind oft höchst einzelwerkbezogen sowie zueinander inkommensurabel und überschreiten noch dazu die Wissenschaftsdiskurse, indem sie oft die Grenzen zu den modernen Natur- und Sozialwissenschaften ignorieren.
Im Schönen erscheint die Wirklichkeit in sinnlicher Weise als geordnet, harmonisch, ganz und als Ausdruck eines höheren Sinns. Mit dem Verlust dieser quasi-religiösen Erfahrung in den modernen Lebenswelten des 19. Jh., die bereits durch Industrialisierung, urbane Vermassung, Verarmung, Beschleunigung der Veränderungen und Unübersichtlichkeit der Verhältnisse sowie durch individuelle bzw. kollektive Entfremdung gekennzeichnet sind, geht auch die Möglichkeit verloren, die Wirklichkeit in der Weise schöner Darstellung zu repräsentieren. Diese Diagnose findet sich in Bezug auf ästhetische Fragen bereits in Hegels Beschreibung der Bedeutung der Kunst bzw. Poesie für die Gegenwart seiner Zeit: zum einen darin, dass Hegel der Kunst nicht mehr zuspricht, die höchste Form der Verwirklichung der Kultur zu sein. Einer Kultur wie der modernen ist es nicht mehr möglich, ihre komplizierten Verhältnisse und Strukturen durch Kunstwerke zu repräsentieren und damit zu begreifen:
Man kann wohl hoffen, daß die Kunst immer mehr steigen und sich vollenden werde, aber ihre Form hat aufgehört, das höchste Bedürfnis des Geistes zu sein. (Hegel 1997, Bd. 1, S. 142)
Dieser vielbesprochenen These vom ‚Ende der Kunst‘, die aber nur ein Ende ihrer höchsten Funktion als einziger und vollkommenster Ausdruck des Ganzen der Wirklichkeit ist, steht aber noch eine andere Hinsicht zur Seite. Hegel diagnostiziert auch eine Entwertung der Lebenswelt selbst, einen Verlust an unmittelbarer Einheit von Dasein und Sinn, ein Auseinandertreten von Wirklichkeit und ihr einwohnender, unmittelbarer Vermittlung mit Vernunft und kollektiver Bedeutung. Diese „Prosa der Verhältnisse“ (Hegel 1997, Bd. 3, S. 393) einer durch umfassende Modernisierung vom Sinnverlust bedrohten Wirklichkeit, der das Individuum
[39]
mit seinem Sinnverlangen entgegensteht, wird für Hegel im Roman zur Anschauung gebracht und reflektiert.
Damit bereitet er eine These vor, die von Ästhetikern und Literaturtheoretikern des 20. Jh. wie Georg Lukács oder Walter Benjamin aufgenommen und ausgeführt wird. Im modernen Roman, der mit den realistischen französischen Romanen des 19. Jh. (Balzac, Zola, Flaubert etc.) seinen ersten Höhepunkt erreicht, werde die „transzendentale Obdachlosigkeit“ des Menschen (Lukács), seine fundamentale soziale Einsamkeit und damit seine Entfremdung von allen Arten kollektiven Ausdrucks wie Erzählen (Benjamin) zum Thema gemacht (Kap. 9.1). Dementsprechend sind die Kategorien der ‚modernen‘ Ästhetik, wenn man diese überhaupt derart charakterisieren kann, durch Dissonanz, Verfremdung, Negativität, Reflexivität und Verdunkelung des Sinns bestimmt.
Statt der objektiven Harmonie großer Kunst steht schon beim Frühromantiker Friedrich Schlegel (1772 – 1829) das am einzelnen Subjekt orientierte ‚Interessante‘ der Darstellung im Mittelpunkt; statt des Schönen rückt das Hässliche theoretisch bei Karl Rosenkranz (Ästhetik des Häßlichen, 1853) und poetisch in den Gedichten Baudelaires und den Romanen Flauberts ins Zentrum der Aufmerksamkeit; das Böse bzw. das Amoralische der Kunst betont der europäische Ästhetizismus des 19. Jh. gegen die klassische Einheit des Wahren, Guten und Schönen; semantische Verdunkelung und Hermetisierung der poetischen Darstellung entziehen seit dem französischen Symbolismus der Dichtung die Selbstverständlichkeit eines immer schon gelungenen Verständlichseins von Welt. Verfremdung, Fragmentierung, Plötzlichkeit, Schock und das Ins-Zentrum-Rücken der Materialität der Sprache werden in den Avantgarden des 20. Jh. wie dem Expressionismus zu poetischen Kategorien des Gegenentwurfs zur klassischen Werkeinheit und der überhöhten Harmonie von Welt und Darstellung (vgl. Bürger 1974). Zugleich wirken jedoch die wirkmächtigen Vorstellungen klassischer Ästhetik bei vielen Autoren und Theoretikern, wenn auch oft gebrochen, weiter. So entsteht ein kompliziertes Nebeneinander theoretisch-begrifflicher Muster, das keine verbindliche Orientierung mehr bieten kann, dafür jedoch die künstlerische Freiheit gegenüber dem Formen- und Begriffsvorrat der ästhetischen Tradition weiter geöffnet hat.
[40]
2.4

Diese Vorlesungen sind der Ästhetik gewidmet; ihr Gegenstand ist das weite Reich des Schönen, und näher ist die Kunst, und zwar die schöne Kunst ihr Gebiet. Für diesen Gegenstand ist der Name Ästhetik eigentlich nicht ganz passend, denn „Ästhetik“ bezeichnet genauer die Wissenschaft des Sinnes, des Empfindens […]. Wir wollen es deshalb bei dem Namen Ästhetik bewenden lassen, weil er als bloßer Name für uns gleichgültig und außerdem einstweilen so in die gemeine Sprache übergegangen ist, daß er als Name kann beibehalten werden. Der eigentliche Ausdruck jedoch für unsere Wissenschaft ist „Philosophie der Kunst“ und bestimmter „Philosophie der schönen Kunst.“ (Hegel 1997, Bd. 1, S. 13)
Als Hegel in den 20er Jahren des 19. Jh. diese einleitenden Bemerkungen zu seinen Vorlesungen über die Ästhetik verfasst, liegt die bewegte Zeit, in der sich der Begriff „Ästhetik“ konstituiert (ca. 1750 – 1800), bereits hinter ihm. Von einem Terminus, der eine Theorie der sinnlichen Wahrnehmung und des besonderen sinnlichen Ausdrucks bezeichnet (Baumgarten), zu einer Bezeichnung für die besondere Raum- und Zeitanalyse des transzendentalen Subjekts (Kant) bis zum Namen für eine Philosophie des Schönen (Kant, Schiller) und eben noch enger gefasst für eine Philosophie der schönen Künste (Schelling, Hegel): Alles sollte irgendwie in diesem neuen Begriff einmal untergebracht werden. Benutzt man den Begriff heute, ist es also angezeigt, genau zu markieren, welche Art von Gegenstandsbereich man damit meint. In diesem Buch soll in der Tradition Hegels „Ästhetik“ als Begriff für eine Disziplin gebraucht werden, die sich um die begrifflichen Grundlagen der Kunst kümmert – mit der Einschränkung, dass hier nicht von der Kunst, sondern nur von Literatur die Rede ist, und weiterhin, dass die für Hegel noch selbstverständliche Beilegung des „Schönen“ nach den Umbrüchen der Moderne wegfällt.
Für eine Ästhetik als kategorial orientierte Theorie der Literatur setzt man allerdings sinnvollerweise folgende disziplinären Verhaltensweisen voraus: Es ist erstens ratsam, die disziplinären Grenzen, die sich in der Wissens(chafts)kultur der Moderne für den Raum der Literatur herausgebildet haben (Rhetorik – Ästhetik – Hermeneutik – Linguistik – Semiotik etc.), gerade aufgrund der untergründigen thematischen Verengungen,
[41]
aus denen sie entstehen, zu überschreiten. Denn nur so bekommt man den Begriff des Gegenstandes Literatur möglichst umfassend in den Blick. Dafür ist es zweitens notwendig, gegen die systematischen Beschränkungen der Theoriebildung stets die wirkliche Vielfalt der literarischen Werke im Blick zu behalten: ihre konzeptionelle Individualität wie formensprachliche Abweichung. Diese Vielfalt ist historisch sicher nirgends so abwechslungsreich, komplex und experimentierfreudig gestaltet wie in der sogenannten ‚Goethezeit‘ (ca. 1750 – 1830), in die auch die Entwicklung der Ästhetik als Disziplin im Kanon moderner Wissenschaften vom Menschen fällt. Die literarhistorisch aufschlussreiche Rede vom „skeptischen Milieu“ der modernen Literatur (vgl. Willems 2003) bedeutet auch, dass in den konkreten Werken des Kanons sehr oft die bewusste Überschreitung und Transformation vermeintlich ‚fundamentaler‘ Bestimmungen literarischer Kunst zu finden sind, welche durch Theorie und Gattungstradition vorgegeben werden. Dagegen setzen die Werke die unendliche Vielfalt literarischer Darstellungsmöglichkeiten, die erst am konkreten Gegenstand der Darstellung entstehen kann. Keine Theoriebildung der Literatur umfasst oder ersetzt gar den Formen- und Sinnhorizont der Werke von Goethe, Schiller, Wieland oder Hölderlin. Aber sie soll Perspektiven eröffnen, in deren Korrektur durch das Einzelwerk sich dessen angemessen verstehende Wahrnehmung erst herausbilden kann. Was Kant im Rahmen seiner Erkenntnistheorie über das Verhältnis von Begriff und Anschauung gesagt hat, gilt prinzipiell auch für die Komplementarität von literarischem Werk und theoretisch-begrifflich fundiertem Verstehen, das seine Kategorien aus der Geschichte der literarischen Kunst gewinnt: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (Kant 2004, Bd. 1, S. 135 [B 75])
[42]
Kontrollfragen:
1. In welcher Weise hängt die Entstehung der Disziplin „Ästhetik“ mit dem Epochenhintergrund der „Aufklärung“ zusammen?
2. Erläutern Sie Baumgartens Konzept der „sinnlichen Prägnanz“ (perceptio praegnans) ästhetischer Vorstellungen!
3. Welche grundlegenden Themen kennzeichnen die „klassische“ und die „moderne“ Ästhetik?
Literaturempfehlungen:
Franke, Ursula: Kunst als Erkenntnis. Die Rolle der Sinnlichkeit in der Ästhetik des Alexander Gottlieb Baumgarten. Tübingen 1972.
Scheer, Brigitte: Einführung in die philosophische Ästhetik. Darmstadt 1997.
Tatarkiewicz, Wladyslaw: Geschichte der sechs Begriffe Kunst, Schönheit, Form, Kreativität, Mimesis, Ästhetisches Erlebnis. Frankfurt a. M. 2003.
[43]
3

3.1

Die Eigentümlichkeit des Begriffs „Ontologie“ ist es, dass in ihm Name und Sache historisch auf merkwürdige Weise auseinandertreten. Denn spricht man in philosophischen Zusammenhängen von „Ontologie“, so meint man gewöhnlich eine bestimmte Weise des Nachdenkens, die auf sogenannte „letzte“ Gegenstände bezogen und zugleich historisch eng mit den Ursprüngen der abendländischen Philosophie, vor allem mit den Namen „Platon“ (428/ 427 v. Chr. – 348/ 347 v. Chr.) und „Aristoteles“ (384 v. Chr. – 322 v. Chr.) verbunden ist. Der Begriff selbst allerdings ist neuzeitlichen Ursprungs. Er kommt wohl zuerst im 17. Jahrhundert auf und wird prominent durch ein Werk von Christian Wolff, dem bedeutendsten deutschen Schulphilosophen des 18. Jh.: Philosophia prima sive ontologia. Erste Philosophie oder Ontologie. Nach wissenschaftlicher Methode behandelt, in der die Prinzipien der gesamten menschlichen Erkenntnis enthalten sind. (1730) Somit entsteht der Begriff „Ontologie“ zu einer Zeit und im Raum eines Nachdenkens, welches sich von den antiken Ursprüngen, auf die er beständig bezogen worden ist, in vielen Hinsichten so weit wie möglich entfernt hat.
„Ontologie oder Erste Philosophie ist die Wissenschaft des Seienden im allgemeinen oder insofern es Seiendes ist.“ (Wolff 2005, §1, S. 19) Mit dieser Bestimmung der Ontologie als der „allgemeinen Metaphysik“ folgt Woff im Grunde Aristoteles. Denn der hatte im 4. Buch seiner Metaphysik von einer Wissenschaft gesprochen (ohne dafür einen Namen zu haben), die „das Seiende, insofern es seiend ist“ (Aristoteles 2003, S. 191 [IV 1, 1003a 21]), zu behandeln habe. Als Wissenschaft, welche „die ersten Prinzipien und ersten Begriffe“ (Wolff 2005, § 1, S. 19) untersuche, sei ihr Gegenstandsbereich notwendig darauf beschränkt, das allem Seien-
[45]
den Gemeinsame, also das Sein selbst in seinen Grundbestimmungen, zu erarbeiten: „Da die Ontologie vom Seienden im allgemeinen handelt (§ 1), muß sie das beweisen, was allen Seienden entweder absolut oder unter einer gewissen Bedingung zukommt.“ (Wolff 2005, § 8, S. 31) Neu ist bei Wolff gegenüber Aristoteles jedoch die scharfe disziplinäre Trennung in eine „allgemeine Metaphysik“ (= Ontologie) und eine „besondere Metaphysik“. Die Ontologie als allgemeine Metaphysik soll sich mit den abstrakten Prinzipien des Seienden überhaupt befassen, die besondere Metaphysik mit den Gründen der verschiedenen Weisen des konkret Existierenden (Gegenstände – Welt – Seele – Gott). Für Aristoteles hingegen war die Fundamentalwissenschaft der „Metaphysik“ (wobei ihm auch dieser Begriff nicht zu Gebote stand), d. h. die Untersuchung der Grundlagen des Seienden, untrennbar mit der Untersuchung der letzten transzendenten göttlichen Ursache alles Seienden verbunden: Wer darüber nachdenkt, was das verschiedene Gemeinsame und Bleibende in allem Einzelnen der Wirklichkeit ist, muss demnach auf das nichtverschiedene Letzte der göttlichen Einheit zurückgehen. Als Wissenschaft von den letzten, nicht weiter rückführbaren Prinzipien der Wirklichkeit und den höchsten, das Sein auf vollkommene Weise verwirklichenden Gegenständen fallen bei Aristoteles Metaphysik und Ontologie zusammen. Die Suche nach der arché, dem Grund und Ursprung allen Seins in einem singulären Stoff oder Prinzip, war bereits ein Zentralimpuls der sogenannten „vorsokratischen Philosophen“ wie Heraklit, Parmenides oder Anaxagoras. Aber erst durch Platon und Aristoteles hat diese Zielrichtung des Denkens dann jene systematische Ausarbeitung erfahren, welche der gesamten Philosophie und Theologie des Abendlandes die entscheidenden Rahmenbedingungen gegeben hat.
Wenn man sich vor diesem historischen Hintergrund die Frage stellt, welchen brauchbaren Begriff von „Ontologie“ man zur Hand haben sollte, so ließe sich darauf folgendermaßen antworten: Ontologie ist traditionell die Theorie von den allgemeinsten und grundlegendsten Bestimmungen des Seienden – die Theorie davon, was das Seiende (noch bevor es weiter bestimmtes Seiende wie Hund, Kegelbahn, Roman oder „Hans“ ist), zu einem überhaupt Seienden macht. Damit fragt die Ontologie seit Aristoteles nach den „Kategorien“, d. h. den „obersten Gattungen“
[46]
(megisté gené bei Platon) des Seienden. Kategorien sind nach Aristoteles die allgemeinsten Bestimmungen des Seienden: also Grundbegriffe, durch deren Benutzung man die allgemeinen Formen und Eigenschaften von Seiendem explizieren kann, die aber selbst nicht wieder auf allgemeinere Begriffe rückgeführt werden können. (Zum Test dieser Nicht-Rückführbarkeit: Versuchen Sie einmal, den Begriff der „Qualität“ zu definieren, ohne den Begriff bzw. seinen Inhalt selbst zu Hilfe zu nehmen!) In der Kategorienschrift entwirft Aristoteles ein System von 10 Kategorien, die sowohl Seinstypen als auch Aussageschemata sind und sich nochmals in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe besteht nur aus der ersten Kategorie, der Substanz (nur noch näher unterschieden in „erste“ und „zweite“ Substanzen). Von ihr gilt, dass sie die Zentralkategorie ist, weil die anderen 9 Kategorien, welche die zweite Gruppe bilden (Quantität – Qualität – Relation – Ort – Zeit – Lage – Haben – Wirken – Leiden), stets auf Substanzen bezogen und deshalb „akzidentell“ sind (zur Bedeutung dieses Ausdrucks weiter unten). Seit der rationalistischen Verpflichtung des wissenschaftlichen Denkens auf „Klarheit“ und „Deutlichkeit“ in der Neuzeit (Kap. 2) sowie auf die beinahe ausschließliche Gleichsetzung von „Rationalität“ und „Begründbarkeit“ (vgl. Habermas 1981, Bd. 1, S. 27) stellt sich dabei jedoch das begründungstheoretische Problem, wie denn diese letzten Grundbegriffe des Seienden wiederum wissenschaftlich gesichert gefunden, erkannt und dargestellt werden sollen. Denn als Bedeutungsweisen, welche die Grundlage all unseres Sprechens abgeben, können sie nicht innerhalb der Diskurse und Sprechweisen begründet werden, weil man für diese Begründungen sie immer schon voraussetzen muss und so in einen logischen Zirkel gerät. Deshalb sind auch hier vermehrt Kunst und Dichtung als mögliche Weisen begriffen worden, die Bedeutungsräume unserer sprachlichen Weltverhältnisse zu erkunden oder gar zu „stiften“ (Kap. 12.4).
Ein „klassisches“ Beispiel ontologischer Begriffsanalyse, das ebenfalls auf Aristoteles zurückgeht und sozusagen das „Grundgerüst“ seiner Ontologie abgibt, stellt also die Unterscheidung von „Substanz“ und „Akzidenz“ bzw. von „substantiellen“ und „akzidentellen“ Eigenschaften dar. Die substantiellen Eigenschaften sind diejenigen Eigenschaften, die eine Sache wesentlich ausmachen und deshalb nicht ‚weggedacht‘ werden
[47]
können, ohne das Sein der Sache selbst aufzuheben. Damit sind es die Eigenschaften, die einer Sache „an sich“ zukommen und als solche stets identisch und unveränderlich sind. Demgegenüber sind die akzidentellen Eigenschaften zufällig und veränderlich, weshalb sie das Wesen der Sache nicht modifizieren, sondern sozusagen nur dessen veränderliche Oberfläche betreffen. Substantielle Eigenschaften existieren nur als „an sich Sein“, d. h. einzig in Bezug auf sich seiend, während akzidentielle Eigenschaften dem Wort nach nur „in Bezug auf anderes Sein“ existieren: nämlich in Bezug auf das, an dem sie angelagert sind. Dieser Unterschied kann auch als Unterschied verschiedener Gebrauchsweisen des prädikativen „Ist“ erläutert werden. „Hans ist ein Mensch“ bestimmt das Menschsein von Hans als substantiell: nämlich so, dass Hans sein Menschsein weder abgeben noch ändern kann, ohne aufzuhören, Hans zu sein. „Hans“ ist hier von der Art der „ersten Substanz“ (Individuum), „Mensch“ von der Art der „zweiten Substanz“ (Gattungsbegriffe). „Hans hat graue Haare“ hingegen weist Hans eine akzidentelle Eigenschaft zu, weil „graue Haare haben“ nicht notwendigerweise zu Hans gehört und wir sogar annehmen können, dass Hans in seiner Jugend möglicherweise schwarze Haare hatte, sowie im hohen Alter überhaupt keine Haare mehr hat, ohne dadurch aufzuhören, Hans zu sein. In der Substanz sammeln sich die wesentlichen, dauerhaften und unabhängigen Bestimmungen einer Sache; sie ist das selbständig und real Seiende. Deshalb macht sie das eigentlich Seiende aus, wohingegen die Akzidenzien, weil sie nur an und durch Substanzen existieren (Graue-Haare-haben existiert nicht irgendwo als Sache unabhängig von Hans) und nicht deren Stabilität teilen, nur im abgeleiteten Sinne als seiend anzusprechen sind. (Diese Grundlage einer Substanzmetaphysik ist allerdings in der Tradition der abendländischen Philosophie in vielerlei Hinsicht kritisiert und auch verändert worden.) So lassen sich schließlich im Anschluss an Aristoteles verschiedene Bedeutungen von „ist“ angeben, welche die Grundlage ontologischer Analyse abgeben: Man unterscheidet 1. eine Existenzbedeutung von „sein“ („Hans ist“), von der das sogenannte „Wahrheits-Ist“, das sich auf das tatsächliche Bestehen von Sachverhalten bezieht, ein besonderer Fall ist („Es ist der Fall, dass Hans existiert“). Daneben gibt es 2. das „ist“ als Kopula, und zwar 2.1 einmal im Sinne prädikativer Verknüpfungen,
[48]
mit der (aristotelisch gesprochen) Substanzen Bestimmungen zugewiesen werden („Hans ist ein Mensch“), und 2.2 zum anderen im Sinne eines Identitäts-Ist, das deiktischen Charakter hat („Das ist Hans“).
Im Rahmen des vorliegenden Kapitels ist die „ontologische“ Fragestellung weitaus weniger fundamental gedacht, als es die Grundsätzlichkeit ontologischen Nachdenkens nahelegt. Schließlich geht es hier nicht um Sein an sich bzw. Seiendes im Allgemeinen, sondern um ein ganz bestimmtes „Seiendes“, nämlich die Literatur. Eine Ontologie der Kunst bzw. der Literatur kann also nur eine „Regionalontologie“ sein, weil sie sich mit einer ganz bestimmten Art von Seiendem befasst. Sie fragt nicht wie die „klassische“ philosophische Ontologie danach, was überhaupt „Sein“ ist und welche grundsätzlichen Formen von Seiendem es gibt. Die entsprechende Frage lautet demnach: Was für eine Art von Sein kommt literarischen Werken zu? Was mit dieser Frage nun eigentlich genau gemeint, ob sie überhaupt sinnvoll ist und auf welche wissenschaftliche Tradition sie sich bezieht, sollen die folgenden Abschnitte klären.
Die „Ontologie der Kunst“ als Untersuchungsfeld innerhalb der „Ästhetik“ bzw. der „Philosophie der Kunst“ entsteht erst im 20. Jahrhundert und ist zuerst weitestgehend auf den angelsächsischen Sprachraum und dort genauer auf den Schulzusammenhang der „analytischen Philosophie“ beschränkt (einen zuverlässigen Überblick gibt der Sammelband von Schmücker 2005). Der relativ junge Entstehungskontext ist durch die Entwicklungen der Kunst des 20. Jahrhunderts bedingt, innerhalb derer bestimmte Fragestellungen überhaupt erst virulent geworden sind. Marcel Duchamps ready-mades (wörtlich: schon gemachtes, bereits fertig Vorhandenes) wie bspw. Flaschentrockner von 1914 nämlich geben der modernen Kunst gleich zu Beginn des 20. Jh. eine neue Richtung. Das Kunstwerk wird nun nicht mehr vom Künstler „hergestellt“ und beruht auch nicht mehr auf seiner besonderen mechanischen Kunstfertigkeit (Kap. 7.3), die im antiken Begriff der „techné“ sogar das hervorragende Merkmal jeder Art von Kunst – ob nun Handwerkskunst oder Plastik – gewesen ist. Es ist kein einzigartiges „Original“, sondern bereits als singuläres Kunstwerk zugleich ein Massenprodukt, das sich nur durch die Signatur des Künstlers von anderen Exemplaren unterscheidet. Und schließlich ist in ihm die Darstellungsfunktion, der
[49]
Bezug auf das aristotelische Prinzip der „Mimesis“, der Nachahmung von Wirklichkeit (Kap. 8), extrem eingeschränkt: Der Flaschentrockner stellt nichts dar als sich selbst, er präsentiert sich in seiner Gewöhnlichkeit und dinglichen Gleichgültigkeit. Duchamps Provokation besteht darin, mit jahrtausendealten Konventionen der Herstellung und der Rezeption von Kunst zu brechen, indem er das altehrwürdige Konzept des „Werkes“ (Kap. 4.4) unterläuft. Warum soll dieser Flaschentrockner oder sogar das Urinal, durch welches das Konzept des „ready-mades“ 1917 weltweite Berühmtheit erhalten hat, überhaupt noch ein Kunstwerk sein? Wo ist das „Besondere“ an ihm, das, was nicht (scheinbar) jeder kann? Kann ein Gegenstand, der weder über seine Form noch über seinen Inhalt nach den Prinzipien künstlerischer Gestaltung und ästhetischer Wertschätzung rezipiert wird, trotzdem ein Kunstwerk abgeben? Die sogenannte „Krise des Werkbegriffs“ (Bubner 1989) in den Künsten des 20. Jh. nimmt von Duchamps „ready-mades“ ihren Ausgang und ist Symptom des kritischen Abstands, den die moderne Kunst von tradierten, für selbstverständlich gehaltenen Vorstellungen davon, was überhaupt ein Kunstwerk sei, genommen hat. Damit rückt aber die Frage, was für ein „Sein“ dem Kunstwerk überhaupt zukommt, im 20. Jh. ins Licht der Aufmerksamkeit. Wenn es möglich ist, alle bisher für konstitutiv gehaltenen Merkmale des „Kunstwerkseins“ abzuziehen und trotzdem noch ein Kunstwerk zu erhalten, stellt sich die Frage danach, ob Kunstwerke überhaupt eine eigenständige Entität sind, oder nicht vielmehr alles zum Kunstwerk „erklärt“ werden kann.
In jedem Fall hat die Kunst der „ready-mades“ und die Aktionskunst der Avantgarden dazu geführt, dass sich der Kunstbetrachter in modernen Galerien und Museen nie so ganz sicher sein kann, ob er da ein Kunstwerk vor sich hat bzw. was daran eigentlich das Kunstwerkhafte ist. Die Kunst selbst ist es hier gewesen, die eine bestimmte Weise der Philosophie der Kunst hervorgebracht und zu ihrem eigenen Thema gemacht hat: so sehr, dass bspw. Arthur C. Danto, einer der einflussreichsten amerikanischen Kunstphilosophen, die These vertritt, dass die moderne Kunst zu ihrer eigenen Philosophie geworden sei (Danto 1992, S. 37 – 40). Denn das „ready-made“ hat im Grunde keinen anderen Inhalt, als stets dieselben Fragen zu stellen: Bin ich Kunst? Was ist Kunst?