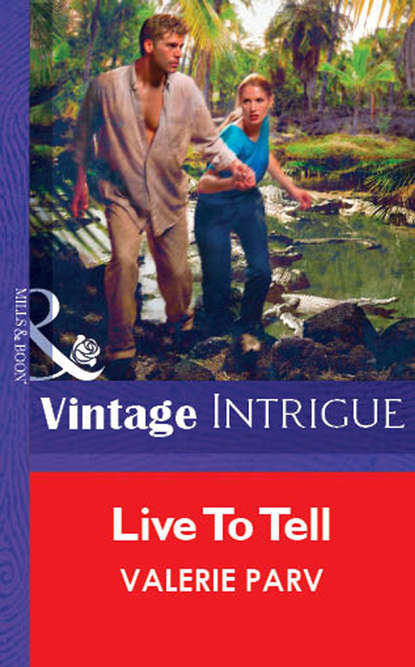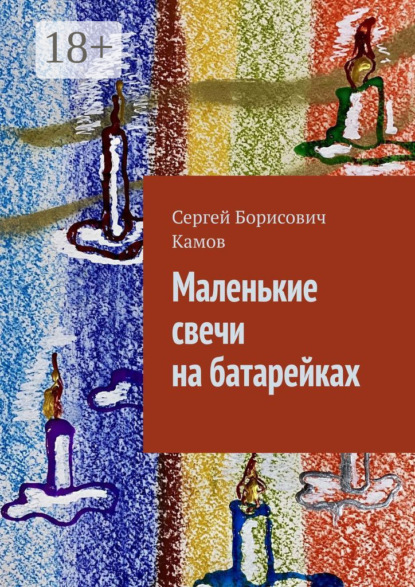- -
- 100%
- +
[50]
In sehr vereinfachter Form (zu einer genaueren Unterteilung vgl. Tegtmeier 2000) lassen sich indes zwei Hauptzielrichtungen der ontologischen Frage in Bezug auf die Kunst benennen. Man könnte auch sagen, dass zwei Bedeutungen von „Sein“ in diesen Grundfragen einer ästhetischen Ontologie ausdifferenziert werden: zum einen die Erörterung der „Art und Weise der Existenz von Kunstwerken“, zum anderen die „Bedingungen der Identität von Kunstgegenständen.“ (Schmücker 2005, S. 7) „Existenz“: Damit ist die Frage gemeint, in welcher Form Werke der Kunst eigentlich existieren. „Identität“: Diese Frage zielt darauf zu verstehen, wie und warum verschiedene Exemplare eines Werkes zusammengehören können und nicht als verschiedene Werke betrachtet werden müssen. Unter diesen beiden Fragerichtungen sollen nun im Folgenden Überlegungen zum Literaturbegriff angestellt werden. Vorher jedoch gilt es, an einem kanonischen Beispiel der Kunstontologie, das bezeichnenderweise gerade in einem dichterischen Werk „erörtert“ worden ist, die Relevanz und sogar Notwendigkeit einer solchen Fragestellung konkret werden zu lassen.
3.2

Eine frühe Erzählung des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges, die dessen Erzählband Fiktionen (1944) entstammt, trägt den Titel Pierre Menard, Autor des Quijote. An dieser kurzen Erzählung hat sich innerhalb der analytischen Kunstphilosophie ein Streit entfacht, der kunstontologische Fragen im engeren Sinn betrifft. Borges, einer der „Urväter“ der literarischen Postmoderne, ist ein hervorragender Vertreter eines Schreibens, das literarische und philosophische Kompetenzen auf virtuose und zugleich vergnügliche Weise miteinander verbindet. Gerade der „Menard“ und seine Wirkungsgeschichte legen davon Zeugnis ab.
Berichtet wird im (ironisch gebrochenen) Stil einer literaturwissenschaftlichen Betrachtung von Pierre Menard, einem fiktiven Autor des 20. Jahrhunderts, dessen vollständiges Werkverzeichnis das erzählende Ich geben und erläutern will. Dabei kommt der Erzähler schließlich auf Menards Hauptwerk zu sprechen:
[51]
Dieses Werk, vielleicht das bedeutendste unserer Zeit, besteht aus dem Neunten und dem Achtunddreißigsten Kapitel des Erstens Teils des Don Quijote sowie aus einem Fragment des Kapitels Zweiundzwanzig. Ich weiß, eine solche Behauptung klingt wie barer Unsinn. Diesen ‚Unsinn‘ zu rechtfertigen ist der Hauptzweck dieser Notiz. (Borges 1981, S. 116)
Die Pointe der Erzählung – wenn es sich denn überhaupt um ein Exemplar dieser Gattung handelt – besteht nun darin, dass das erzählende Ich nicht nur einsichtig zu machen versucht, dass es sich hierbei wirklich um zwei ganz verschiedene Werke handelt, obwohl beide Texte im Wortlaut bis auf den Punkt übereinstimmen. Darüber hinaus lautet das entscheidende Urteil des Erzählers sogar folgendermaßen:
Trotz dieser […] Hindernisse ist der fragmentarische Quijote Menards subtiler als der von Cervantes. […] Der Text Menards und der Text Cervantes‘ sind Wort für Wort identisch; doch ist der zweite nahezu unerschöpflich reicher.[…] Auch zwischen den Stilarten besteht ein lebhafter Kontrast. (Borges 1981, S. 120, 121, 122)
Kann ein Text, der in seinen bestehenden Teilen den Teilen eines anderen Textes – sogar einem überaus bekannten und bedeutenden kanonischen Text der Tradition – völlig und ohne Ausnahme gleicht, ein anderes Werk sein? Oder handelt es sich um ein Exemplar desselben Werkes? Beruht der faktische Unterschied von Werken nur auf der Kategorie der „Existenz“ – wo an diesem Beispiel doch einzig der fortgelassene Teil des Werkes einen Unterschied macht? Was verbürgt die Identität eines Werkes und seine Abgrenzung gegen andere Werke? Und was garantiert die Einheit wie Unterschiedenheit der Exemplare, die zu ihm gehören? Es sind genau diese Fragen, die der Menard von Borges stellt, und eben an ihnen hat sich die Diskussion entzündet, an der zwei der bedeutendsten analytischen Philosophen des 20. Jahrhunderts teil hatten, Arthur C. Danto und Nelson Goodman.
Arthur C. Danto thematisiert Borges‘ Text in seinem kunstphilosophischen Hauptwerk Die Verklärung des Gewöhnlichen (1981). Er nimmt den Borges‘schen Erzähler beim Wort, wenn er als These festhält: „[E]in Exemplar von Cervantes‘ Werk und ein Exemplar von Menards Werk sind Exemplare von verschiedenen Werken, obwohl sie sich ebensosehr
[52]
gleichen, wie Paare von Exemplaren desselben Werks.“ (Danto 1999, S. 64) Auch wenn diese Behauptung problematisch ist, weil sie umfangsgleiche Exemplare des Cervantes in eine Identitätsbeziehung zum nicht umfangsgleichen Menard setzt, bleibt daran doch das Hauptargument unangetastet. Das Menard-Problem berührt sich auf engste mit Dantos eigener kunstphilosophischer Fragestellung, nämlich der Definition von Kunst angesichts der Herausforderung der Philosophie durch die moderne Kunst. Denn Definition heißt wörtlich „Abgrenzung“ bzw. „Begrenzung“, und die Frage lautet demnach: Wie lassen sich Kunstwerke von Alltagsdingen abgrenzen, wenn es keine sichtbaren Unterschiede mehr zwischen beiden gibt? Diese „Unterscheidung des Ununterscheidbaren“ richtet sich nun auch auf die von Werken bzw. Werkexemplaren: Wodurch werden verschiedene „Vorkommnisse“ Exemplare eines Werkes – oder eben Verwirklichungen verschiedener Werke?
Dantos Antwort ist eindeutig und kann an dieser Stelle als „interpretationistischer Kontextualismus“ bezeichnet werden. Um Werkidentität zu bestimmen, reicht es nicht aus, auf das Werk allein zu blicken. Man muss vielmehr die konstitutiven „Kontexteigenschaften“ (Danto 1999, S. 82) einbeziehen, also die Entstehungsbedingungen, den Autor, den ideen- und kulturgeschichtlichen Hintergrund sowie die Traditionsbezüge als integralen Bestandteil des Komplexes „Kunstwerk“ betrachten (vgl. Danto 1999, S. 66; so auch Wollheim 2005; Kap. 13):
Ein zentrales Moment der Identität von Kunstwerken schien mir ihr historischer Ort zu sein. Daß etwas das Werk ist, das es ist, ja, daß es überhaupt ein Kunstwerk ist, hängt unter anderem davon ab, an welchem Punkt der historischen Ordnung es entstanden ist und mit welchen anderen Werken es dem historischen Komplex zugeordnet werden kann, zu dem es gehört. (Danto 1992, S. 17)
Ästhetische Unterschiede sind demnach keine „Wahrnehmungsunterschiede“ (Danto 1999, S. 77), „weil Kunstwerke ihrerseits mit den Interpretationen, die sie definieren, im Innersten verbunden sind“ (Danto 1992, S.17). An der physisch beschreibbaren Gestalt des Werkes selbst lässt sich nicht hinreichend seine Identität und Differenz zu anderen Werken festmachen. Der Don Quijote von Menard ist ein anderes Werk als der
[53]
Don Quijote von Cervantes, weil er die Literaturgeschichte und die kulturelle Welt, von der das Cervantes-Werk ein wichtiger Teil ist, bereits voraussetzt und darauf auf höchst komplexe Weise Bezug nimmt: „die vorgängige Existenz von Cervantes geht in die Erklärung von Menards Werk ein.“ (Danto 1999, S. 66) Menards Werk ist weder eine „Nachahmung“ noch ein „Zitat“ oder eine „Wiederholung“ von Cervantes Werk, sondern eine künstlerische Auseinandersetzung mit einer Tradition, die von Cervantes geprägt ist.
Um Nelson Goodmans dazu konträre Position richtig zu verstehen, ist es zuerst notwendig, eine Unterscheidung zu rekonstruieren, die er in seinem Hauptwerk Sprachen der Kunst (1976) vornimmt und die die kunstontologische Diskussion nachhaltig geprägt hat. Goodman unterscheidet dort „autographische“ von „allographischen“ Künsten (Goodman 1995, S. 113). Als „autographisch“ sind Künste definiert, die sich dadurch auszeichnen, dass es in ihnen den werkkonstitutiven Unterschied von „Original“ und „Fälschung“ bzw. „Kopie“ gibt und für die deshalb „selbst das exakteste Duplikat […] nicht als echt gilt.“ (Goodman 1995, S. 113) Deshalb ist für diese Künste die Entstehungsgeschichte laut Goodman ein wichtiges Instrument, um Originale zu markieren: „Nur die von Van Gogh gemalten ‚Sonnenblumen‘ gelten als Einzelfall des Werkes; jede noch so ähnliche Kopie ist schlicht eine Fälschung.“ (Spree 2002, S. 47) Darüber hinaus führt Goodman als weitere Grundunterscheidungen noch „einphasig/ zweiphasig“ sowie „singulär/ multipel“ ein (vgl. Goodman 1995, S. 113 – 115; Spree 2002, S. 47f.). So ist bspw. nicht notwendig jede autographische Kunst auch „singulär“, d. h. kennt stets nur ein Original: bei Drucken bspw. gibt es mehrere Originale.
„Allographisch“ sind dagegen Künste wie die Literatur, für die der Unterschied von Original und Fälschung keinen Unterschied macht. Eine Ausgabe von den Buddenbrooks ist keine Kopie oder gar Fälschung, sondern einfach ein Exemplar dieses Werkes. Die Originalhandschrift kann nicht sinnvoll als „Original“ im Sinne eines Gemäldes gelten, demgegenüber alle anderen Exemplare nur die Funktion einer „Abbildung“ oder „Kopie“ haben, sondern sie ist einfach nur ein ganz besonderes Exemplar des Werkes mit ganz besonderen Funktionen. Deshalb gilt laut Goodman für alle allographischen Künste, dass ihre Entstehungskontexte
[54]
für die Identität des Werkes nicht von Belang sind. Ob ein Exemplar zu einem literarischen Werk gehört, findet man nach Goodman nicht dadurch heraus, dass man seine historische Genese betrachtet, sondern einzig dadurch, dass man die materiellen Inskriptionen – also die wahrnehmbaren Buchstabenfolgen – miteinander vergleicht:
Es zählt allein das, was man die Selbigkeit des Buchstabierens nennen könnte: exakte Entsprechung in den Buchstabenfolgen, Abständen und Satzzeichen. Jede Folge – selbst wenn sie eine Fälschung des Manuskripts des Autors oder einer bestimmten Ausgabe ist –, die einer korrekten Kopie in dieser Weise entspricht, ist selbst korrekt, und ein solch korrektes Exemplar ist genauso Original wie das Original selbst. […] Allein durch die Feststellung, daß das Exemplar, das wir vor uns haben, korrekt buchstabiert ist, können wir entscheiden, daß es alle Anforderungen an das fragliche Werk erfüllt. (Goodman 1995, S. 115f.)
Es fällt in dieser Beschreibung auf, dass Goodman das hier durchaus wesentliche editorische Problem außer Acht lässt. Wenn es bspw. wie beim Hamlet von William Shakespeare oder dem Gedicht Mnemosyne von Friedrich Hölderlin keinen „originalen“ Wortlaut oder wie beim Ulysses von James Joyce keinen völlig unkorrupten Text gibt, stellt sich die Frage, mit was eigentlich die Exemplare verglichen werden sollen, um herauszufinden, ob sie zum Werk gehören, und wie die dafür notwendigen Kriterien konstituiert werden. Außerdem ist es ein durchaus intrikates Problem, substantielle von akzidentellen Veränderungen zu unterscheiden. Ist bspw. eine Ausgabe von den Buddenbrooks noch ein Exemplar des Werkes, wenn sie einen Druckfehler enthält? Wohl schon, denn dieser Fehler ist zu vernachlässigen. Was aber ist bei drei Druckfehlern? Oder zehn? Oder hundert (bei einem solch umfangreichen Werk nicht ungewöhnlich)? Was ist, wenn Sätze fehlen, oder irrtümlicherweise hinzugekommen sind? Wo liegt hier die Grenze, zwischen tolerierbaren Fehlern bzw. Abweichungen zu unterscheiden, die die Ausgabe noch zu einem Exemplar desselben Werkes machen, und solchen, die ein neues Werk konstituieren?
In jedem Fall gilt für Goodman ganz notwendigerweise in Bezug auf das Menard-Problem:
[55]
Wir behaupten jedoch, daß die angeblichen zwei Werke tatsächlich eines sind. […] Was Menard schrieb, ist schlicht eine weitere Inskription des Textes. […] Es ist derselbe Text, und er steht genau denselben Interpretationen offen wie die Einzelfälle, die bewußt von Cervantes, Menard und den verschiedenen anonymen Kopisten, Druckern und Setzern, die Einzelfälle des Werkes herstellen, inskribiert wurden. (Goodman 1993, S. 87f.)
Goodman führt dies nochmals in Bezug auf die Relation von Werk und Kontext eng:
Kunstwerke, deren Identität von ihrer Entstehungsgeschichte abhängt, kann man autographisch, Werke, deren Identität syntaktisch oder semantisch bestimmt ist, allographisch nennen. […] Von wem Don Quijote geschrieben wurde oder wann, das spielt schlicht für die Identität des Werkes keine Rolle. (Goodman 1993, S. 91; vgl. auch Goodman 2005)
Danto bestimmt die Werkidentität in enger Abhängigkeit von genetischen und semantischen Dimensionen: Ein Werk ist, was kulturhistorisch in einem bestimmten, zeitlich bedingten Bedeutungskontext mit einer bestimmten, historisch abhängigen Bedeutungsintention entstanden ist. Für Goodman fallen hingegen Werk und Interpretation kategorial auseinander: Das Kunstwerk ist ein materieller Gegenstand, den man durch physikalische Tests wie das Buchstabenvergleichen identifizieren kann. Bedeutungsfragen und die Entstehungskontexte, aus denen sie erwachsen, haben demnach mit der Identität des Werkes nichts zu tun.
Die kunstontologische Forschung hat Goodmans Grundunterscheidung von „autographisch“ und „allographisch“ zahlreicher Detailkritik unterzogen (vgl. Schmücker 1998, S. 189ff.; Patzig 2005; Menke 1991, S. 57 – 63). Das Menard-Problem von Borges hat indes sichtbar gemacht, welche Dimensionen das ontologische „Individuationsproblem“ (Tegtmeier 2000, S. 24) bzw. die Frage der „Identität“ oder „Fortdauer“ im Bereich der Theorie des Kunstwerkes annehmen kann. Dass sich diese Fragen natürlich nur bei den wenigsten konkreten Fällen stellen, heißt nicht, dass sie im systematischen Zusammenhang der Theorie von Literatur vernachlässigt werden dürfen. Mit ihnen wird vielmehr das Problembewusstsein möglich, um was für eine Art von Gegenstand es
[56]
sich bei Literatur handelt, und welche Herangehensweisen seiner besonderen ontologischen Signatur grundsätzlich angemessen oder unangemessen sind.
3.3

Die Existenzbedeutung von „Sein“, die man alltagssprachlich wohl für die vorherrschende oder gar einzige halten könnte, spielte in der antiken Philosophie keine wesentliche Rolle (vgl. Kahn 1976). Dafür nimmt sie spätestens seit dem 19. Jahrhundert und den Anfängen der sogenannten „Existenzphilosophie“ bei F. W. J. Schelling (1775 – 1854) und Sören Kierkegaard (1813 – 1855) einen wichtigen Platz im Spektrum des ontologischen Nachdenkens ein. In Bezug auf die Kunst und die Literatur zielt die Frage nach der Existenz auf die Art von Gegenständlichkeit, in der literarische Werke „wirklich“ sind.
In einer ersten und sehr grundlegenden Antwort wird diese Frage durch den Begriff des Textes beantwortet. Literarische Werke existieren demnach als Texte, d. h. (a) als geordnete Menge von sprachlichen Elementen, die (b) in einem semantischen Verweisungszusammenhang stehen (vgl. zu den Merkmalen von Textualität umfassend Kammer, Lüdeke 2005, S. 9 – 26). Mit einem solchen Textbegriff wäre die Frage nach Mündlichkeit oder Schriftlichkeit sogar noch unberührt: Denn die materielle Aufzeichnung würde als weitere Ebene von Textualität erst noch hinzukommen und ist weder in (a) noch in (b) notwendig integriert. Auch rein mündlich tradierte und inszenierte Literatur besteht als eine solche „geordnete Menge“ mit einer solcher semantischen Beschaffenheit ihrer Elemente, wenn diese auch durch die mündliche Form noch andere Struktureigenschaften aufweisen kann, die bspw. in dem Homerischen Epen auffällig sind (Wiederholungsfiguren, stereotype sprachliche Formulierungen etc.). Aber: Auch wenn es einer sich historisch verändernden Wahrnehmung unterliegt, welche Texte als literarisch gelten (Kap. 13.4, Kap. 14.2), so ist doch eben so gewiss, dass nicht alle Texte literarische Texte sind. Literaturontologisch stellt sich
[57]
also die Frage, ob „literarisch sein“ eine substantielle, d. h. wesentliche, oder eine akzidentelle, d. h. zufällige und der Gegenständlichkeit selbst äußerliche Prädikation ist. Kann Literatur als eigene Art von substantieller Gegenständlichkeit begriffen werden, auch wenn sich ihre Erscheinungsformen auf akzidentelle Weise historisch verändern und sie unzweifelhaft in der Form von Texten vorkommt – oder ist „literarisch sein“ nur eine akzidentelle Bestimmung von Textualität, so wie bspw. „streng gegliedert sein“, „in deutscher Sprache verfasst sein“ oder „aufgeschrieben sein“? Ob Literatur ontologisch im Begriff des Textes aufgeht oder nicht, ist demnach eine erste, grundlegende Frage literarischer Ontologie. Auch wenn sich hier eine Antwort beinahe selbstverständlich aufdrängt, so ist doch Vorsicht geboten. Natürlich existiert Literatur nur als Textlichkeit. Aber die Frage ist, ob ihre spezifische Art von Textualität eine eigenständige Klasse von Gegenständen konstituiert, die aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften zugleich nicht mehr bloß auf Textualität rückführbar sind und demnach als andere textuelle Gegenständlichkeit begriffen werden müssen. Anders gesagt: Die besondere Art der Gegenständlichkeit, die literarische Werke auszeichnet, ist wohl noch nicht erfasst, wenn man ihr Sein auf ihr Dasein als Texte zurückführt und beschränkt. Textualität im oben genannten Sinne ist notwendig, aber nicht hinreichend zur Bestimmung literarischer Werke: Und gerade eine Regionalontologie muss bestrebt sein, ihren Gegenstand über den Zusammenhang aller wesentlichen ontischen Merkmale und Eigenarten möglichst vollständig ontologisch zu bestimmen.
Eines dieser möglichen besonderen Merkmale ergibt sich aus der kunstontologischen Frage, ob dem literarischen Kunstwerk als dem „ästhetischen Objekt“ eine primär physische oder psychische Existenzform zukommt. Die beiden damit verbunden Paradigmen kann man „Physikalismus“ und „Mentalismus“ nennen (vgl. dazu ausführlich Schmücker 1998, S. 169 – 238, den ich im Folgenden rezipiere). Mentalistische Theorien der Kunst gehen von der Grundannahme aus, dass das Kunstwerk seinem Sein nach kein physisches Objekt ist, sondern eine geistige Entität, nämlich die subjektive Vorstellung entweder des Produzenten („produktionsästhetischer Mentalismus“) oder des Rezipienten („rezeptionsästhetischer Mentalismus“). Das eigentliche Kunstwerk wäre demnach im ersten Fall
[58]
das imaginäre Objekt im Geist des Künstlers, und seine Ausformung im Sprachmaterial nur eine akzidentelle Form seiner materiellen Speicherung. Eine solche Theorie ist dann zumeist (aber nicht notwendig!) mit einem Sprachverständnis verbunden, das den Signifikanten nur als äußere und unwesentliche Form des gedachten Inhalts (Signifikat) versteht (Platon, Aristoteles, Hegel). Darüber hinaus impliziert sie ebenfalls eine Auffassung des Künstlers, welche diesem die ‚Führungsrolle‘ im literarischen Prozess zuweist sowie die Rezeption nur als bloßes Nachvollziehen des ursprünglichen kreativen mentalen Aktes des Künstlers versteht. Im zweiten Fall hätte das eigentliche Kunstwerk seinen Ort im Geist des Rezipienten, weil es sich nur und erst durch dessen aktive Konstruktionsleistung zu einem ganzen Objekt vervollständigt (Sartre, Iser). Dann wäre auch hier der materielle Text nicht mehr als ein bloßes Formular, das die Anweisungen enthält, nach welchen Vorgaben der Rezipient das eigentlich literarische Objekt erst zu bilden habe. Sowohl der produktions- als auch der rezeptionsästhetische Mentalismus missachten dabei den Raum des Signifikanten, indem sie ihn als bloß äußeres Aufschreibemedium betrachten, ohne die für das literarische Kunstwerk irreduziblen Dimensionen seiner materiellen Sprachlichkeit zu beachten. Darüber hinaus muss der kunstontologische Mentalismus notwendig zur Annahme einer „epistemischen Privatheit von Kunstwerken“ (Schmücker 2005, S. 49) führen, die sich bereits aus der Praxis unseres Umgangs mit Kunstwerken heraus kaum – zumindest nicht ohne weitere Erklärung und Präzisierung dieses Paradigmas – halten lässt. Schließlich nehmen wir intersubjektiv auf literarische Kunstwerke als gemeinsame Gegenstände gerade auch dort Bezug, wo wir zu verschiedenen Interpretationen ihrer Bedeutung gelangen. Wie aber soll ein Kunstobjekt ‚gemeinsam‘ sein, wenn sein eigentliches Dasein in der subjektiven und nicht-mitteilbaren mentalen Repräsentation des Individuums liegt? Außerdem wird die Frage nach der Werkidentität im Raum des Mentalismus vollends problematisch: Streng genommen müsste jede neue Vorstellung, die der Rezipient durch einen Text (bspw. beim Wiederlesen) konstituiert, auch ein neues Werk sein.
Wenn auch die mentalistischen Theorien der Kunstontologie nicht besonders plausibel scheinen, so muss man sich doch vergegenwärtigen, dass sie teilweise als Antworten auf Probleme entstanden sind
[59]
(oder wiederaufgenommen wurden), die der auf den ersten Blick weitaus plausiblere kunstontologische Physikalismus mit sich bringt. Dem Physikalismus zufolge sind Kunstwerke mit den physischen Objekten identisch, in denen sie sich manifestieren; Nelson Goodman als ein wichtiger Vertreter dieser Auffassung ist bereits erwähnt worden. Dieser Ansatz hat den Vorteil der unmittelbaren Evidenz und beruht auf dem Hauptargument, dass materielles Ding und ästhetisches Objekt deshalb zusammenfallen, weil sie alle ihre Eigenschaften miteinander teilen – und also identisch sein müssen (dies ein Identitätskriterium von Leibniz, das Danto zitiert [Danto 1993, S. 64]). Aber genau dies scheint auf Kunstwerke eben nicht vollständig zuzutreffen. Zwar kann man die verschiedenen Beschreibungen, mit denen man sich jeweils auf Ding und ästhetisches Objekt beziehen kann (was dafür spricht, dass beide nicht zusammenfallen), durch die Aspektpluralität erklären, die an jedem Ding auftritt (vgl. Ziff 2005): „Der Roman ist flach“ kann sich wörtlich auch auf die Zweidimensionalität des Papiers und der gedruckten Zeichen beziehen, „der Roman hat Tiefe“ hingegen nur metaphorisch auf die Darstellungsweise des Inhalts, der durch die Zeichen vermittelt wird. Der Widerspruch beider Sätze deutet also noch nicht notwendig darauf hin, dass sich beide nicht trotzdem auf dasselbe und identische Objekt beziehen können. Trotzdem sind Ding und ästhetisches Objekt, Trägergegenstand und Darstellung, Text und Werk durch Merkmale voneinander getrennt, die es sehr schwer machen, beide einfach und vollständig miteinander zu identifizieren.
1. Wie in der visuellen Wahrnehmung, herrscht zwischen beiden zwar kein reines, aber doch ein weitreichendes Ausschlussverhältnis bezüglich ihres Rezeptionsvollzuges. Wenn ich den Text in seiner Materialität wahrnehme (bspw. die Papierqualität mit dem Finger prüfe oder die Linienführung der Schriftart bewundere), so kann ich nicht zugleich den Inhalt lesen und umgekehrt. Dass gerade Literatur (bspw. in der „Konkreten Poesie“) beide Dimensionen in ihrem Spannungsverhältnis oft übereinander projiziert und durcheinander vermittelt hat, ist kein Gegenargument, sondern baut gerade auf dem grundsätzlichen Gegensatz beider Blickrichtungen auf.
[60]
2. Textträger und Textwelt gehören (wie auch in der Bildenden Kunst Bildträger und Bildobjekt) grundsätzlich verschiedenen Wirklichkeiten an. Die Textwelt ist in Bezug auf die physikalische Textträgerwelt durch eine kategoriale Physiklosigkeit (vgl. dazu grundlegend Wiesing 2005, S. 160) gekennzeichnet, die zur Physikunterworfenheit des Textträgers in unvermittelbarem Widerspruch steht. Während nämlich der materiale Textträger, zumeist das Buch, altern kann und sich zerstören lässt, trifft dies auf die dargestellten Gegenstände außerhalb ihrer eigenen Zeitlichkeit nicht zu. Odysseus als Figur der Odyssee kann durch keine Aktivität unserer Wirklichkeit, die die Wirklichkeit des Textträgers ist, beeinträchtigt oder verändert werden; oder um ein schönes Beispiel von Danto zu zitieren: „Ich kann zwar den Mann, der den Hamlet spielt, mit einer reifen Tomate treffen, aber nicht Hamlet“ (Danto 1993, S. 63). Wo für visuelle Bilder wie z. B. Gemälde von einem Gegensatz von Zeitlosigkeit und Zeitverfallenheit als Grundbestimmung der verschiedenen physikalischen Signatur von ästhetischem Objekt und Ding auszugehen ist, trifft dies für literarische Textwelten allerdings nicht ohne Weiteres zu: Schließlich existieren literarische Gegenstände (Personen, Handlungen, fiktive Lebenswirklichkeiten etc.) als Zeitfolgen (vgl. Kap. 6.3). Diese eigene inhaltliche Zeitlichkeit literarischer Gegenstände ist aber eine gegenüber unserer Zeitlichkeit absolut autonome: Sie steht zu ihr in einem Darstellungs- und nicht in einem Kausalverhältnis. Das Leben von Hamlet bis zu seinem Tod bezieht sich zwar darstellend auf die Art und Weise, wie in unserer physikalischen Wirklichkeit Lebensverläufe sich ereignen und macht deren Zeitverfallenheit in gewisser Weise deutlich. Es kann aber zugleich in keiner Weise durch zeitlich strukturierte mechanische Einwirkungen eben dieser unserer physikalischen Wirklichkeit beeinflusst werden.