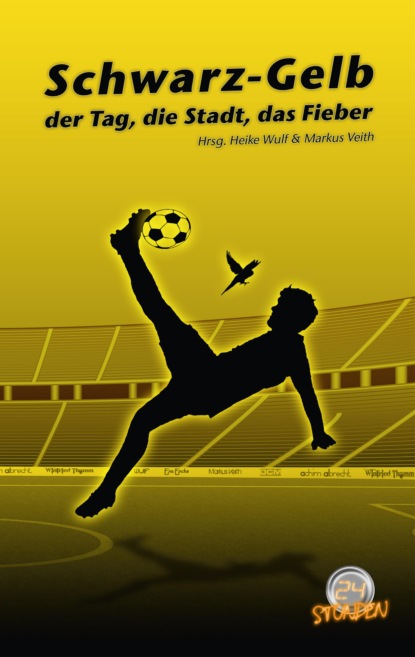- -
- 100%
- +
Madame Tussaud schaute verwirrt von Markus zu Dominik, der die Hände vors Gesicht schlug und schluchzte. Gerade, als sie einen Schritt auf ihn zu machte, um den Grund seines merkwürdigen Verhaltens zu ergründen … ein neues Spiel? … stieg ihr ein verführerischer Duft in die Nase. Direkt vor ihr lagen ein paar von den Nüssen, die Dominik ihr gegeben hatte, bevor Markus aufgetaucht war. Sie mussten bei ihrem Zusammenstoß mit dem Couchtisch dort vom Teller gerollt sein. Eilig verschlang sie eine nach der anderen, bevor ein anderer sie ihr streitig machen konnte.
„Das ist Lebensmittelfarbe“, hörte sie Dominiks Stimme über sich. „Das sollte doch der Clou sein: Madame als pinkfarbener Pudel mit Servierhäubchen und Spitzenschürze. Ich musste doch testen, welche Farbe das Fell annimmt.“
Madame Tussaud hatte weiträumig den Boden abgesucht, aber blitzschnell reagiert, als Markus sich eine Handvoll der Nüsse vom Teller nahm: hatte sich vor ihm in Position gebracht, sich hingesetzt, dabei aufgerichtet, die Vorderpfoten auf Brusthöhe angewinkelt, die Augenlider blinzelnd verengt … und Voilà! Mit diesem Trick hatte sie Markus das Leckerliewerfen beigebracht. Klappte immer, auch diesmal. Eine Nuss für sie, eine für ihn, eine für sie, eine …
„Dominik, sei doch vernünftig …“, Madame Tussaud öffnete erwartungsvoll das Maul, doch Marcus beugte sich plötzlich vor und spuckte direkt vor ihr auf den Boden. He, das war ja wie in ihrer Welpenzeit, als Mama für sie und die Geschwister immer das Futter hervorwürgte. Vor Aufregung vergaß sie ganz, dass sie eigentlich Durst hatte und dringend raus musste.
Markus wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. „Sag mal … was hast du denn da für ein ätzendes Zeug gekauft?“
„Schmeckt dir nicht? Schade aber auch!“
Madame Tussaud bemerkte, dass Dominiks Stimme gefährlich zufrieden klang.
„Das ist eine von meinen Kreationen für den Pink Puddle … selbst gesammelte Schafsköttel in Käsepanade und der absolute Renner bei sämtlichen Hunden der Umgebung.“
02:00 – 03:00
Dominik
Heike Wulf
Das war das Ende. Er hatte es in seinen Augen gesehen. Ganz deutlich.
Dominik nahm noch ein Glas Schampus. Einen schönen Abend – eine schöne Nacht wollte er mit ihm verbringen − und jetzt − jetzt war alles vorbei. Tränen schoben sich in seine Augen. Er wischte sie weg.
Madame Tussaud sah ihn erwartungsvoll an, winselte und wedelte. Tänzelte vor ihm her. Mit einem Seufzer nahm er sich die Hundeleine, schnappte sich eine Jacke und ging hinaus in Richtung Bolmke.
Madame Tussaud blieb an jeder Müllhalde stehen, die in den letzten Wochen ein nicht ertragbares Ausmaß angenommen hatten, und steckte ihren Riecher hinein. Dominik zog sie angewidert weg. Seit die blöde Müllabfuhr streikte, war es unerträglich geworden. Und dann diese Hitze. Echt widerlich. Das waren schon fast italienische Verhältnisse.
Italien. Er seufzte. Alles, was er dachte, alle Erinnerung liefen wie ein Wasserstrom in eine Richtung: Marcus.
Letzten Sommer hatten sie sich ein Haus am Meer gemietet, gerade mal 20 Kilometer von Rom entfernt. Marcus hatte sich, um ganz sicher zu gehen, die Haare auf einen Zentimeter kürzen lassen und blondiert. Fantastisch hatte er ausgesehen und mit seiner Armani-Sonnenbrille hatte ihn niemand erkannt. Sie konnten völlig normal, wie ein Liebespaar, miteinander umgehen. Keine Reporter, keine Angst. Außer einmal, da hatte ein kleiner italienischer Junge ein paar Fotos von ihnen beiden gemacht. Sie lagen nackt auf einem schwarz-gelben Handtuch und Madame Tussaud neben ihnen mit einem Fan-Käppi auf. Sie hatten zufällig mitbekommen, dass der Junge Fotos machte. Marcus war zu ihm gegangen und hatte ihm für die Kamera den dreifachen Preis geboten. Der hatte erst ungläubig geschaut, dann aber glücklich eingewilligt.
Es waren zwei traumhafte Wochen gewesen.
Aber jetzt war es vorüber. Ihre Beziehung – ihre Liebe beendet. Marcus würde nicht zurückkommen.
Dabei hatten sie sich bis jetzt so gut arrangiert.
Sicherlich, er war nicht glücklich darüber gewesen, dass sie sich nicht zusammen in der Öffentlichkeit zeigen konnten, aber er hatte es ja von Anfang an gewusst und respektiert. Für Marcus wäre es das Ende der Kariere gewesen. Aber später, danach, wollte er sich outen.
Es war klar, dass das alles ein Ende haben würde.
Genauso wie die getürkte Hochzeit mit Eva. Vermittelt! Wie lächerlich.
In Hamburg gab es doch tatsächlich ein Vermittlungsinstitut für schwule Fußballer. Er hatte einen Lachanfall bekommen, als Marcus ihm das erste Mal davon erzählt hatte.
Jetzt war ihm nur noch nach Heulen zumute.
Er setzte sich auf eine Bank. Es war stockdunkel und er fühlte er sich unwohl. Aber immerhin stank es hier im Wald nicht mehr so.
Madame Tussaud hatte er gleich zu Beginn des Waldes von der Leine gelassen und nun war sie nicht mehr zu sehen. Wo streunte sie nur herum?
Er rief sie mehrmals und endlich kam sie angerannt und sprang ihm gleich auf den Schoß. Normalerweise scheuchte er sie weg, wenn sie mit schlammigen Pfoten ankam, heute war es ihm egal.
Er knuddelte sein Gesicht in ihr weiches Fell und schluchzte: „Marcus, ach Marcus. Du bist mein Leben. Alles hab ich für dich aufgegeben. Alles. Meine Existenz, meine Freunde, meine Identität. Und du? Du verlässt mich.“
Er dachte an ihre erste Begegnung in Essen im El Brasil. Marcus hatte eine Maske aufgehabt. Oft ein Zeichen dafür, dass jemand dahinter steckte, der es sich nicht erlauben konnte, erkannt zu werden. Das „Brasil“ war ein exklusiver Laden. Hier kam nicht jeder rein.
Marcus hatte sich umgeschaut, Dominik gesehen und war gezielt auf ihn zugegangen. Erst hatten sie sich zusammen einen Film angesehen und aneinander rumgespielt − später waren sie in ein Separee verschwunden. Marcus hatte irgendwann seine Maske abgezogen und Dominik hatte es kaum fassen können. Marcus Schneider, Stürmer bei Schwarz-Gelb, Ausnahmetalent und … schwul.
Danach haben sie sich regelmäßig dort getroffen. Nach ein paar Monaten hatte Marcus ihm eine Wohnung in Dortmund gekauft. Angemeldet war sie auf Eva. Die Schein-Ehefrau von Marcus.
Er vergrub sein Gesicht noch tiefer in das Fell seines Pudels und weinte.
Als er wieder hochsah, entdeckte er einen schwarz-gelben Vogel, der sich neben ihm auf der Bank niederließ. Er sah genauer hin.
Hatte er jetzt Halluzinationen? Der sah aus wie ein Wellensittich. Aber die waren doch eigentlich nur gelb-grün. Es gab keine schwarz-gelben Wellensittiche. Zumindest hatte er noch nie einen gesehen. Er scheuchte ihn weg. Schwarz-gelb – er konnte es nicht mehr sehen.
Er musste daran denken, dass Marcus ihm Geld angeboten hatte. Als ob er eine Nutte wäre. Das hatte ihn am meisten verletzt.
120 Jahre war seine Kneipe im Familienbesitz gewesen. 120 Jahre. Seine Mutter sprach kein Wort mehr mit ihm, seine Geschwister hatten sich von ihm abgewandt. Sein Vater würde ihn umbringen, wenn er noch lebte.
Dominik hatte alles verkauft, um mit ihm nach Chelsea zu gehen. Und danach vielleicht auch noch nach Frankreich oder Spanien. Überallhin wäre er ihm gefolgt. Marcus war die Liebe seines Lebens.
Ohne ihn hatte sein Leben keinen Wert mehr.
„Es ist zu gefährlich in London. Es gibt so viele Paparazzi dort. Die Reporter sind dort anders. Denk an Lady Di. Wir können kein Risiko eingehen. Ich bin geliefert, wenn das raus kommt. Es ist aus. Endgültig.“
„Ich warte auf dich“, hatte er geschrien. „Ich hab alles für dich aufgegeben. Ich liebe dich!“
„Es geht nicht. Schluss. Aus. Vorbei!“, hatte Marcus kühl geantwortet.
„Ich hab meine Koffer schon gepackt – den Flug gebucht. Letztens hab ich mir im Internet ein paar zum Verkauf stehende Pubs angesehen. Ich hab schon einem Namen für den Laden: Purple Poodle. Und Madame Tussaud werde ich dann rosa färben. Das wird fantastisch. Die Engländer sind genau das richtige Volk dafür. Die sind so abgefahren. Bitte Marcus. Bitte!“
Er hatte ihn angefleht, geheult, geschrien. Aber Marcus hatte ihn mitleidig angeschaut.
„Brauchst du Geld? Ist es das?“
Er hatte ihn fassungslos angesehen. Dann war Marcus gegangen. Nicht mal die Tür hatte er hinter sich zugemacht. Er war verloren. Marcus hat ihn gedemütigt − verletzt.
„Das wirst du büßen, Marcus, das wirst du mir büßen und wenn es das Letzte ist, was ich auf dieser Welt tun werde!“, hatte er hinter ihm her geschrien.
Aber wie?
Er band Madame Tussaud die Leine um und sie folgte ihm widerspenstig.
Heute Morgen würde er Madame Tussaud bei seiner Tante abgeben. Sie war die Einzige aus seiner Familie, die noch mit ihm sprach. Auf dem Weg konnte er auch noch die Videos in der 24-Std.-Videothek abgeben.
„Stadt der Engel“, bestimmt zwanzigmal hatte er ihn sich schon angeschaut und „Ghost Rider“, das war ein Motorrad-Stuntman, der seine Seele verkauft und in der Gestalt eines feurigen Dämons durch die Nacht jagt. Ein cooler Film. Und auf Nicholas Cage fuhr er ab. Er hatte Ähnlichkeit mit Marcus. Seine Seele würde er jetzt auch verkaufen, wenn er wüsste, wie er sich rächen könnte. Aber ihm würde schon etwas einfallen.
03:00 – 04:00
Heinrich macht sich Gedanken
Achim Albrecht
Es ist nichts Tolles daran, wenn man aus Herne kommt. Es ist auch nichts Tolles daran, wenn man Heinrich heißt. Toll wird es erst dann, wenn man um 03:02 Uhr in einer fahlgrün gekachelten Toilettenzelle sitzt und sich dem Diktat seiner Prostata ergibt, die stillvergnügt vor sich hin wuchert und den Urin in winzige Tropfen portioniert, während der Harndrang eine volle Blase signalisiert. Voll um 23:11 Uhr, voll um 00:28 Uhr, voll um 01:56 Uhr, voll rund um die Uhr.
In der Umgebung von Heinrich starben die altbekannten Gesichter. Rentner wie er. Zigarrenraucher, feiste Quetschbäuche, blasse Beine mit arthritischen Gelenken, Frauen in Gesundheitswäsche, die noch wussten, wie man echtes Essen aus echten Zutaten zubereitete, Ärzte, die noch den Krieg mitgemacht hatten und wussten, dass es vier oder fünf Basiskrankheiten gab, die mit einem halben Dutzend Therapien und einer Handvoll Tabletten zu bekämpfen waren. Nicht solche schräg geföhnten Typen, wie sein neuer Hausarzt, der mit einem Zahnpastalächeln einem verdienten Rentner auf die Nerven fiel und neumodischen Schnickschnack einführen wollte. Außerdem war er aus Süddeutschland, knapp oberhalb Siziliens, wenn man Heinrich fragte. Die Stimme ein einziger flötender Singsang. Fehlte noch, dass er sich schminkte. „Anamnese“, flötete der Schönling, als Heinrich in seiner schönsten Cordhose zum Rapport erschien. Heinrich traute seinen Ohren nicht. Der Kerl wusste noch nicht einmal, wie man „Ananas“ aussprach und gefrühstückt hatte Heinrich schon um 05:30 Uhr, wie jeden Morgen, und zwar Graubrot mit Teewurst, frischen Zwiebeln und einen Pott Caro-Kaffee, richtig stark mit drei Löffeln Instantpulver. Nichts für süddeutsche Bübchen in gestärkten, weißen Schürzenkleidchen. Mein Gott, wo war man nur hingekommen in dieser Republik, in der alles vor die Hunde ging außer der Fußballbundesliga und auch die war nicht mehr, was sie war. Seit wann musste man beim Arztbesuch exotisches Obst essen?
,Er solle gefälligst den Arsch zusammenkneifen und wie ein Mann reden‘, sagte Heinrich zu dem Arzt und tastete nach seiner Schiffermütze, die wie angegossen auf seinem eisengrauen Quadratschädel saß. Der Jungarzt lächelte verständnisvoll. Solche Typen hatten für alles Verständnis. Windelweichgespült, aber innerlich voller Heimtücke. ‚Arsch zusammenkneifen‘. Als hätte Heinrich prophetische Gaben. Von wegen abtasten. Mit dem Finger in den Hintern. Das wollte das Bürschchen. Das könnte ihm so passen. Prostata. Dass Heinrich nicht lachte. Zwei Hände voll Kürbissamen und ein ordentlicher Aquavit und sein Entsorgungssystem wäre wieder auf vollem Strahl. Der alte Siegmund mit seinem fleckigen Stethoskop und seiner spöttisch rauen Art hätte ihn verstanden. Er hatte ihn immer verstanden. Sie waren zwei Kerle aus dem gleichen Schrot und Korn, wie sie heute nicht mehr wuchsen. Drei Sorten Tabletten hatte ihm Siegmund immer verschrieben. Blutdruck, grauer Star und Arthrose. Die drei Heimsuchungen des Alters. Einmal abhören. Einatmen, ausatmen, Zunge raus und in die Augen schauen. Dann fertig. ,Du wirst so alt, wie dein Herz mitmacht. Keinen Tag länger‘. Eine klare Ansage. Ein Händedruck. ,Glück auf‘. Zwei Sätze Fußballlatein mit auf den Weg. So ging Arzt.
Und jetzt das. Gebleckte Zähne, Kauderwelsch, Ananas auf ausländisch, seitlich auf die Pritsche legen, Hose runter, auch den Feinripp und in ein Gerät starren, das fiepend irgendwelche Linien auf einen Bildschirm schrieb. Bei dem Kugelroller und dem schmierigen Zeug auf dem Bauch hielt Heinrich noch mit zusammengebissenen Zähnen durch.
Dann kam die Sache mit dem Finger. Ein manikürter Mittelfinger in Plastiklümmeltüte. Und Heinrichs geheiligter Ausgang. Ein bislang unangetastetes Geflecht aus Raute, Haut und Haaren, verwöhnt durch die gelegentliche Kosmetik von zweilagigem Toilettenpapier von Aldi. AUSGANG, kein EINGANG. Das hatte die kleine Schwuchtel von Arzt wohl nie so richtig gelernt. Bestimmt einer aus so einem Mafia-Internat, in dem man rhythmisch klatschte, seinen Namen tanzte und dafür das Abitur nachgeschmissen bekam. Heinrich hatte davon gehört. Er war ja nicht von gestern. Auch er brauchte Dinge, vor denen er sich ekelte. Dazu gehörten Stinkefinger, die dorthin gehen wollten, wo nie eines Menschen Finger zuvor gewesen war und Ananas beim Arzt. Ja, wo war denn überhaupt die Ananas? Nicht, dass Heinrich Appetit auf Obst in Sirup gehabt hätte, aber versprochen war versprochen.
‚Entspannen‘ und ,nur kurz abtasten‘ war das Letzte, was Heinrich hörte, bevor er sich von der Liege wälzte, den Hosenbund an sich zog und dem säuselnden Süddeutschen zwischen die Beine trat. ,Geronimo‘ brüllte Heinrich, weil ihm nichts Besseres einfiel und weil er ein Kosmopolit war. Herne, Dortmund, Wanne-Eickel. Alles Kosmopoliten mit sauberer polnischer und italienischer Herkunft. Malocher vielleicht, aber mit Herz und Verstand. Dagegen vor ihm ein sich wie ein Wurm auf dem Boden windender Arztdarsteller aus südlichen Gefilden, der seine geschliffenen Manieren für einen Satz blitzblauer Eier eingetauscht hatte.
Tja, und jetzt saß man mitten in der Nacht auf der Toilette mit seiner altersgereiften Prostata und wartete unter Pressatmung auf den nächsten Tropfen und das Gefühl der Erleichterung, das keine zwei Stunden anhalten würde. Menschenunwürdig, dachte Heinrich und tastete nach der Zeitung. ,Meisterstück?‘, schrie es ihm entgegen. Darunter der Wetterbericht für das entscheidende Spiel der Schwarz-Gelben. Es sollte warm werden, eigentlich zu heiß für Ende Mai. Das Wetter war früher auch zuverlässiger. Wie alles. Heinrich stöhnte und schloss die Augen. Wo hatte er seine verdammten Zigarren gelassen? Ein ordentlicher Zug an einem Stumpen und wenigstens sein Stuhlgang würde funktionieren.
,Großes Polizeiaufgebot‘ las Heinrich. Polizei, meine Fresse, dachte er. Nach seinen Erfahrungen konnte man sich das schenken. Keine Zucht, keine Ordnung. So war das. Nach der Episode beim Arzt war Heinrich pflichtgemäß zur Polizei in der Nähe der Steinwache gegangen. Er war Deutscher. Er war 72 und ein aufrechter Bürger und er hatte Arthrose in den Knien. Irgendjemandem musste er doch Meldung über den unappetitlichen Vorfall machen. Heinrich schämte sich, aber sexuelle Belästigung war sexuelle Belästigung. Er würde dem Burschen das Handwerk legen. Heinrich hatte den Steilpass zwar punktgenau verwandelt und den Fummelarzt in ein Häufchen Elend verwandelt, aber danach war sein rechter Meniskus vollkommen defekt. Sogar seinen Spazierstock musste Heinrich holen. Auf der Wache ließen sie ihn in einem kahlen Räumchen sitzen, obwohl Heinrich wortstark einen sofortigen Einsatz verlangte, am besten mit einem Sonderkommando, solange der Sittenstrolch noch seine Spermien nachzählte.
Heinrich schluckte noch, dass kleine, blonde Mädchen Polizistin werden dürfen, er schluckte auch, dass er seine Geschichte auf alle unbedeutenden Kleinigkeiten wie Adresse, Uhrzeiten und den Grund des Arztbesuchs ausdehnen musste, während ein offensichtlicher Sexualverbrecher in der Maske eines Allgemeinmediziners Dortmund unsicher machte. Heinrich war kooperationsbereit bis zur Selbstaufgabe und mit der Geduld und Weisheit des Alters gesegnet. Was ihn aber in Rage brachte, war dieses blondhaarige Geschöpf in Polizeiuniform, die ihn nach endlosem Warten im Tonfall einer nachsichtigen Oberlehrerin darüber informierte, man habe mit der Arztpraxis telefoniert und der Arzt werde keine Strafanzeige stellen. Es handele sich offenbar um ein Missverständnis.
Missverständnis. Heinrich vergaß einzuatmen. Er vergaß die stechenden Schmerzen in seinem Knie. Das dümmliche Grinsen der uniformierten Göre hing über ihm wie ein geschminkter Lampion. Heinrich riss den Spazierstock nach oben.
Sein Einsatzkommando hatte er bekommen und Handfesseln dazu. Irgendein Clown von den Ruhrnachrichten war, Gott weiß woher, wie aus dem Nichts aufgetaucht und hatte von dem rabiaten Rentner Fotos gemacht. Der Rest würde in den Lokalnachrichten auftauchen. Von wegen rabiater Rentner, von wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Entrechtet, geknechtet, mit schweren Knieschäden und noch immer ohne Ananas. So verhielt sich die Sache. Heinrich würde das klären. Gründlich klären. Aber erst einmal brauchte er seine Tabletten und eine Mütze voller Schlaf. Schließlich war man keine Dreißig mehr und die Gestapo konnte gerne nach dem Spiel wieder vorbeikommen. Wahrscheinlich würden sie jetzt gerade mit einigen Hundertschaften von Drogensüchtigen, Pennern und anderen Kriminellen bei Champagner zusammensitzen und sich die Beute teilen. Wahrscheinlich ging es zu wie bei den Weiß-Blauen, die auch mal wieder eine aufs Maul brauchten und zwar kräftig.
Heinrich rieb sich das Knie, rieb sich die Handgelenke und starrte auf den amtlichen Zettel, der ihm im Behördenjargon eine Latte von Straftaten vorwarf. Heinrich griff nach den Resten seiner Tabletten. Er war empört, war entrüstet, war in seinem Normalmodus, nur irgendwie aufgeputschter. Er fühlte sich so lebendig wie schon lange nicht. So mussten die Schwarz-Gelben spielen. Genauso. Mit der gleichen Leidenschaft. Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und die Deutsche Meisterschaft. Darum ging es im Leben.
Heinrich zog die Schlafanzugshose hoch und betätigte die Spülung. Das Rauschen würde das ganze Haus wecken. Wie immer, wenn er sich von einem Toilettensitz hochstemmte, musste Heinrich an seine verstorbene Frau Ingeborg denken. Gott hab sie selig. Sie war ein richtiges Reibeisen gewesen und nie wirklich jung. Aber sie konnte kochen und bügelte Hemden wie keine zweite. Den Garten hatte sie auch gemacht und die Parzelle nahe dem Theodor-Fliedner-Heim bewirtschaftet wie eine Bäuerin.
Toiletten waren das entscheidende Thema ihrer Werbephase gewesen, die kurz und heftig verlief. Heinrich war schon immer ein Sitzpinkler gewesen und Frauen schätzen das. Eine von Geburt an stark gekrümmte Harnröhre erwies sich als Heinrichs bestes Charmekapital. In einigen kläglich gescheiterten Versuchen, das Ritual männlichen Wasserlassens im Stehen zu vollziehen, brachte es der Knabe Heinrich lediglich zu unkontrollierten Urinkurven, die seine eigenen Beinkleider durchnässten, was ihm im besten Falle Mitleid und Kopfschütteln einbrachte und im Normalfall eine gepfefferte Ohrfeige. Damals begann Heinrich mit dem sitzend Pinkeln und blieb dabei.
Nie hatte er geglaubt, dieses schändliche Versagen einmal gewinnbringend einsetzen zu können, aber genauso kam es. Es war wieder einmal Cranger Kirmes und ein staubiger, durstiger Tag, als er mit Ingeborg in seiner linkischen Art durch die Reihe der Stände flanierte. Luftige Kleidchen in Pastellfarben bei den Frauen, Sommeranzüge und Strohhüte bei den jungen Herren, Heinrich dabei keine Ausnahme. Er bemühte sich, Ingeborg, die ein zitronengelbes Schirmchen über sich hielt, um der Sonne Herr zu werden, nicht anzusehen. Immer, wenn er sie ansah, errötete er und flüchtete mit seinem Gesicht in ein überdimensioniertes kariertes Sacktuch, in das er lautstark prustete. Backfisch, kandierte Äpfel und Wurfbuden, schon damals. Man trank Bier und Apfelschorle. Toilettenhäuschen suchte man vergebens, aber die natürlichen Bedürfnisse blieben.
So reihten sich rotbackige Herren lässig am Wegesrand auf und vollzogen ihr Pinkelritual, begleitet von dem Tuscheln und Giggeln ihrer weiblichen Begleitungen, die sich dezent im Hintergrund zusammendrängten und den großspurigen Wettbewerb aus den Augenwinkeln beobachteten. Heinrich war in größter Not und hielt Ausschau nach einem Gebüsch oder einer Baumgruppe, hinter der er sich niederhocken konnte. Sein Gesicht war puterrot vor Scham. Ingeborg hing an seinem Arm wie ein totes Gewicht. Sie schien nicht zu verstehen. Bald aber würde sie Heinrich in seiner ganzen Jämmerlichkeit in einem Graben sitzen sehen wie ein Weib und würde ihn mit eisigem Gesichtsausdruck verachten.
Es kam anders, vollkommen anders. Ingeborgs Gesicht wurde weich, als Heinrich nach einer gestammelten Erklärung, deren Wortlaut dem Lexikon eines Wahnsinnigen entstammte, davon stürzte, um sich hinter einem Ginstergesträuch niederzuwerfen. Sie hatte ihm noch beruhigend über den Arm gestrichen und behielt den schwärmerischen Gesichtsausdruck bei, als Heinrich in gefestigter Haltung und bangen Herzens hinter ihr auftauchte. Danach hatte Heinrich leichtes Spiel. Ingeborg war die Seine und Heinrich hatte eine wichtige Lektion gelernt. Frauen liebten schöne Dinge. Schöne Dinge und verletzliche Seelen. Rehe z. B. und Schmuck, Düfte und zarte Stoffe. Und Sitzpinkler.
Heinrich ging schleppenden Schrittes zu seinem Bett. Das rechte Knie schmerzte. Er würde zum Arzt gehen müssen. Zu einem anderen Arzt, das war klar. Zu einem, der den Namen verdiente. Er würde es mit dem Mannschaftsarzt der Schwarz-Gelben versuchen, einem echten Kerl, der auch die Fußballer in Nullkommanichts wieder auf Vordermann brachte, damit sie die ganze Saison durchhielten. Sicher würden ihm von einem solchen Mediziner keine peinlichen Fragen über Erektionsbeschwerden gestellt werden.
Erektionsbeschwerden − und das unter dem Deckmantel, man müsse die Folgen einer Prostatavergrößerung abschätzen, um die richtigen Gegenmaßnahmen einzuleiten. Erektion − und das bei einem verdienten Pensionär, einem Bahnobersekretär im Ruhestand, einem Ruhestandsbeamten, der sein gesamtes Leben nichts anderes getan hatte, als korrekt zu sein.
Heinrich sah seufzend auf den Wecker: 3:21 Uhr. Er wollte nicht an Erektionen denken, auch nicht zu medizinischen Zwecken aber sein Kopf hatte andere Ideen. So war das bei alten Menschen. Der Schlaf floh vor ihnen und die Ventile des Körpers ließen sich nicht mehr beherrschen. Dafür verstärkte sich das Kopfkino.
Es war nicht so, dass Heinrich und Ingeborg keinen Sex gehabt hätten. Ganz im Gegenteil. Sie waren beide gesunde und kräftige Menschenkinder und wussten um ihre Pflicht. Damals allerdings hatte man noch Anstand. Anstand in jeder Lage. Man fiel nicht übereinander her wie Vieh und probierte unnatürliche Dinge aus. Man hielt sich an Traditionen und gesicherte Abläufe. Das Licht wurde gelöscht und im Schlafzimmer waren die Betten vorgewärmt. Man tastete mit abgewandten Gesichtern unter der Nachtwäsche, bis man fündig geworden war und küsste sich streng nach Brauch. Der Körper des anderen war ein Geheimnis und sollte es auch bleiben. Die Vereinigung war eine kurze Sache, kaum dazu geeignet, die Bettwäsche in Unordnung zu bringen. Jeder erledigte seinen Part. Man küsste sich erneut und versank guten Gewissens in einen tiefen Schlaf.
Der Pfarrer war der Einzige, der zu den Zeugungsvorgängen Fragen stellen durfte, denn bei der Abnahme der Beichte musste man genau sein. Das forderte Gott und mit ihm die Mutter Kirche, die über das seelische Wohl der Gläubigen wachte. Pfarrer fragten nach Lust und wollüstigen Gedanken. Wenn man verneinte, was insbesondere Ingeborg aus vollem Herzen tat, lobte der Pfarrer, wenn man von unzüchtigen Anwandlungen und einem übermäßigen Ausstoß von Körpersäften berichtete, tadelte der Pfarrer milde und erteilte die Absolution unter Auflagen. So war das mit der Kirche und dem Gewissen. Deutschland konnte stolz auf seine Ehepaare sein.