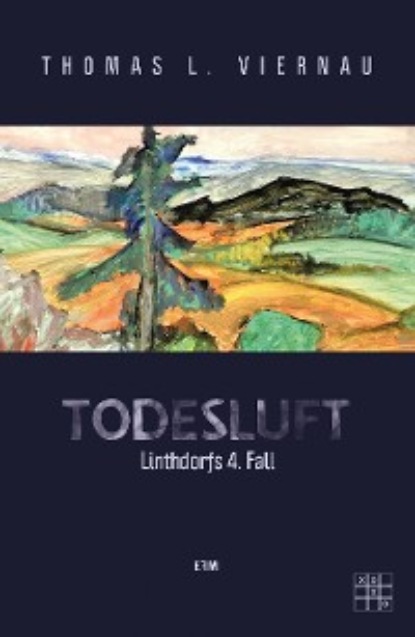- -
- 100%
- +
Er war sich bewusst, dass es immer schwieriger werden würde, die Flucht erfolgreich weiter zu inszenieren, ohne Aufsehen zu erregen.
Je mehr Napoleon auf dem Vormarsch war, desto wahrscheinlicher würden seine Geheimagenten ihnen auf die Schliche kommen. Fast jedes Land in Europa war inzwischen ein Vasall des Korsen.
Das galt auch für die unzähligen kleinen Fürstentümer Thüringens, die allesamt dem sogenannten Rheinbund beigetreten waren und ihre Souveränität damit aufgegeben hatten. Natürlich wusste Leonardus nicht, wie eng die jeweilige Zusammenarbeit mit der französischen Schutzmacht war. Aber ihm war nicht entgangen, dass an den Höfen der Thüringer Herzöge und Fürsten neuerdings französische Berater, getarnt als Gesandte, auftraten und unmissverständlich die Wünsche der Schutzmacht den Herzögen klarmachten.
Seine Ängste waren berechtigt. Überall, wo er jetzt aufkreuzte und vor Jahren mit offenen Armen empfangen wurde, verschlossen sich plötzlich die Türen. Weder Weimar, noch Gotha oder Meiningen gewährten ihm Schutz. Erst im kleinen Herzogtum Hildburghausen bekam er die erhoffte Unterstützung.
Dankbar erinnerte er sich an den großzügigen Herzog Friedrich und dessen schöne Gattin Charlotte. Unkompliziert organisierten ein paar enge Vertraute des Herzogs alles Notwendige für einen zurückgezogenen Aufenthalt des Paares.
1810 bezog er das kleine Schlösschen im nahe gelegenen Eishausen. Endlich fühlte er sich vor seinen Verfolgern sicher. Die Strapazen der langjährigen Reisen hatten ihm stark zugesetzt. Sowohl seine Gesundheit als auch die Gesundheit der unbekannten Schönen waren angegriffen. Der Rat eines befreundeten Arztes, sich von den giftigen Ausdünstungen der großen Städte fernzuhalten, war ihm zutiefst verinnerlicht. Hier in der klaren Bergluft Thüringens würden sie wieder genesen. Mit eiserner Disziplin hatte er sich aus der Krise herausgearbeitet.
Er versuchte, seinem Leben einen neuen Takt zu geben. Anstelle der dauernden Ortswechsel und der damit verbundenen unsteten Lebensweise erstellte er nun ein von festen Regeln bestimmtes Tageswerk.
Auch seiner Begleiterin schien die Ruhe und die Regelmäßigkeit gut zu tun. Die klare, keimfreie Luft tat ihr Übriges. Sie erblühte zu einer Schönheit, die zwar noch etwas gezeichnet war von den Strapazen der vielen Reisen quer durch Europa, aber Leonardus erneut in Leidenschaft versetzte.
Das Leben auf Schloss Eishausen war dem strengen Duktus zweier ständig auf der Flucht befindlichen Menschen unterworfen. Das erklärte wohl auch die vollkommene Isoliertheit und Abschottung von den alltäglichen Dingen. Die einzige Kommunikation mit der Außenwelt erfolgte über den getreuen Diener Scharr und die wenigen Dienstboten, die sich um diverse Besorgungen und Einkäufe kümmerten.
Leonardus war das ganz recht so. Seine Korrespondenz erledigte er in seinem Schreibkabinett, blieb auf diese Art und Weise stets auf dem Laufenden und nahm Anteil an den politischen Veränderungen. Napoleon war inzwischen mehrfach besiegt. Seine Armeen befanden sich auf dem Rückzug. Vor Moskau war die Grande Armee vernichtend geschlagen worden.
Erst als Napoleon nach dem Staatstreich ins Exil nach Elba verbannt wurde, atmete Leonardus auf. Seine Mission war beendet. Aber würde er sich von der schönen Frau trennen können?
Seine Beziehung zu ihr war intensiv. Er konnte und wollte ohne sie nicht weiterleben. Zumal sie seine Gefühle erwiderte. Es gab keinen Grund, dass selbst erschaffene Paradies zu verlassen.
Leonardus beschloss zu bleiben. Er wusste auch um die fragile Gesundheit seiner Prinzessin. Eine weitere unbequeme Reise würde wahrscheinlich ihren frühzeitigen Tod provozieren. Und ob sie in einer Stadt wie Paris oder Amsterdam sich je zurechtfinden würde, wagte er zu bezweifeln. Zu lange währten nun schon ihre Flucht und das Versteckspielen in den abgelegenen Winkeln Deutschlands.
In den folgenden Jahren besuchten mehrmals ein paar russische Offiziere Schloss Eishausen. Sie schienen wichtige Botschaften für den Grafen mitgebracht zu haben. Seine Stimmung war nach den Besuchen der Offiziere jedenfalls ausgesprochen gut.
Aus Holland kamen weiterhin regelmäßig Geldsendungen, die ihm ein unbeschwertes Leben ermöglichten. Sein Vermögen, verwaltet von seinem Onkel, war gut angelegt und warf einen erklecklichen Zins ab.
Leonardus wägte diverse Optionen ab, verwarf die meisten von ihnen und besprach sich auch mit seiner Prinzessin. Die unbekümmerte Leichtigkeit des Zusammenseins würde wohl nur hier in der Abgeschiedenheit Eishausens aufrechterhalten werden können. Beide wussten das. Beide wollten das. Beide waren sie sich im Klaren, dass ihr Paradies genau hier im Süden Thüringens lag. Leonardus war glücklich, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Abgestürzt
Die Ritter vom Hermannsberg
Nicht weit von Steinbach-Hallenberg, recht mitten im Waldgebirge, liegen zwei Berge, der kleine und der große Hermannsberg. Über letzteren läuft ein steiler, haushoher Porphyrfelsenkamm, wie eine Riesen- oder Teufelsmauer, grau bemoost und mit alten Bäumen bewachsen.
Da droben soll ein Schloss gestanden haben, bewohnt von einem Grafen, welcher Hermann hieß. Er führte gar ein übles Leben mit seinen Rittern und gewann dadurch einen großen Schatz, dass er zwölf Seelen opferte.
Zur Strafe seiner Untaten ward er mit den Seinen in den Berg verflucht; zuzeiten hört man ein wildes, wüstes Toben dieser Ritter, sieht auch wohl den Grafen umgehen; so hat ihn mancher Förster und Kreiser (Jäger im Schnee) auf sich zukommen sehen mit einem spinnwebenen Gesicht.
Ein Führer geleitete einen Fremden über die Waldestrift, wo man von Steinbach-Hallenberg nach Mehlis geht, an einem Märzmorgen. Es hatte einen frischen Schnee gelegt. Da kam der Geist sichtbarlich und ging an den Wanderern vorüber; wie sie sich umsahen, weil sein Aussehen sie entsetzte, war er verschwunden, und im Schnee war, wo er gegangen, kein Fußtapfen zu erblicken.
Ludwig Bechstein: Thüringer Sagenschatz

I
Großer Hermannsberg bei Steinbach-Hallenberg
Dienstag, 8. Mai 2007
Das Wetter spielte mit. Hainkel trabte im lockeren Dauerlauf. Der Weg war ein steiler Bergpfad, ausgewaschen von unzähligen Regenfällen. Geröll überall. Es galt wachsam zu sein. Ein Fehltritt und das war’s. Eine Verletzung, speziell an den Beinen, konnte er sich nicht leisten. In wenigen Wochen waren die Landesmeisterschaften.
Immer, wenn die Zeit es zuließ, trainierte er. Damit es nicht zu langweilig wurde, suchte sich Hainkel immer neue Laufstrecken. Diesen Nachmittag hatte er frei. In seinem Triathlonverein tauschten sich die Männer über gute Laufstrecken aus. Ein guter Kumpel hatte ihm die Bergstrecke am Großen Hermannsberg vorgeschlagen. Ein echter Kanten. Start am Knüllfeld, einer beliebten Ausflugsgaststätte oberhalb des Städtchens Steinbach-Hallenberg, dann quer über die Ganswiesen zum Berg.
Der Große Hermannsberg war ein beeindruckender Geselle. Wie ein riesiger Blauwal lag er vor einem, zum Greifen nah und dennoch so fern. Er war dicht bewaldet, obwohl er in den Achtzigern fast seinen ganzen Baumschmuck verloren hatte. Wind- und Schneebruch hatten viele Nadelbäume an den Hängen umgelegt. Die darauffolgenden, heißen Sommer brachten den Borkenkäfer, der sich inmitten des Holzbruchs pudelwohl fühlte.
Nur mit schwerem Gerät, extra aus Österreich herbeigeholt, war man der Plage Herr geworden.
Nach und nach verschwanden die abgestorbenen Bäume. Der Berg präsentierte sich fast kahl. Rotbraune Felsen wurden sichtbar. Porphyre, die sich seit Millionen von Jahren auftürmten. Der Berg war ein klassischer Bruchschollenberg, gefaltet von unvorstellbar großen Kräften aus dem Erdinneren. Das erklärte auch seine eigenartige Form, langgestreckt, steil aufragend, mit den zahlreichen Porphyrfelsen bekrönt, die zum Klettern einluden. Es gab zwei Möglichkeiten, den Berg zu besteigen. Eine holprige Straße zog sich spiralförmig bis zum Gipfelgrat hinauf. Die Straße, eigentlich mehr ein ausgewaschener Weg, war moderat in der Steigung, zog sich aber ziemlich in die Länge.
Und dann gab es noch einen steilen Pfad, versteckt zwischen den Bäumen, einer Schneise folgend, die seit langer Zeit eine kleine Lücke zwischen den dicht stehenden Bäumen aufwies. Dieser Pfad war extrem steil und führte fast senkrecht nach oben.
Hainkel hatte die Straße gewählt, schließlich wollte er ja trainieren für die Triathlonmeisterschaften und nicht für Bergcross, obwohl ihn diese Sportart auch reizen würde.
Er kannte die Strecke, war sie vor kurzem schon einmal gelaufen. Man war am Hermannsberg meist allein unterwegs. Es gab auf seinem Gipfel keine Ausflugsgaststätte und der Aufstieg war mühsam. Früher waren die Jugendlichen der umgebenden Dörfer mit Rucksäcken, gefüllt mit Eiern, Schinkenspeck und Brot auf den Berg geklettert, machten oben im Schatten der Felsen kleine Lagerfeuer und feierten Pfingsten. Doch das war schon lange vorbei. Die moderne Dorfjugend saß vor dem Computer und rettete die Welt. Einer der Gipfelfelsen hatte sogar ein eisernes Geländer. Dieser Fels war der höchste auf dem Berg. Hier erreichte er seine stattliche Höhe von 867 Metern. Es galt für jeden Gipfelstürmer, genau den Felsen als letztes zu erklimmen. Ein paar Stufen waren in den weichen Porphyr gehauen worden, die es ermöglichten den rundgeschliffenen Stein zu erklimmen. Oben angelangt, wurde der Gipfelstürmer mit einem sagenhaften Ausblick belohnt. Der gesamte westliche Thüringer Wald lag zu seinen Füßen.
Gleich links erhob sich der Ruppberg. Nur einen Meter kleiner als der Hermannsberg präsentierte sich der steil aufragende Kegel wie ein Bergkönig. Bekrönt wurde er von einer rotbraun angestrichenen Hütte. Dieser Hütte verdankte der Ruppberg seine Popularität. Außerdem lag der Ruppberg im direkten Einzugsgebiet der Stadt Zella-Mehlis. Hinter dem Ruppberg reckte sich aus dem dunklen Tannengrün der Steinhauk in den Himmel. Er fristet nur ein Schattendasein.
Schaute man gen Osten, konnte man die Gipfel des Hauptkamms des Thüringer Waldes sehen. Eigenartige Namen hatten sie: Donnershauk, Hohe Möst, Schneekopf, Gebrannter Stein, Hoher Stein. Der Kanzlersgrund, ein längliches Hochtal zog sich zwischen den Bergen aufwärts.
Richtung Süden war der Blick frei auf hügelige Felder und Wälder. Am Horizont zeichneten sich als hellblaue Kulisse die Berge der Rhön ab. Davor thronte erhaben der Dolmar, ein einzelner Berg, der seit alters her mit einem geheimnisvollen Nimbus umgeben war. Schon die alten Kelten hatten sich den Dolmar ausersehen, um dort ein Heiligtum zu errichten. In der jüngeren Vergangenheit wurde der Dolmar für die Thüringer zur Sperrzone. Eine Raketenstation der Roten Armee verwehrte den Zugang zum Gipfel.
Weiter links grüßten die Gleichberge. Sanfte Hügel, von Wald bedeckt. Eingebettet in die Landschaft erblickte man zahlreiche kleine Städtchen und Dörfer: Steinbach-Hallenberg streckte sich langgezogen rechts unterhalb der Ganswiesen. Bermbach duckte sich in einen kleinen Talkessel. Unterhalb der Rückseite des Berges zogen sich die beiden Schwesterdörfer Ober- und Unterschönau in einem Tal empor, dem Haselgrund, einer natürlichen Fortsetzung des Kanzlersgrunds.
Hainkel kannte die Gegend. Es war sein Einsatzgebiet als Lokalreporter. Er fühlte seinen Puls. Achtundachtzig. Das war okay. Der Lauf hatte ihn nicht sonderlich verausgabt. Zufrieden saß er auf dem Felsen, genoss den Ausblick und überlegte, welchen Weg er abwärts wählen sollte. Gerade als er aufstehen wollte, irritierte ihn ein seltsames Blinken. Die Sonne war hervorgekommen und schien mit ihrer Frühlingskraft direkt auf die Felsen. Porphyr glänzte nicht. Porphyr war stumpf und matt, rotbraun mit ein paar Einsprengseln in Schwarz und Ocker. Aber da blinkte etwas auf dem Felsen direkt vor ihm.
Hainkel hangelte sich vorsichtig auf den etwas tiefer liegenden Stein direkt unterhalb des Felsens. Das Blinken kam von einem kleinen, silbernen Medaillon. Es war oval, vielleicht fünf Zentimeter groß, an einem Kettchen, das zerrissen war. Eindeutig konnte Hainkel erkennen, dass die Kettenglieder mit Gewalt auseinandergerissen worden waren. Vorsichtig öffnete er das Medaillon. Auf der Innenseite des Klappverschlusses standen in zierlichen Schnörkeln zwei Buchstaben. Ein großes M und ein großes R.
Im Medaillon selbst war eine farbige Miniatur zu sehen. Ein Portrait. Es gehörte zu einer schönen Frau, vielleicht Anfang Zwanzig, möglicherweise sogar noch jünger. Der Stil der Frisur und der Kleidung rückte die schöne Unbekannte weit zurück in die Vergangenheit. So sahen die Damen möglicherweise vor zwei- oder dreihundert Jahren aus.
Genauer konnte Hainkel das nicht datieren. Aber er war sich sicher, dass das Medaillon ein historisch wertvolles Stück war. Wie das Schmuckstück auf den Gipfel des Hermannsbergs geraten war, konnte er sich nicht erklären. Möglicherweise hatte ein Wanderer es verloren. Aber dann besah er es sich noch einmal genauer. Das Medaillon musste mit Gewalt jemandem vom Hals gerissen sein. Die zerstörten Kettenglieder ließen keinen anderen Schluss zu.
Hatte sich hier auf den Felsen ein Drama abgespielt?
Nachdenklich kletterte Hainkel an dem Felsen zurück auf den Gipfelpfad. Eine vage Idee hatte er just in diesem Augenblick. Ob nicht am Fuße der Felsen …?
Mühsam kämpfte er sich durch das Unterholz und riesige Farnbüsche. Endlich war er unterhalb der Gipfelfelsen. Junge Fichten und ein paar Buchen standen an dem schräg abwärts laufenden Hang. Der Boden war bedeckt mit Farnen und Heidelbeerbüschen. Nichts deutete auf Spuren eines Kampfes hin. Hainkel schüttelte den Kopf.
Seit er die Einbruchsserie in den Thüringer Schlössern verfolgte, hatte er öfters schon solche seltsamen Eingebungen. Wer weiß, möglicherweise war das Medaillon ja sogar Diebesgut? Ausschließen konnte er das nicht. Zumal die Bestandslisten, die er von den Verwaltungen bekommen hatte, große Lücken aufwiesen, was die inventarisierten Artefakte anging.
Ein kleines Medaillon würde da wohl nicht auffallen. Vielleicht eine erste Spur zu den Tätern. Hainkel schlitterte auf dem weichen Grund abwärts. Fichtennadeln bedeckten den Boden.
Wurzeln waren Stolperfallen. Gerade schien er wieder an einer solchen Wurzel hängengeblieben zu sein. Dichtes Farnlaub machte es schwierig, die Wurzeln rechtzeitig zu entdecken.
Fluchend fiel er kopfüber in den Farn. Wie von einer Tarantel gestochen fuhr er jedoch fast zeitgleich wieder auf. Was er für eine Wurzel hielt, war ein Bein. Das Bein gehörte zu einer Frau, die höchstwahrscheinlich tot war.
Hainkel war entsetzt. Fieberhaft kramte er sein Handy hervor. Leider gab es hier am Berg keinen Empfang. Was sollte er tun?
Nichts anfassen! Das, wusste er, war die wichtigste Prämisse. Bei zahlreichen Polizeieinsätzen, die er als Lokalreporter begleitet hatte, klagten ihm die Polizisten jedes Mal, wie achtlos die Leute Spuren zerstörten durch unüberlegtes Herumgelatsche am Fundort.
Aber irgendwie musste er den Fundort sichern, so dass er ihn leicht wiedererkennen konnte. Letztendlich wusste er, was zu tun war. Er schlang um die Fichte direkt vor dem Farndickicht, in dem die Frauenleiche lag, sein T-Shirt. Dann machte er sich auf den Weg. Er wusste, dass am Knüllfeld ein Telefonanschluss war. Dort musste er hin.
Die Herren im Berg
Einst hütete ein Hirte am Großen Hermannsberg, da verlief sich der Brüller (Herdochse), und der junge Knecht ging in den Wald, ihn zu suchen. Da kam er zu einer Gesellschaft Herren, die vergnügten sich mit Kegelschieben, und da sie ihn sahen, winkten sie ihm, ihnen die Kegel aufzusetzen. Dies tat er, und als sie ihr Spiel beendigt hatten, gingen sie hinweg und sagten, er möge nur die Kegel mitnehmen. Er belud sich mit dem Spiel, kam wieder zur Herde, zu der sich indes der Ochse wiedergefunden hatte, trieb sie heim und wurde verwundert gefragt, wo er denn bleibe und gewesen sei, er sei schon drei Tage nicht nach Hause gekommen. Er aber beteuerte, kaum eine halbe Stunde von der Herde gegangen zu sein, die Herren hätten ihn genötigt, ihnen die Kegel aufzusetzen. Da fragte man weiter, ob er auch einen Lohn bekommen. O ja, sagte der Knecht, ich habe das ganze Spiel mitgebracht, draußen liegt's unter der Treppe. – Nun wollte der alte Hirt selbst den Ranzen mit den Kegeln unter der Treppe hervorziehen, vermochte das aber nicht, hingegen der Junge, wie er angriff, brachte ihn gleich hervor, und da waren die Kegel von purem Golde. Zu einer anderen Zeit, als der junge Knecht wieder im Walde hütete und herumschweifte, fand er die Gesellschaft wieder, setzte wieder auf, und da bekam er auch die Kugeln. So war er zweimal glücklich.
Ludwig Bechstein: Thüringer Sagenschatz

II
Knüllfeld bei Steinbach-Hallenberg
Dienstagabend, 8. Mai 2007
Soviel Polizei war noch nie hier oben. Das Wirtspaar vom Knüllfeld konnte sich nicht daran erinnern, dass schon einmal eine zahlreichere Präsenz von Polizei, Krankenwagen, Leichenwagen und Technikern vor ihrer Haustür zu sehen war.
Selbst als vor vielen Jahren einmal ein Waldbrand gleich unmittelbar hinter dem Knüllfeld zu bändigen war, standen nur ein paar Feuerwehrautos herum.
Doch jetzt war alles anders. Drüben am Hermannsberg hatte man eine Leiche entdeckt. Eine Frau sollte es sein. Wohl abgestürzt am großen Aussichtsfelsen.
Naja, da ging es schon ein paar Meter steil bergab in die Tiefe. Der Sportler, der die Frau entdeckt hatte, saß in ein Gespräch mit zwei Polizisten vertieft im Schankraum.
Als der völlig abgekämpft vor drei Stunden Sturm geklingelt hatte, normalerweise war dienstags nämlich Ruhetag, dachten die Wirtsleute, es wäre ein schlechter Scherz. Aber der durchtrainierte Typ sah nicht wie ein Spaßvogel aus.
Er trank zwei große Gläser mit Mineralwasser, ohne mit der Wimper zu zucken, in einem Zug aus. Dann berichtete er kurz, was er entdeckt hatte und bat um ein Telefon.
Ja, und nun war hier alles voll mit Polizei. Man konnte mit den Autos nicht direkt zum Hermannsberg. Die Wege waren einfach ungeeignet. Also hatten sich die Techniker, ein paar Beamte und die Rettungssanitäter zu Fuß auf den Weg gemacht. Der Sportler übernahm die Führung und lief vorneweg. Die Begleiter hatten Mühe, mit ihm Schritt zu halten.
Nach einer guten, halben Stunde waren sie am Fundort angekommen. Hainkel hatte die Männer den steilen Pfad aufwärts geschickt. Das wäre wohl schneller. Zielsicher strebte Hainkel dem Ort direkt unterhalb des Aussichtsfelsens zu. Da war auch schon sein T-Shirt. Er wies auf das dichte Farn. Da drinnen liege sie.
Als erstes waren die Techniker zugange. Vorsichtig bahnten sie sich ihren Weg, beseitigten systematisch mit Scheren die vielen Farnblätter, um freie Sicht zu haben. Nach und nach wurde die Frauenleiche sichtbar. Es war eine nicht mehr ganz junge Frau, wahrscheinlich Ende vierzig, Mitte fünfzig. Gekleidet war sie mit Blue Jeans, einer hellgrünen Bluse, darüber eine schwarze Steppweste. Etwas abseits lagen ein Sommerhut aus geflochtenem Bast, eine Handtasche und eine Sonnenbrille. Die war wohl durch den Sturz heruntergerissen worden.
Die Frau lag in einer unnatürlichen Position auf dem Rücken, die Arme weit von sich gestreckt, die Beine waren in einem unnatürlichen Winkel ebenfalls gestreckt. Der Kopf der Frau wirkte wie abgeknickt. So konnte man eigentlich den Kopf nicht auf natürliche Weise bewegen. Hainkel wurde es schlecht. Mit Leichen hatte er es nicht so.
Ein Fotograf begann sein Werk, lichtete die Frauenleiche ab, positionierte kleine Kärtchen mit Zahlen an den Fundorten der Handtasche, der Sonnenbrille und des Hutes.
Die anderen Beamten durchstreiften die direkte Umgebung. Wohl um sicher zu gehen, nichts übersehen zu haben. Plötzlich ertönte ein kurzer Schrei. Einer der Beamten schien etwas entdeckt zu haben.
Hainkel eilte herbei. Etwa dreißig Meter abwärts hatte ein Polizist noch eine weitere Leiche entdeckt. Diesmal ein Mann. Auch er schien vom Felsen gestürzt zu sein. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er gen Himmel. Hainkel wurde es schon wieder schlecht. Mein Gott, was für ein Drama hatte sich da abgespielt.
Hatten die beiden möglicherweise auf dem Felsen miteinander gekämpft? Hainkel musste an das Medaillon denken. Bisher hatte er davon noch nicht berichtet.
Wie normale Touristen sahen die beiden Toten nicht aus. Eher wie Städter, die sich verirrt hatten.
Touristen im Thüringer Wald waren leicht zu erkennen. Speziell die Wanderer. Meist trugen sie Funktionskleidung, die älteren Semester waren sogar mit Kniebundhosen und Tirolerhüten unterwegs. Zu ihnen gehörte immer ein Gehstock und ein gewaltiger Rucksack. Im Sommer durchzogen sie scharenweise die Gegend. Die Einheimischen nannten die Wanderer liebevoll »Luftschnapper«.
Auf dem Rennsteig war dann ein Verkehr wie in der Fußgängerzone von Schmalkalden. Unangenehm wurde es meist, wenn solch ein Trupp anfing Lieder zu deklamieren, immer zuerst natürlich die Thüringer Waldhymne von Herbert Roth: »Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land …«
In den letzten Jahren waren zu den konservativen Jodlern und Sängern die Nordic Walker hinzugekommen. Ausgerüstet mit zwei Skistöcken, Stirnband, Sonnenbrille und Leggins marschierten diese Spezies in einem hohen Tempo durch die Landschaft. Die Nordic Walker hatten kein Interesse an Natur und Landschaft, ihnen ging es um Zeiten. Schnaufend und keuchend stapften die Walker an einem vorüber. Sie hetzten durch die Gegend auf der Suche nach dem Kick, pure Adrenalinjunkies.
Hainkel hielt sich von beiden Gruppen fern, sie waren ihm nicht ganz geheuer. Seine Gedanken kehrten wieder zurück zu den beiden Toten.
Oder gab es vielleicht einen unsichtbaren Dritten? Möglicherweise wurden die beiden ja verfolgt. Retteten sich auf den Felsen, dann ging es nicht mehr weiter. Der Verfolger nahte und …
Hainkel sah in Gedanken die beiden mit einer geheimnisvollen Figur in Schwarz ringen, das Medaillon wurde der Frau vom Hals gerissen, bevor sie in die Tiefe stürzte. So könnte es gewesen sein. Unbedingt musste er herausbekommen, wer die beiden Toten waren.
Er sah schon die Titelseite der »Rennsteig-Nachrichten« vor sich: »Drama am Hermannsberg – Zwei Tote im Farngestrüpp entdeckt«.
Ob er mit dem einen der Kriminalisten mal sprechen könnte? Er war immerhin der Entdecker … und überhaupt, im normalen Leben war er Lokalreporter, also, dass würde ihn schon brennend interessieren.
Später, später. Erst müsse man die Toten bergen und sicher sein, nicht etwas übersehen zu haben.
Hainkel nickte. Er wusste, dass die Polizei sich bei solchen Fällen stets bedeckt hielt. Man wollte vermeiden, dass zu viel Details an die Öffentlichkeit gerieten.
Heimlich knipste Hainkel mit dem Handy alles, was wichtig war. Die Aufnahmen waren zwar mit dem Handy nicht ganz von bester Qualität, aber mit dem Computer könnte er sie ja noch etwas nachbearbeiten.
Die Techniker bedeuteten ihm, sich aus dem Bereich des abgesteckten Fundorts fern zu halten. Klar, er kannte die Spielregeln.
Dann setzte sich der gesamte Zug in Bewegung. Die Toten waren in Transporthüllen gebettet worden. Vorsichtig arbeiteten sich die Leute von der Technik durch das Unterholz. Endlich kreuzte der Weg den kleinen Pfad. Einer der Fahrer hatte es geschafft, ein Auto auf der halsbrecherischen Strecke heranzuholen. Mit Tempo zwanzig rumpelte der Transporter bergab.
Hainkel marschierte mit den Beamten wieder zurück zum Knüllfeld. Man schwieg. Jeder hing seinen Gedanken nach.
Handelte es sich um einen tragischen Unfall? Oder gab es da etwas, was vielleicht ein Selbstverschulden ausschloss?
Der Abend war angebrochen, langsam dämmerte es bereits. Im Schankraum hatten es sich die Beamten eingerichtet. Die Wirtsleute kochten Kaffee und boten auch einen kleinen Imbiss an, wie gesagt, heute war ja eigentlich Ruhetag.