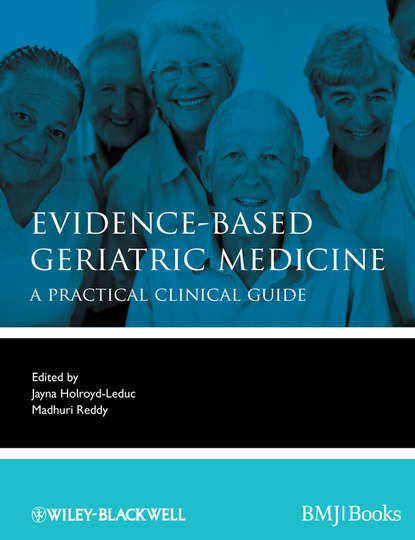- -
- 100%
- +
Immer das Gleiche: Klärung der Identität, Klärung der Todesursache, Klärung des Umfelds. Er musste sich zunächst in die Gerichtsmedizin begeben. Schließlich konnten anhand körpertypischer Merkmale erste Indizien zur Herkunft der Unbekannten festgestellt werden. Ein kurzes Telefonat mit den Gerichtsmedizinern, Linthdorf schwang sich schwerfällig aus dem Drehstuhl, der unter seinem Gewicht schon des Öfteren nachgegeben hatte und seitdem ein etwas wackliges Konstrukt war.
Irgendwelche Schrauben waren auch schon abhandengekommen, so dass die Höhe des Stuhles nicht mehr einstellbar war. Jedenfalls hatte Linthdorf sich mit den Gebrechen seines Stuhls vertraut gemacht und achtete darauf, nicht allzu oft damit zu drehen.
Wenn er im Zimmer aufrecht stand, wurde es dunkel. Sein massiger Körper verdeckte so ziemlich vollständig das Fenster und nahm auch dem Neonlicht den größten Teil seiner Helligkeit.
Linthdorf war dieser Effekt bewusst. Irgendwie war es ihm peinlich, sobald andere Menschen im Raum waren. Er setzte sich deshalb auch stets schnell wieder hin und nahm so den Besuchern seines Büros die Beklemmungen, die unweigerlich aufkamen, wenn sie ihn in voller Größe hier erblickten. Mit einer lichten Höhe von zwei Metern und vier Zentimetern und einem Lebendgewicht von annähernd 130 Kilogramm war Linthdorf eine ungewöhnliche Erscheinung.
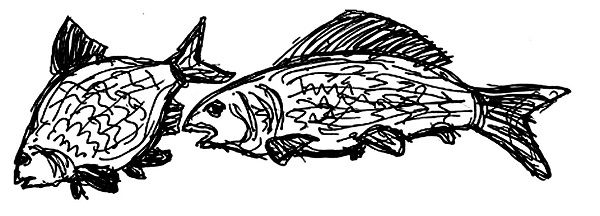
Potsdam
Immer noch Freitag, 6. Januar 2006
Die Gerichtsmedizin in Potsdam war ein von den Leuten der Kripo oft frequentierter Ort. Das ockerfarbene Gründerzeitgebäude hatte schon viele Beamte in seinen labyrinthischen Gängen gesehen, die dann in den einzelnen Sälen mit stets traurigen Blicken auf die Überreste menschlichen Daseins blickten.
Linthdorf ging zielstrebig zum Keller mit dem römischen Buchstaben III und versuchte flacher zu atmen um den durchdringenden Geruch etwas abzuschwächen, der diesem Gebäude inzwischen eigen war.
Die Gerichtsmediziner liefen alle in den grünen Kitteln und mit den weißen Kopfschutzhauben herum, die zu einer Art Uniform für diesen Berufsstand geworden waren. Linthdorf hielt Ausschau nach einem bestimmten Grünkittel.
Schließlich sah er ihn, vornübergebeugt über einen Tisch, auf dem gerade eine Leiche kunstfertig auseinandergenommen wurde. Ein zweiter Grünkittel assistierte ihm. Kurzer Gruß, man kannte sich.
Linthdorf hielt Abstand, er hatte zwar schon vieles in seiner Laufbahn erlebt, aber der Anblick der leblosen Körper auf dem blanken Metalltisch hatte jedes Mal verheerende Wirkung: Übelkeit, wackelige Knie und Schweißausbrüche.
Er kannte das schon, versuchte sich auf etwas Harmloses zu konzentrieren, starrte die gegenüberliegende Wand an, wo ein großes gerahmtes Poster mit einer mediterranen Küstenlandschaft für Reisen nach Kreta warb. Eigentlich ein komischer Kontrast, im Angesicht des Todes vom Urlaub zu träumen. Endlich schien der Grünkittel sein blutiges Werk vollbracht zu haben. Er blickte auf, sah Linthdorf etwas blass vor sich hin stieren, lächelte fein.
»Na, was führt dich mal wieder hierher?«
Linthdorf war erleichtert. »Können wir kurz sprechen? Ich glaub’, du kannst mir etwas zu der Wasserleiche aus der Oder erzählen, die vorgestern bei euch reinkam.«
Der Grünkittel hatte Mitleid mit Linthdorf. »Komm, wir gehen hoch! Trinken einen Kaffee.«
Erleichtert verließ Linthdorf zusammen mit dem Grünkittel die unterirdischen Gefilde. Im Erdgeschoss hatte die Gerichtsmedizin eine kleine Cafeteria mit Imbissangebot für die Mitarbeiter des Hauses eingerichtet. Die zehn Plastiktischchen und die darum herumstehenden Plastikstühle verbreiteten eher Bahnhofsatmosphäre denn die Gemütlichkeit einer Cafeteria.
Sie waren aber dennoch gut frequentiert. Ein paar Yuccapalmen sorgten für etwas Grün inmitten des tristen Grau und Weiß. Linthdorf steuerte den runden Tisch direkt neben den Yuccas an.
Auf dem Tablett zwei Pott Kaffee, dazu ein paar Croissants. Der Grünkittel fing an, herzhaft in sein Croissant zu beißen. Krümel stiebten herum, bedeckten die bis dahin monoton grüne Brust mit hellen Sprenkeln. Linthdorf lächelte, es ging also nicht nur ihm so, wenn er in solch fragile Backwerke biss.
»Also, deine Odernixe ist wahrscheinlich keine Ausländerin. Die Zähne sind eindeutig von einem hiesigen Zahnarzt behandelt worden. Sowohl die Ausführung der Arbeiten als auch die verwendeten Füllungen sind gute deutsche Wertarbeit. Da kannst du mit deinen Nachforschungen anfangen. Eine ziemlich komplizierte Arbeit, kann nur ein Spezialist, ein Kiefernchirurg vielleicht, ausgeführt haben. Davon gibt es nur wenige. Die Dame muss bereits in früher Jugend einen Großteil ihrer Zähne eingebüßt haben. Sowohl oben als auch unten sind komplizierte Kronen und Brücken montiert worden. Natürliche Zähne hatte sie nur noch drei, obwohl sie gerade mal Ende Dreißig war.
Außerdem haben wir bei ihr Spuren von Marihuana nachweisen können. Sie muss ziemlich viel davon konsumiert haben. Ihre Lungenflügel, besser gesagt, das, was davon noch übrig war, hatten auch recht schwarze Teerablagerungen aufzuweisen. Starke Raucherin, dreißig bis vierzig Zigaretten pro Tag, würde ich sagen. Vom Mageninhalt ist nichts mehr verwertbar gewesen. Da haben wahrscheinlich Aale ganze Arbeit geleistet. Ich habe dir mal alles zusammengeschrieben, den ausführlichen Bericht schicke ich dir noch zu.«
Der Mann in Grün schlürfte geräuschvoll seinen Kaffee und fuhr fort: »Sie lag mindestens ein bis zwei Tage im Wasser. Todesursache ist allerdings nicht Ertrinken. Anhand der vielen Blessuren, die der Körper aufwies, ist es schwierig, eine äußere Todesursache festzustellen, aber ich gehe davon aus, dass einige der Blessuren tödlich gewesen sein könnten.
Ich bin noch dabei, zu klären, welche davon erst post mortem hinzukamen. Außerdem hat sie zwei Splitterbrüche an beiden Armen. Schmerzhaft und mit Sicherheit vor dem Tode bekommen.
Inwieweit sie Spuren einer Kampfhandlung sein könnten, lässt sich allerdings nicht sagen. Es sieht eher so aus, als ob sie aus recht großer Höhe gesprungen war und dabei mit den Armen sich abstützen wollte. Unter den Fingernägeln habe ich allerdings kein Erdmaterial gefunden. Kann natürlich sein, dass die Leiche zu lange im Wasser lag und alle Erdspuren verschwunden sind.
Auch auffällig, dass keinerlei Hinweise auf ein Sexualdelikt vorhanden sind. Im Vaginalbereich wurden keine Spuren von Sperma gefunden.«
Linthdorf lauschte dem Bericht des Mediziners, kaute sein Croissant und schlürfte den Kaffee. Eigentlich hatte er gehofft, den ganzen Vorgang auf einen Stapel ablegen zu können, der speziell für solche Todesfälle mit unbekannten Personen, die nicht identifiziert werden konnten, eingerichtet worden war.
Im offiziellen Sprachgebrauch wurden diese als »Todesfälle mit Migrationshintergrund« bezeichnet. Nur selten kamen Anfragen aus den osteuropäischen Staaten zu den hier liegenden Akten. Im Büro von Linthdorf stapelten sich inzwischen schon fünfzehn solcher Akten zu denen es keinerlei Erkenntnisse und brauchbare Informationen gab. Er hatte dafür im untersten Regal Platz gemacht und den Stapel dorthin verbannt.
Jedes Mal, wenn er einen Blick darauf warf, wurde ihm schmerzhaft bewusst, wie wenig doch die moderne Kriminalistik zu solch hoffnungslosen Fällen beitragen konnte. Fünfzehn Schicksale nur hier bei ihm. Wie viele insgesamt es davon gab, ließ sich schwer schätzen, mit Kollegen hatte er sich darüber wenig unterhalten. Sein Chef musste darüber wohl einen größeren Überblick haben.
Aber da war wieder ein wunder Punkt im Leben Linthdorfs angerissen worden. Sein Chef, ein pedantischer Bürokrat mit der Gefühlswelt einer Kreuzspinne, hatte zu ihm ein eher angespanntes Verhältnis. Man ging sich aus dem Wege, so gut es ging.
Ab und an waren Treffen jedoch nicht vermeidbar. Linthdorf versuchte dann, die Informationen so klar und sachlich wie möglich darzulegen, um keinerlei Anhaltspunkte für Formfehler oder anderweitige Kritik zu geben. Allerdings endeten solche Arbeitstreffen meist mit einer totalen Missmutigkeit seitens Linthdorfs. Er zwang sich, an etwas Anderes zu denken, als an seinen Chef.
Also ein Tötungsdelikt, trivial auch als Mord oder Totschlag bezeichnet. Welche genaue Art und Weise zum Tode der Frau führte, galt es zu klären. Linthdorf wusste, dass er damit nun nicht mehr als Einzelkämpfer zu tun haben würde. Solche Kapitalverbrechen wurden im Dezernat immer im Team bearbeitet. Jeder war spezialisiert auf ein bestimmtes Aufgabenfeld, und einer koordinierte das Ganze.
Das gefiel Linthdorf deutlich besser als dieses zermürbende Stochern im Nebel auf verlorenem Posten. Für Kapitalverbrechen, speziell Tötungsdelikte mit unbekanntem Tathergang, gab es innerhalb des LKA operative Strukturen, die in kürzester Zeit zu einer Sonderkommission zusammengestellt werden konnten. Solchen Sonderkommissionen gehörten Ermittler, Leute der KTU und neuerdings auch Operative Fallanalytiker, die neudeutsch auch Profiler genannt wurden, an.
Von den vielen leerstehenden Räumen des LKA wurde dann eines in ein Großraumbüro umgewandelt. Seit zwei Jahren hatte er den Luxus eines Büros nur für sich selbst, allerdings empfand er diesen Luxus als unnötig. Im großen Büro mit den anderen Kollegen hatte er sich deutlich wohler gefühlt.
Hier in seiner »Kemenate« kam er sich abgeschoben vor. Bei diesen Gedanken vergaß er fast sein Gegenüber. Der Gerichtsmediziner schaute ihn schon eine ganze Weile an.
»Na, Probleme?«
Linthdorf schüttelte den Kopf.
»Nee nee, lass mal gut sein. Nur das Übliche. Ich muss auch gleich wieder los. Du schickst mir deinen Bericht?«
»Klar, mach ich. Falls mir noch etwas auffällt, ruf ich dich an. Ansonsten hast du nächste Woche den Bericht auf dem Schreibtisch. Grüß mal deinen Chef.«, dabei grinste er etwas hinterhältig. Ein kurzer Händedruck, und Linthdorf war schon auf dem Weg zurück.

Die Nixe und der Tänzer
Im Oderbruch wurde die Sage einer Nixe erzählt, die auf dem Grunde des Flusses leben sollte. Wenn am Sonnabend die Dorfjugend der Kolonistendörfer zum Tanz ging, reihte sie sich unauffällig ein. Nur Eingeweihte bemerkten, dass es sich bei der schönen Fremden um eine Nixe handelte.
Ihre Rockschöße tropften, und auch ihre Ärmel waren feucht. Die unbekannte Schöne tanzte mit den Dorfburschen, bis Mitternacht die Kirchenglocken ertönten, dann musste sie plötzlich gehen. Ein verwegener Bursche folgte ihr jedoch und sah, wie sie in der Oder verschwand.
Wieder luden die Bauern zum Tanz und wieder reihte sich die Nixe mit ein. Der Bursche ging direkt auf sie zu und forderte sie auf. Beim nächsten Tanz sprach er sie auf ihre Nixennatur an. Sie rannte davon, wurde aber vom Burschen schnell eingeholt.
Die Nixe flehte ihn an, sie ziehen zu lassen. Keiner durfte erfahren, dass sie hier zum Tanz war. Doch so einfach ließ sich der Bursche nicht abfertigen. Er hatte sich in sie verliebt.
Also sprach sie: »Lass mich zu meines Vaters Palast auf dem Grunde der Oder gehen. Siehst du weiße Blasen aufsteigen, ist alles gut. Wenn jedoch rote Blasen zu sehen sind, dann renn schnell weg.« Er begleitete sie zum Oderufer. Sie sprang ins Wasser. Lange war nichts zu beobachten, doch dann fing das Wasser zu brausen an und große rote Blasen stiegen auf. Der Bursche erschrak und rannte davon. Die Nixe jedoch ward nimmermehr beim Tanze gesehen.

Unterwegs im Oderland
Samstag, 7. Januar 2006
Linthdorf war unterwegs in seinem alterschwachen Daimler. Ihm zur Seite saß ein jugendlicher Blondschopf, der mit großen blauen Augen die Landschaft begutachtete. Es war noch früh am Morgen. Die Sonne blendete beim Fahren. Die Fahrt ging Richtung Osten, der Sonne entgegen.
Auf der B1 war der übliche Stau. Man bewegte sich bei Tempo 30 im Ampeltakt. Linthdorf wusste, dass hinter Vogelsdorf die Straße wieder freier wurde, da viele Autos auf die Autobahn fuhren.
Er mochte mit seinem betagten Automobil nicht mehr auf diesem Hochgeschwindigkeitskurs mithalten, fuhr lieber gemütlich auf den Bundesstraßen übers Land. Die Landschaft und die Dörfer gemächlich vorüberziehen zu sehen, war für ihn ein kleiner Luxus, den er sich regelmäßig gönnte, wenn er einmal freie Zeit hatte. Meist fuhr er an einem Wochenende einfach los, ein richtiges Ziel hatte er nicht, aber er genoss den Weg. Unterwegs hielt er dann bei einem Landgasthaus, verzehrte einen Fisch oder etwas Deftiges aus der märkischen Küche, streifte mit seiner Kamera durch alte Gemäuer, Klosterruinen und verfallene Gutshöfe, um festzuhalten, was noch nicht dem völligen Verfall preisgegeben war, oder fotografierte die melancholische Landschaft der Mark. Die Kamera lag daher auch immer auf dem Rücksitz seines alten Daimler.
Der Daimler war zwar offiziell ein Dienstwagen, aber keiner der Kollegen machte ihm den altersschwachen Wagen streitig. Die waren eher auf die schnittigen neuen Modelle versessen und stritten sich darum, wer nun den 5er BMW und wer den A6 Audi steuern durfte.
Die Kripo hatte einen Fahrzeugpool, der durch Beutewagen stets mit neuen Modellen versorgt wurde. Beutewagen waren konfiszierte Autos von Schmugglern und anderen organisierten Verbrecherbanden, die dingfest gemacht worden waren und deren Besitz eingezogen wurde, um die immensen Kosten der Verfahren zu decken.
Der Blondschopf neben ihm war noch nicht lange im Dienst. Seit einem dreiviertel Jahr durchlief der junge Kollege die einzelnen Dezernate und Bereiche der Kripo. In der Abteilung von Linthdorf war er erst seit drei Wochen.
Er war aufgeregt, so oft hatte er es mit Tötungsdelikten bisher nicht zu tun. Linthdorf wusste nur wenig von ihm, nur den Namen und die Herkunft. Mehr hatten sie noch nicht miteinander gesprochen. Das lag auch an Linthdorfs separatem Büro. Er hoffte, mit dem Neuling etwas ins Gespräch zu kommen. »Na, Moser, wie gefällt es Ihnen hier im Osten?«
Der junge Mann schaute etwas verunsichert zu Linthdorf hinüber. War das der Beginn eines privaten Gesprächs oder wollte der Riese ihn nur mal vorführen?
Er hatte es als Süddeutscher nicht leicht im preußisch geprägten Potsdam. Sein schwäbischer Dialekt löste meist Heiterkeit, manchmal sogar Spott aus. Je mehr er sich bemühte, Hochdeutsch zu sprechen, desto auffälliger wurde sein sprachliches Manko, da ja auch der Satzbau ein vollkommen anderer war. Er war daher etwas zurückhaltender mit Kommentaren und beschränkte sich auf Floskeln, bei denen man nichts falsch machen konnte. Sein Selbstwertgefühl hatte erheblich unter den rauen Sitten des Ostens gelitten.
Er sehnte sich zurück nach den vertrauten Städtchen seiner schwäbischen Heimat mit ihren Fachwerkbauten, barocken Kirchlein und den gepflegten Vorgärten. In Böblingen grüßte man noch jeden auf der Straße, aber hier wurde man nur schief angesehen, wenn man lächelnd jemanden einen »Guten Tag« zurief.
»Naja, is scho ganz schöö hier. Aber alles eeh bissel zu groß geraten für die wenigen Leut. Und die Leut sind halt eweng schräg drauf.«
Linthdorf grinste. Mosers Versuch, diplomatisch zu sein, war gründlich gescheitert.
»Machen Sie sich nichts draus, mit der Zeit gewöhnt man sich daran.«
Der Daimler schaukelte inzwischen durch freies Feld, hinter Herzfelde wurde die Landschaft dominant, keine Siedlung störte mehr den freien Blick auf die hügeligen Felder und kleinen Wäldchen.
Alles war mit feinem weißen Schnee überzogen und ließ keinen Blick mehr auf den Untergrund zu. Grashalme starrten aus dem weißen Teppich, verliehen dem ganzen etwas Struktur. Für Moser hatte die Gegend keinerlei Reiz. Es war Terra Incognita. Er konnte mit den slawisch klingenden Ortsnamen und der spröden Landschaft nicht viel anfangen. Vieles kam ihm ärmlich vor, die meist kleinen Bauernhöfe wirkten wie aus einer fernen, längst vergangenen Zeit, verglichen mit den stattlichen Anwesen im Württembergischen.
Das ganze Land außerhalb des Berliner Speckgürtels war ziemlich leer. Im Vergleich zum dicht besiedelten Süden Deutschlands erschien ihm Brandenburg wie ein Stück Sibirien. Die spärlichen Siedlungsgebiete waren eingebettet in die endlosen Ebenen, die man stundenlang durchqueren musste, um von einem Ort zum nächsten zu kommen.
Moser hatte mit ein paar Freunden aus Böblingen, die für ein paar Tage nach Berlin gekommen waren, versucht, einen Ausflug zu machen. Alle waren sich danach einig, dass es hier oben ein recht trostloses Land sei. Sein Gegenüber Linthdorf schien aber die Fahrt zu genießen. Ihm gefiel diese Gegend, das war offensichtlich. Hier taute er auf.
Er hatte einen gewissen Respekt vor dem Riesen, der stets nach der kurzen Begrüßung in sein Büro verschwand und nur selten daraus hervorkam. Mosers Schreibtisch war der wohl ungemütlichste im ganzen Haus, direkt am Eingang mit Blick auf den Flur. Das lag wohl daran, dass er als Neuer den wohl noch einzig freien Platz für den Schreibtisch zugewiesen bekommen hatte. Ständig ging die Glastür zum Flur auf und zu und ließ keinerlei Dahindösen zu.
Jedes Mal kam auch ein Schwapp kalter Luft vom Flur mit hinein so dass Moser einen ausgewachsenen Schnupfen bekam. Auch hier im Auto hantierte er mit seinen Tempotaschentüchern und Schnupfenspray herum. Linthdorf warf einen mitleidigen Blick auf den jungen Burschen, der mindesten zwei Köpfe kleiner war als er selbst. Etwas verloren wirkte er schon hier mit seiner geröteten Nase, weit weg von seinem geliebten Böblingen.
Der Daimler rollte inzwischen vorbei an Müncheberg, eine der größeren Ansiedlungen im Oderland. Eine große Backsteinkirche thronte auf einem kleinen Hügel und war schon aus der Ferne zu sehen – sie war das Wahrzeichen Münchebergs.
Linthdorf wies mit einer Kopfbewegung auf die Kirche. »Und, schon mal in so einer Kirche drinnen gewesen?« Er wusste, dass Moser streng katholisch erzogen war. Moser schüttelte den Kopf, protestantische Gotteshäuser waren für ihn nicht wirklich interessant. Natürlich war er katholisch geprägt, vermied es aber, auf seine Konfession hinzuweisen.
Die Straßen rund um Müncheberg waren wie leergefegt. Wo waren nur die ganzen Menschen, die hier lebten? Früh morgens um halb Zehn waren in und um Böblingen die Straßen voll. Hierzulande schien alles anders zu laufen. Brandenburgs Uhren tickten langsamer.
»Lebt denn hier überhaupt jemand?«, hörte er sich fragen. Linthdorf grinste. »Klar, die meisten sind jedoch Pendler, schon längst unterwegs nach Frankfurt/Oder oder gar nach Berlin. Sie haben doch den uns entgegenkommenden Verkehr gesehen? Das sind die Leute aus den Provinzstädtchen. Manche fahren täglich zweihundert Kilometer. Das ist die neue Zeit, alles muss mobil sein und dynamisch zugehen, sonst ist man nicht fit für den Markt. Und Samstag ist großer Einkaufstag, da fahren alle, die ein Auto haben, in die nächste größere Stadt mit ihren vielen bunten Einkaufscentern.«
Moser schwieg, von den Problemen im Osten hatte er schon gehört, aber eigentlich interessierten sie ihn nicht wirklich. Er war schließlich Polizist und kein Sozialarbeiter.
Die Fahrt sollte nur etwa anderthalb Stunden dauern, aber sie kam ihm schon jetzt ewig vor. Linthdorf hätte doch die Autobahn benutzen sollen. Wieder schaukelten einsame Landschaften mit welligen Hügeln und kleinen Wäldchen vorüber. Die ganze Gegend schien eintönig zu sein. Moser seufzte, so hatte er sich die Fahrt an die Oder nicht gedacht. Er versuchte, Linthdorf in ein Gespräch über die Tote aus dem Fluss zu verwickeln, vielleicht verging die Zeit dadurch etwas schneller.
»Glauben Sie, dort wirklich noch etwas zu finden?«
»Warum nicht, der Fundort wurde nur oberflächlich abgesucht, keine KTU, keine professionellen Ermittler. Nichts gegen die Frankfurter Kollegen, aber die haben weder einen Spezialisten zur Fundstelle geschickt noch die übliche Sicherung des Fundorts angewiesen. Den einzigen Hinweis auf die Fundstelle haben wir dank des Berichts der Freiwilligen Feuerwehr.«

Oderbruch bei Kienitz
Immer noch Samstag, 7. Januar 2006
Die Fahrt ging durchs Oderbruch, einer großen Ebene, eintönig mit Schnee bedeckt. Am Horizont sah man ab und zu ein paar einzelne Gehöfte, ansonsten fuhr man auf schnurgerader Straße Richtung Osten. Nach zehn Minuten endlich eine Siedlung: Kienitz wurde ausgeschildert, rechts abbiegen.
Linthdorf steuerte seinen Daimler elegant um die große Kurve. Im Ort angekommen, parkte er im Schnee vor dem Dorfkrug. Es war noch immer ziemlich früh am Morgen. Der Tag fing gerade erst an hell zu werden. Linthdorf warf sich seinen schwarzen Mantel über, setzte den Hut auf, schlug den Kragen hoch und trabte Richtung Kneipe.
Moser im modischen Parker mit vielen aufgesetzten Taschen und glitzernden Reißverschlüssen folgte ihm. Ein ungleiches Paar machte sich auf, hier etwas zu erfahren. Linthdorf ging mit großen Schritten, es sah eigentlich recht gemächlich aus, dennoch hatte Moser Schwierigkeiten, Schritt zu halten, musste daher öfters kleine Zwischenspurts einlegen.
Am Fenster des Dorfkrugs erblickte der Gastwirt das ungleiche Paar. Er öffnete offiziell erst um Elf Uhr, jetzt war es gerade mal kurz nach Zehn. Linthdorf klopfte ans Fenster und zeigte seinen Dienstausweis.
Der Gastwirt schaute verwundert auf den Ausweis. Was wollte die Potsdamer Kripo hier? Er schlurfte in Pantoffeln Richtung Tür, schloss auf.
»Können wir einen Kaffee bei Ihnen bekommen? Und vielleicht auch etwas Essbares dazu?«
Linthdorf schaute den Wirt leutselig an. Der blickte etwas verunsichert auf.
»Ja, ich dachte, Sie sind von der Kripo?«
»Klar, aber deshalb haben wir doch auch menschliche Bedürfnisse ... Apropos, wo sind denn die Toiletten?« Linthdorf verschwand mit wehendem Mantel Richtung Tresen, wo die Tür mit der Aufschrift »Toiletten rechts« war. Moser stand dem Wirt etwas unschlüssig gegenüber.
»Ja, wenn Sie mögen, dann mach ich schnell was. Rührei mit Schinken und Schwarzbrot dazu?«
Moser nickte, er hatte keine Ahnung, was man hierzulande zum Frühstück verzehrte.
»Ja ja, zwei Portionen.«
Linthdorf kam freudestrahlend wieder in die Gaststube und rief dem Wirt hinterher: «Für mich ne doppelte Portion!«
Sie ließen sich am Fenster nieder. Der Tisch war mit einer rot karierten Decke bedeckt, eine kleine Vase mit Plastikblumen stand als Dekoration neben dem Bierdeckelhalter. Linthdorf ließ sich mit einem Ächzen auf den Holzstuhl krachen. Die Gaststube war noch recht kühl. Er hatte sicherheitshalber seinen Mantel angelassen, und Moser zog sich seinen Parker wieder über. Nach wenigen Minuten kreuzte der Wirt mit dem dampfenden Kaffee und den Rühreitellern auf.
Linthdorf strahlte, begann auch gleich zu essen. »Mmmh, köstlich! Noch alles handgemacht ohne Mikrowelle.« Der Wirt lächelte ein wenig.
»Sagen Sie mal, Sie haben doch auch den Trubel mit der Toten aus der Oder mitbekommen?«
»Ja, klar doch, war ja Dorfgespräch ... Aber Tote im Fluss gibt’s hier öfters. Meist Schmugglers aus Polen.«
»Wissen Sie, wo ich die Leute von der Feuerwehr finden kann, speziell die beiden Kollegen, die als Erste die Leiche erblickten?«
»Ja, das sind der Kohlgruber, der wohnt am unteren Ende vom Dorf in der 24, und der Cholynski, der wohnt mit seiner Familie draußen in der neuen Siedlung, hat dort ein Haus gebaut. Nummer weiß ich jetzt nicht, ist aber leicht zu erkennen, er hat sein Dach mit blauen Schindeln gedeckt.«
»Was erzählt man sich denn im Dorf über die Tote aus dem Fluss? Kannte die hier eigentlich jemand?«
Der Wirt kratzte sich am Kopf.
»Also, was die Feuerwehrleute so erzählten, war die Tote ja nur schwer zu erkennen, soll ziemlich entstellt gewesen sein, keine Augen, Nase weg, über und über mit Wunden bedeckt. Aber erkennen tat sie eigentlich keiner, war jedenfalls keiner von uns bei, der sie schon mal gesehen hatte.«