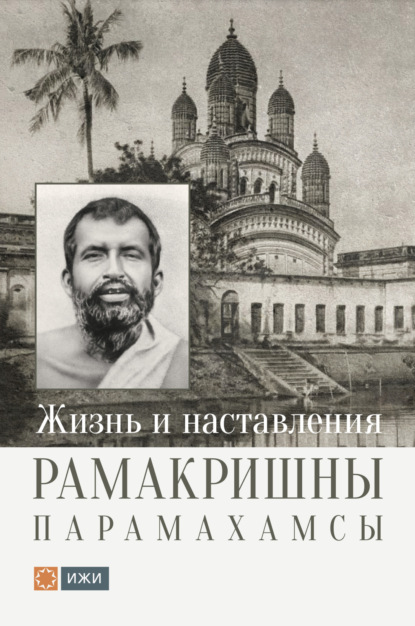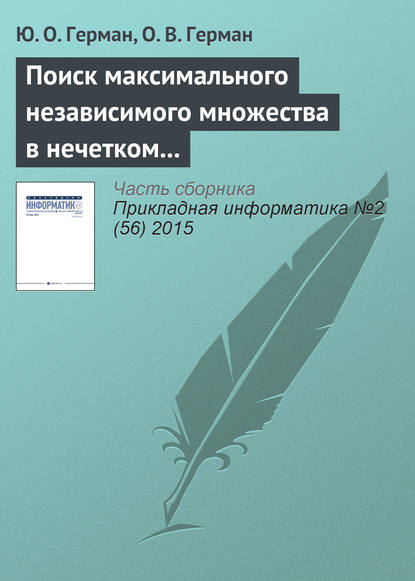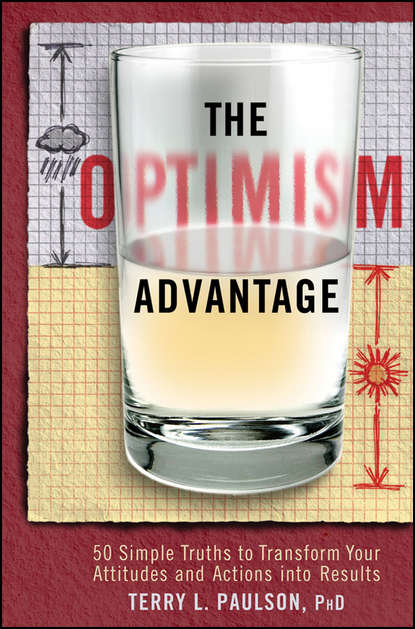- -
- 100%
- +
Am späten Nachmittag, inzwischen war die Liste auf fünfunddreißig Namen geschrumpft, hatte er Glück. Eine Zahntechnikerin aus dem Norden Berlins schien die Arbeit zu kennen. Jedes Mal musste nach dem Telefonat ein Fax mit der Zeichnung des Gebisses versandt werden. Daher dauerte auch die Bearbeitung der Liste so lange.
Jedenfalls rief diese Zahntechnikerin an und glaubte, ihre Arbeit zu erkennen. Linthdorf war wieder hellwach, notierte sich die Adresse und schwang sich in seinen Daimler. Die Zahnklinik lag irgendwo im tiefsten Wedding. Eine Gegend, die Linthdorf nicht sehr vertraut war. Sein Navigationsgerät schickte ihn durch noch nie gesehene Straßen, die fast durchgängig mit türkischen und libanesischen Geschäften gesäumt waren.
In einer etwas ruhigeren Seitenstraße hielt er an. Die Zahnklinik lag im ersten Stock eines alten Gründerzeithauses. Er stapfte die Treppe hinauf, es roch undefinierbar nach etwas Süßlichem. Kurzes Klingeln. Die Tür öffnete sich. Im bläulichen Neonlicht stand eine zierliche Frau mit straff gekämmten Haar und Designerbrille. Sie war sichtlich verwirrt von dem Riesen vor ihr. Linthdorf zückte seinen Dienstausweis.
»Haben wir miteinander telefoniert?«
»Sind Sie der Kripomann?«
»Ja, bin ich«
»Kommen Sie bitte!«
Linthdorf folgte der kleinen Person in ein Büro, das erstaunlicherweise eine sehr angenehme Helligkeit in warmen Farben ausstrahlte. An den Wänden waren farbige Reprodrucke von Impressionisten in einfachen Rahmen. Das Zimmer war mit Kiefernholzregalen möbliert, darin Ordner und Gipsmodelle von Zahnreihen. Hinter einem Schreibtisch saß eine vielleicht fünfzigjährige Frau mit gepflegtem Äußeren und ernster Miene. Linthdorf wollte gerade zu sprechen ansetzen, da hatte sie ihm schon eine Kladde hingelegt.
»Diese Frau ist die Besitzerin des Implantats, welches Sie mir gefaxt haben. Eine ziemlich aufwendige Arbeit.«
Linthdorf griff sich die Kladde, blätterte, notierte sich Namen und Anschrift. Er versuchte noch ein Gespräch mit der Zahntechnikerin anzufangen: »Erinnern Sie sich noch an die Frau?«
Sie zögerte, am Telefon hatte Linthdorf gesagt, es handele sich um ein Gewaltverbrechen.
»Sie ist tot?«
»Ja, wir fanden sie vor drei Wochen in einem ziemlich üblen Zustand, der eine Identifizierung unmöglich machte.«
»Darf man fragen, wo Sie das arme Ding gefunden haben?«
»In einem Fluss. Wehalb möchten Sie das wissen?«
»Ich kenne sie nur flüchtig. Ihre Mutter war schon bei mir. Die hatte gar keine Zähne mehr mit Anfang Sechzig. Scheint wohl erblich zu sein. Jedenfalls kam sie zu mir mit einem sehr desolaten Gebiss, ich glaube, die meisten Zähne waren rettungslos verloren. Sie war starke Raucherin. Nikotin ist Gift für die Zähne, und wenn die Substanz sowieso schon von Hause aus schlecht ist, nun ja, dann ist der Zustand mit Ende Dreißig ebenso wie er hier ist, ehmm, war.«
»Wann war die Frau das letzte Mal bei Ihnen?«
»Ist schon eine Zeitlang her. Warten Sie, ich schaue mal in meinen Kalender.«
Sie drehte sich zu ihrem Computermonitor, tippte ein paar Mal auf die Tasten. »Ja, hier haben wir sie. Karolin Brakel. Am 15. August letzten Jahres.
»Was haben Sie da bei ihr gemacht?«
»Ein Stück Zahn war abgebrochen. Ich musste das Implantat anpassen an den abgeschliffenen Zahnstumpf. Eine knifflige Sache, da vom ursprünglichen Zahn nur noch ein winziger Stumpf übrig war. Dieser Stumpf sollte das ganze Implantat halten. Es war absehbar, dass sie damit in Kürze wieder hier sitzen würde. So hat sich ja das Problem erledigt.«
Linthdorf erhob sich und dankte für die Informationen. Nun begann die eigentliche Arbeit erst. Er hatte einen Namen, eine Anschrift und auch einen Angehörigen. Mehr, als er zu hoffen gewagt hatte nach dem schleppenden Verlauf der Ermittlungen in den letzten Tagen.
Die Anschrift war gleich um die Ecke, jedenfalls ließ die Postleitzahl darauf schließen. Er entschloss sich zu laufen. Seine zerfledderte Berlinkarte, die ihm schon oft gute Dienste geleistet hatte, zeigte ihm den Weg.
Nur vier Straßen weiter war die Anschrift: Brüsseler Straße 18. Er querte die Müllerstraße mit ihren hektischen Händlern und Dönerbuden, tauchte ein in ein Viertel, dessen bessere Zeiten schon lange vorbei zu sein schienen.
Viele Geschäfte standen leer, die wenigen, die noch belegt waren, boten Secondhandklamotten und anderen Billigkram an. Die Hausnummer 18 machte da keine Ausnahme. Das Schaufenster war staubig, in der Auslage waren ein paar alte Bücher aufgestapelt. Mit Pinsel war auf ein Pappschild mit ungelenken Buchstaben »Antiquariat« geschrieben. Im Hintergrund hatte es sich ein Altachtundsechziger in einem Sessel gemütlich gemacht.
Linthdorf kannte diesen Typus Mensch. Wichtig war ihnen vor allem, dass sie unangepasst waren. Gegenüber dem Staat und seinen Organen waren sie misstrauisch und skeptisch. Meistens bekam man keine brauchbaren Antworten.
Linthdorf hatte es sich angewöhnt, incognito zu bleiben und so vielleicht doch etwas mehr zu erfahren. Er betrat das kleine Ladengeschäft, duckte sich, um nicht anzustoßen, begann in den aufgestapelten Büchern herumzustöbern. Der Ladeninhaber würdigte ihn noch keines Blickes.
Linthdorf zwängte sich zwischen den eng stehenden Regalen durch, blieb vor der Krimiabteilung stehen. Ab und zu kaufte er sich einen Paperpack-Krimi, den er meist innerhalb von ein paar Nächten verschlang.
Die Kommissare in diesen Krimis hatten immer viel Action, wilde Verfolgungsjagden, Affären mit zwielichtigen Frauen und am Ende stets den Mörder gefunden. Dennoch mochte er die Krimikommissare. Speziell die Schweden und die Briten hatten es ihm angetan.
Einen besonderen Ehrenplatz hatten die Krimis des Belgiers Simenon. Dessen Helden Maigret fühlte sich Linthdorf seelisch eng verbunden. Aber das Arbeitsumfeld der Krimihelden war meist geprägt von spektakulären Szenerien. Hier in Brandenburg war alles so durchschnittlich und banal. Kein Vergleich zu der zermürbenden und meistens auch recht monotonen Arbeit eines wirklichen Ermittlers.
Die meiste Zeit verbrachte Linthdorf bei der Durchsicht von Akten, beim Abgleich von endlosen Listen und bei der Computerrecherche. Eine Verfolgungsjagd hatte er seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt und seine Dienstwaffe gebrauchte er nur zum monatlichen Übungsschießen.
Zwei kleine Bücher hatte er inzwischen entdeckt: Edgar Wallace und Agatha Christie. Er kannte sie schon, aber sein guter Freund Voßwinkel war ebenfalls ein Krimiliebhaber und Sammler. Ein guter Grund, mal wieder mit einer Flasche Rotwein bei ihm vorbeizuschauen. In letzter Zeit hatten sie sich nur selten gesehen, obwohl Voßwinkel nur zehn Minuten entfernt von Linthdorf wohnte.
Der Antiquar war auf einmal freundlich gestimmt. Er sah, dass sein riesiger Kunde wirklich Interesse an den Büchern und sogar schon welche ausgewählt hatte. Beim Bezahlen fragte Linthdorf nach dem Geschäft. »Ziemlich schwierige Lage hier?«
Der Antiquar winkte ab: »Ach, ich hab’ schon schlechtere Läden gehabt.«
»Aber von der Laufkundschaft können Sie hier nicht existieren?«
»Nee, ick hab’ aber meene Stammkunden. Liebhaber, Studenten und Sammler. Die sind mir auch viel lieber. Jedes Mal hat man noch ein nettes Gespräch über die Weltenläufe und bekommt so etwas mit über seine Umwelt.«
»Ich bin auf der Suche nach Frau Karolin Brakel. Kennen Sie die?«
»Die wohnt doch hier. Klar, kenn’ ick! Wieso wollen Sie das wissen?«. Der Antiquar stutzte.
Linthdorf zückte seinen Dienstausweis. Erschrocken wich der Antiquar zurück. Mit der Polizei wollte er nichts zu tun haben.
»Hat se wat verbrochen? War eijentlich immer ne janz nette. Stets freundlich. Brachte ab und zu mal Bücher vorbei. Schien wohl nicht janz so vermögend zu sein. Hab se jetzt aber schon ne janze Zeitlang nicht mehr jesehn.«
»Sie ist tot. Wir untersuchen die Umstände ihres Todes, da gibt es noch Klärungsbedarf.«
Der Antiquar kratzte sich seinen grauen Bart. Er begann in einer Ecke zu wühlen, die Linthdorf bisher achtlos liegen gelassen hatte. Es war die Esoterik-Abteilung. Horoskope, Astrologie, Psi-Erfahrungen, Feng-Shui und andere übersinnliche Literatur lagen dort aufgestapelt. Die bunt aufgemachten Bücher hatten auf Linthdorf keinen Reiz ausgeübt, darin zu blättern. Der Antiquar zerrte aus dem Stapel ein paar dünne Schwarten.
»Die hab ick für sie zurückjelegt. Hatte se schon vor Weihnachten bei mir entdeckt und wollte se imma ma abholen kommen, aba kam nicht mehr. Da hab ick se wieder zurück in’n Stapel jepackt.«
Vor Linthdorf lagen zwei Paperpacks mit der für esoterische Literatur typischen Aufmachung. Irgendwelche verschwimmenden Farben in grellem Orange und dunkelblauen Tönen. Die Titel waren die für die Branche üblichen Verheißungen: »Endlich glücklich!« und »Glück ist kein Zufall«. Im Untertitel wurde dann schon mehr erklärt. Das orangefarbene Büchlein war ein Traumdeuterbuch und das dunkelblaue ein Buch über indianische Astrologie. Linthdorf kaufte die beiden Büchlein ebenfalls.
Der Antiquar freute sich über den unerwarteten Umsatz. Er gab dem riesigen Polizisten noch den Tipp, gleich nebenan bei der Mutter des Opfers zu klingeln. Sie wohnte fast Tür an Tür mit ihrer Tochter.
Berlin-Wedding
Immer noch Montag, 16. Januar 2006
Linthdorf klingelte an der Wohnungstür von Frau Bärbel Zabelthau. Keine Reaktion. Er lauschte, ob sich hinter der schweren Tür etwas regte. Hinter sich hörte er schlurfende Schritte.
»Wollen se zur Frau Zabelthau? Die is verreist nach Bayern zu ihre Kinders, kommt erst nächste Woche wieda.«
Linthdorf zögerte. »Wissen Sie, wie lange die Frau schon weg ist?«
Die ältere Dame musterte ihn skeptisch. »Wieso wollense det wissen? Wer sind se denn übahaupt?«
Umständlich zog Linthdorf seinen Dienstausweis hervor. Die Frau schlug die Hand vor den Mund: »Oweih, hatse wat ausjefressen? Aba die Bärbel doch nich. Det hängt bestimmt mit ihrem feinen Frollein Tochta zusammen, die is imma ma for sowat jut. Nee, die Bärbel is schon vor Weihnachten wech zu ihre Kinders. Machtse jedes Jahr. Is ihr hier zu trübsinnig, sachtse jedenfalls.«
»Was können Sie mir denn zur Tochter von Frau Zabelthau sagen?«
»Ach, det is ne lange Geschichte. Det Meechen is eijentlich ne freundliche Seele, hat aba wat an sich, was unglücklich macht. Keena weeß, wat mit ihr los is. Ma isse janz verjnügt, ma isse nur n Schatten, mit de Männa isset bei ihr schlecht bestellt. Keena hielts lange bei ihr aus. Bis of den letzten, det wa n freundlicher und jedulgiger Mensch, der hatte se jut im Griff.
Aba irjendwat is da ooch wieda schief jeloofen, Jedenfalls hab ick ihn schon ne janze Zeit lang nich mehr jesehn. Sie übrijens ooch nich. Bestimmt schon seit Weihnachten nich mehr. Aba det will bei ihr nichts heißen. Die verschwindet öfters mal.«
»Was arbeitet sie denn?«
»Sie sacht imma, sie wär‘ selbständich. Aba gloob ick nich, hat nie Jeld, pumpt ihre Mutta dauernd an und looft imma in Klamotten rum wie von vorjestern. Ob se Stütze kriegt, weeß ick nich.«
»Na ja, erst mal vielen Dank. Darf ich noch nach Ihren Namen fragen? Vielleicht müssen wir Sie nochmal befragen ...«
Die ältere Dame wurde ungehalten. »So war det aba nicht jemeint. Also ne Petze bin ick nich!«
Sie zögerte kurz. »Also jut, ick heiße Hildejard Krapf, wohne hier schon seit mehr als fünfunffuffzich Jahre, verwitwet, ehemals Damensalon »Blondet Jift«, det wa ma mein Frisörjeschäft gleich um die Ecke. Bin aba schon in Rente seit zwölf Jahre.«
Linthdorf notierte eifrig die Angaben und verabschiedete sich.
Berlin-Wedding
Montagabend, 16. Januar 2006
Im Treppenhaus war ein eigenartiges trübes Schummerlicht, die Kugellampen verbreiteten unter starker Anstrengung nur ein schwaches Leuchten. Der grüngelbe Ölanstrich im Treppenhaus schluckte fast jedes Lichtquantum auf. Linthdorf brauchte etwas Zeit, um sich zurechtzufinden.
Aus seiner großen Manteltasche wühlte er ein klirrendes Bündel mit Schlüsseln und eigenartig geformten Haken hervor. Auch ein paar Latexhandschuhe förderte er zutage, die er mit geübten Griffen über seine Hände zog.
Er wusste schon, dass er sich jetzt auf verbotenes Terrain begab. Aber da hatte er sich inzwischen ein dickes Fell zugelegt. Falls es notwendig wurde, konnte er ja im Nachhinein noch ein entsprechendes Amtshilfeersuchen an die Berliner Kollegen aufsetzen. Ein Blick auf das Schloss genügte, um aus dem Bündel zwei längliche Haken auszuwählen.
Vorsichtig stocherte er mit dem ersten Haken im Türschloss herum, spürte den Widerstand und ruckelte kurz. Mit einem vernehmbaren Klicken öffnete sich die Tür. Linthdorf schlüpfte hinein, holte seine Taschenlampe aus der anderen Manteltasche und tastete sich voran.
Die Wohnung roch nach allen möglichen exotischen Düften, Weihrauch, Patchouli, Ingwerholz, Ambra, Zimt. Auf einem selbst gezimmerten Regal waren längliche Schalen mit halb abgebrannten Räucherstäbchen zwischen Glaszylindern mit öligen Flüssigkeiten aufgereiht. Vorsichtig schnüffelte Linthdorf in diese Glasflakons hinein. Ein stechender Geruch, erdig schwer, schoss ihm direkt durch die Nase ins Hirn. Die Augen tränten und ein unangenehmes Gefühl von Benommenheit machte sich breit.
Linthdorf ging weiter. Die Altbauwohnung war großzügig geschnitten, der lange Flur führte fast zwölf Meter ins Dunkle. Vier oder fünf Zimmer schien die Wohnung groß zu sein. Er öffnete eine schwere, getäfelte Holztür, die nach links abging.
Das Zimmer war etwas chaotisch eingerichtet. Überall lagen Blätter verstreut auf dem Boden, die Wände waren mit bunten Tüchern behangen, quer durch das Zimmer war eine Schnur gespannt, an der ein schwerer Vorhang hing. Im hinteren Eck war ein Computer aufgebaut. Die paar Grünpflanzen direkt neben dem Fenster waren vertrocknet, hier war schon wochenlang kein Wasser mehr in der staubtrockenen Blumenerde.
Linthdorf setzte sich an den Computer, der kleine Drehhocker ächzte vernehmlich, als der Riese sich auf ihn niederließ. Es war schon ein älteres Modell mit großem Desktop und externen Zusatzmodulen. Der Bildschirm schien auch nicht mehr der Neueste zu sein. Nur langsam bauten sich auf dem gewölbten Monitor die einzelnen Programme auf. Ein Fenster öffnete sich und fragte nach dem Passwort. Linthdorf probierte es mit den Namen Karolin und Brakel, natürlich erfolglos, resigniert fuhr er den Computer wieder herunter und schaltete ihn wieder aus.
Im nächsten Zimmer, das direkt gegenüberlag, waren ein großes Doppelbett und ein Schrank, dessen Türen geöffnet waren. Wahllos stapelten sich diverse Kleidungsstücke in den Fächern.
Auf dem Boden verteilt sah Linthdorf gebrauchte Unterwäsche und Papiertaschentücher, die zerknüllt herumlagen. Auch hier roch es durchdringend nach irgendwelchen schwer bestimmbaren Essenzen und ätherischen Ölen. Die Wände waren kahl, allerdings mussten dort mal Bilder gehangen haben.
Helle Vierrecke zeichneten sich da ab, wo früher die Bilder waren. Die Vorhänge waren zugezogen. Linthdorf lupfte den Vorhang und spähte durchs Fenster auf die Straße. Unten war wenig Verkehr. Ein paar dunkle Gestalten hockten vor dem Musikgeschäft mit der eigenartigen Gruseldekoration und tranken aus großen Flaschen.
Linthdorf zog sich zurück und verließ das Schlafzimmer. Der nächste Raum war wohl das Wohnzimmer. Ein großer, runder Tisch stand in der Mitte, Bücherregale ringsherum, zwei Korbsessel am Fenster, dazwischen eine kleine Konsole mit einer Musikanlage darauf. Ein Plattenspieler war aufgeklappt, eine schwarze Vinylscheibe lag noch auf, schon eingestaubt. Linthdorf suchte die Hülle. »Pogo Music« fand er unter dem linken Korbsessel. Die Platte war in den frühen Achtzigern gepresst worden. Er erinnerte sich schwach an die lauten Klänge der damaligen Zeit. Auch hier waren alle Bilder von den Wänden entfernt worden.
Ein Durchgang führte zu einem weiteren Zimmer, in dem ein großes Sofa stand, ein kleiner Glastisch und ein Fernseher. Auf dem Glastisch standen diverse Gläser, deren Inhalt schon lange verdunstet war und eine Schale mit Nüssen, viele geknackte Schalenteile lagen herum. Etwas klebrig war die Glasplatte, unter dem Tisch lagen diverse Damenschuhe mit hohen Absätzen. Bei zweien waren die Absätze abgebrochen. Auf dem Sofa waren mehrere kleine Kissen aufgestapelt. Alle schon etwas zerschlissen, aber wahrscheinlich selbst gemacht. Auch hier fehlten wieder die Bilder an den Wänden. Ein kleiner Teppich war mitten im Raum als dunkles Rechteck auf den abgezogenen Dielen zu sehen. Linthdorf vermied es, seine Füße darauf zu setzen.
Die Wohnung machte nicht den Eindruck, als ob sie verlassen worden war, und dennoch ging etwas zutiefst Trostloses von dieser stillen Welt aus. Ob das nun an den fehlenden Bildern lag oder an den von Staub bedeckten Dingen des Alltags oder an den vertrockneten Grünpflanzen, Linthdorf konnte es nicht genauer eingrenzen.
Er spürte es körperlich, dass hier etwas nicht stimmig war. Für eine Person allein war die Wohnung einfach zu groß, aber nichts deutete auf das Vorhandensein weiterer Menschen hin. Er spürte, dass hier noch die Schatten anderer Mitbewohner geblieben waren. Aber er schaffte es nicht, diese Schatten sichtbar zu machen.
Aus dem Wohnzimmer ging er wieder hinaus in den Flur. Noch zwei Türen waren zu öffnen. Wieder ein Raum, der allerdings fast vollkommen leer war. Eine Liege mit Blumenmuster stand dort quer inmitten des Zimmers, leere Regale und ein Schrank, in dem nur ein alter Teddybär lag.
Von der Decke hing hier eine nackte Glühbirne. Die Vorhänge waren zugezogen, es roch muffig nach abgestandener Luft. Wozu dieser Raum einst genutzt wurde, ließ sich schwer nachvollziehen. Als Gästezimmer war es zu spartanisch eingerichtet und für eine Abstellkammer einfach zu groß.
Linthdorf hob den Teddy auf. Es war noch einer der altmodischen Plüschbären mit der klassischen Teddybärenphysiognomie. Er hatte etwas Unschuldiges, blickte mit seinen Knöpfchenaugen zufrieden und stumm. Sein Bauch war rund und er machte das typische Geräusch, wenn man ihn bewegte. Moderne Familien kauften ihren Kindern grellfarbene Plüschmonster aus den aktuellen Disneyfilmen oder irgendwelche Softgummi-Saurier. Altmodische Teddys gehörten mehr in Antiquitätenläden oder in Glasvitrinen älterer Damen. Seltsam, dass ein solcher Bär hier so achtlos herumlag.
Die letzte Tür. Linthdorf öffnete sie vorsichtig. Es war die Küche. Ausgestreckt auf dem Boden lagen zwei Katzenkadaver. Wahrscheinlich jämmerlich verhungert. Die zerfetzten Reste der Katzennahrungstüten waren verteilt auf dem Küchenboden. Im Regal standen fein säuberlich aufgestapelt flache Dosen mit Katzenfutter, welche allerdings für die beiden Tiere unerreichbar geblieben waren. Sie konnten den Dosenöffner nicht bedienen.
Linthdorf atmete tief durch und zwang sich, die beiden Kadaver anzusehen. Sie schienen dehydriert zu sein, machten den Eindruck beginnender Mumifizierung. Im Waschbecken türmte sich Geschirr mit eingetrockneten Spuren diverser Lebensmittel. Die verzweifelten Tiere hatten versucht, essbare Reste noch abzuschlecken. Auch hier fehlten die Bilder an der Wand. Nur eine Uhr hing einsam über der Spüle. Auch sie war tot, stehen geblieben um zwölf Uhr.
Von der Küche ging eine Tür ins Bad. Der Spiegelschrank beherbergte eine Sammlung kleiner Flakons mit mehr oder weniger eigenartig riechenden Substanzen. Das Schubfach unterm Spiegelschrank stand offen. Darin eine Plastiktüte mit etwas dunklem Gekrümel. Linthdorf schnupperte, eindeutig Marihuana. Im Bericht des Gerichtsmediziners wurde explizit darauf hingewiesen. Karolin Brakel war Kifferin.
Nachdenklich zog er sich zurück, sorgsam darauf achtend, nichts zu verstellen oder etwas zu bewegen. Die Wohnung gab ihm Rätsel auf.
Lebte Karolin Brakel hier allein? Unwahrscheinlich. Aber nichts deutete auf eine weitere Person hin.
Wo waren die Bilder, die einst die Wände zierten?
Was hatte es mit dem fast leeren Zimmer auf sich, wo nur ein Teddybär noch residierte?
Linthdorf machte sich auf den Heimweg, draußen regnete es. Er schlug seinen Mantelkragen hoch und zog sich den Hut tief ins Gesicht, eilte zum Auto und fuhr ins Dunkel der Nacht.
Berlin-Friedrichshain
Samstag, 21. Januar 2006
Wochenende. Draußen war der strenge Frost in Schmuddelwetter übergegangen. Es war trübgrau und nieselte. Linthdorf war wie üblich schon um halb acht wach geworden, saß in der kleinen Küche, lauschte den Klängen vom »Berliner Rundfunk«, der ein etwas nerviges Gewinnspiel zwischen den Musiktiteln seinen morgendlichen Hörern zumutete.
Vor ihm stand ein großer Becher mit starkem Kaffee auf dem Tisch. Ein Glas Pflaumenmus und eine Packung mit acht einzeln verpackten Würfeln Frischkäse waren etwas achtlos auf dem karierten Tischtuch verteilt. Diese Momente der Besinnung waren in seinem Leben rar geworden.
Er flüchtete sich in seine Arbeit und versuchte einen Sinn in seinem Tun zu finden, nachdem seine private Welt nun schon wiederholt Schiffbruch erlitten hatte. Die Trümmer seiner familiären Welt bekam er alle vierzehn Tage zu sehen.
Das waren seine beiden Söhne, die inzwischen auch schon recht flügge waren und die kurz bemessene Zeit mit ihm nutzten, einmal richtig auszugehen in ein Restaurant und danach noch einen Kinofilm zu sehen. Linthdorf genoss diese kurze Zeit familiärer Vertrautheit. Er war eigentlich ein Familienmensch, litt immer noch unter der Trennung von seiner Frau. Keine neue Kandidatin hatte es bisher geschafft, den Platz in seinem Herzen einzunehmen, den Corinna einst innehatte. Privat kam er sich seither nur als halber Mensch vor. Die ersten Monate nach der Trennung waren eine einzige Hölle für ihn. Er betäubte sich mit Überstunden und einem Arbeitswahn, der ihn fast umbrachte.
Seine sowieso nur knapp bemessene Schlafenszeit wurde auf drei bis vier Stunden verkürzt. Oft lag er nächtelang wach, grübelte über sein Schicksal und führte stille Gespräche mit Corinna, die wie eine Traumfigur immer mehr verblasste und feenhafte Züge annahm.
Anfangs setzte er sich in solch schlaflosen Nächten ans Steuer seines damals noch neuen Dienstwagens und kurvte durch die Straßen Berlins, bis es wieder hell wurde. Sein Benzinverbrauch stieg und sein Nervenkostüm wurde immer dünner.
Er lief tagelang gereizt herum, selbst gute Freunde machten einen Bogen um ihn.
Inzwischen war wieder etwas Normalität in den Alltag gekommen. Diese Normalität war allerdings eine sehr fragile, brüchige Sache. Kleinste Dinge reichten oft aus, um Linthdorfs Lebensgefüge aus der Balance zu bringen. Die Folge waren erneut schlaflose Nächte.
Linthdorf hatte sich mit dieser Situation arrangiert. Die Intimität der Dunkelheit wurde ihm eine Schutzhülle, in der er sich sicher und gelöst bewegen konnte. Die nervigen Dinge des Alltags existierten nachts nicht mehr. Kein Telefongeläut zerriss die samtige Harmonie der Nacht. Oft stand er am Fenster, beobachtete den abflauenden Verkehr oder starrte einfach nur in die dunkelgelb glimmende Mondscheibe.
Komisch, dachte er, wenn er dorthin mit seinen Gedanken flüchtete, von hier aus hat er so eine schöne Farbe, aber die Welt da oben soll ganz ohne Farben sein, nur Grau, Schwarz und Weiß. In seinem Bücherregal stand ein Bildband mit den spektakulärsten Mondaufnahmen, die von den amerikanischen Mondlandeunternehmen gemacht worden waren. Anfangs hatte er diese Bilder der fremden Welt mit großem Interesse in sich eingesogen, war aber dann von der trostlosen Farblosigkeit, die von den Hochglanzfotos ausgingen, doch enttäuscht. Lieber schaute er sich den Mond aus der sicheren Entfernung an, dann konnte man mit ihm in einen stummen Dialog treten.
Linthdorf fühlte sich hier in Berlin als einer von vielen Einsamen, das machte die Situation erträglicher.
Irgendwo im Radio hatte er bei einem Gespräch von klugen Leuten erfahren, dass Berlin Deutschlands Single-Stadt Nummer Eins sei, über 800.000 einsame Menschen sollten hier in der Stadt leben. Zählte er seinen Bekanntenkreis durch, musste er dieser Erhebung Recht geben. Fast alle lebten in den Trümmern einstiger Zweisamkeit, führten Fernbeziehungen oder nur ein Wochenendverhältnis mit ebenso gestressten und vereinsamten Menschen. Der unglaublich schnelle Takt des Lebens in dieser Stadt zog zu viel Energie aus den Körpern und Seelen. Die Leere, die dann in den stilleren Momenten des Privaten einzog, war für viele Beziehungen zu einer Falle geworden.