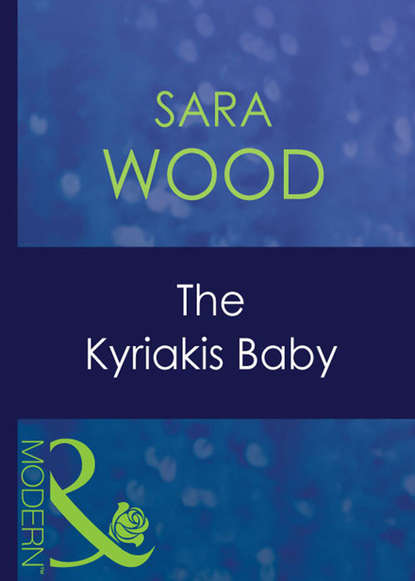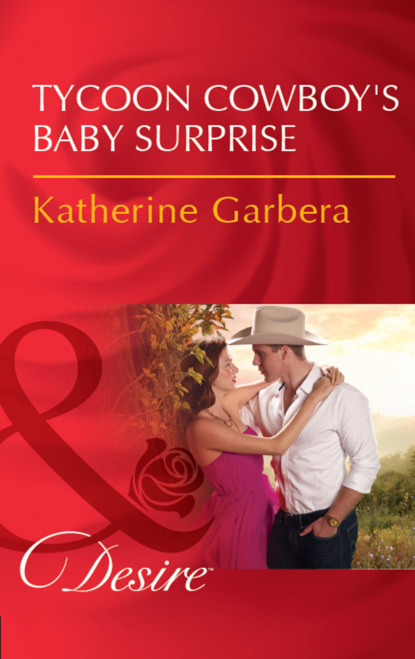- -
- 100%
- +
Linthdorf eilte durch das Labyrinth der unterirdischen Gänge unterm Alex, treppauf, treppab, vorbei an ratlos herumstehenden Touristen, die hier unten seltsam verloren wirkten, und an den inzwischen hier heimisch gewordenen Schnorrern und Bettlern, die jeden halbwegs freundlich aussehenden Passanten bedrängten. Er kannte diese kleinen Showeinlagen zur Genüge, wich geschickt den Schnorrern aus und setzte dazu ein total finsteres Gesicht auf. Die imposante Größe flößte dabei genügend Respekt ein, so dass er nahezu unbehelligt durch die Unterwelt kam.
Endlich tauchte die Oberwelt wieder auf. Linthdorf atmete tief durch. Sein Ziel war das Berliner Polizeipräsidium. Hier residierte sein guter Freund Voßwinkel. Bernd Voßwinkel war zuständig für Gewaltverbrechen in der Hauptstadt, das heißt, er gehörte zu der recht großen Truppe von Ermittlern der 3. Mordkommission, die hier halbwegs für Recht und Ordnung zu sorgen hatten. Allein sein Dezernat umfasste mehr als dreißig Mitarbeiter. Zahlen, von denen Linthdorf in Potsdam nur träumen konnte.
Das riesige Gebäude in der Keibelstrasse beherbergte mehrere hundert Büros, in denen über tausend Beamte beschäftigt waren. Da es oft zu Koordinierungsproblemen zwischen Berlin und Brandenburg kam bei der Jagd nach den Tätern, die sich aus den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen überhaupt nichts machten und munter über Landesgrenzen hinweg ihre Fährten hinterließen, war die Zusammenarbeit der Dienststellen von vitalem Interesse für alle.
Mit Voßwinkel hatte Linthdorf einen kompetenten Partner bei der Berliner Kripo, der schon oft schnell und unbürokratisch geholfen hatte. Gestern hatte er bereits mit ihm telefoniert und kurz angedeutet, dass er mal wieder Hilfe brauchte.
Voßwinkel nickte verständnisvoll und machte gleich einen Termin für Linthdorf frei.
Das Büro von Voßwinkel war ein großer Raum, in dem sechs Schreibtische paarweise aufgestellt waren, dazu jede Menge Regale mit Aktenordnern und ständig schrillenden Telefonen. Linthdorf grüßte die drei im Raume anwesenden Mitarbeiter flüchtig, man kannte sich eben.
Voßwinkel kam auf ihn zu, schüttelte ihm energisch die Hand und bat Linthdorf an seinen Schreibtisch. Der sportlich durchtrainierte Voßwinkel wirkte neben dem massigen Linthdorf wie ein aufgezogenes Rumpelstilzchen. Seine grauen Haare zu bändigen war für Voßwinkel ein Kunststück, das ihm an jedem neu angebrochenen Tag misslang. Früh am Morgen schaffte er es noch, die wirre Pracht mit Wasser und Kamm zu ordnen, im Laufe des Tages jedoch machten sich die störrischen Haare nach jeder Richtung auf und verliehen ihm ein verwegenes Aussehen. Sein etwas lang gezogenes Gesicht mit der randlosen Brille und der Sesamstraßenfrisur ließen ihn als Intellektuellen erscheinen, auch sein Kleidungsstil ließ Rückschlüsse auf seinen eigentlichen Beruf nicht zu. Meist sprang er im T-Shirt und Jeans im Büro herum sein Pistolenhalfter in Wildwestmanier umgeschnallt. Jetzt im Winter trug er noch eine dünne Jeansweste als Kälteschutz.
Linthdorf wirkte dagegen wie aus einem bürgerlichen Gesellschaftsstück. Stets trug er ein dezent kariertes Sakko, T-Shirts waren für ihn tabu, dafür gab es Hemden. Ein Schal, der schwarze Mantel und der schwarze Hut vervollständigten sein Outfit. Ihm nahm man den Polizeibeamten schon ab. Wenn die Beiden sich gegenübersaßen, konnte man den Eindruck bekommen, dass hier zwei Welten aufeinanderprallten. Dabei harmonierten sie wunderbar.
»Na, was haste auf’m Herzen?«, eröffnete Voßwinkel das Gespräch.
»Tja, ne ganze Menge, wenn du mich so fragst«, Linthdorf holte seine Mappe hervor, schilderte kurz den bisherigen Verlauf und erwähnte auch, dass er in der Weddinger Wohnung der Toten war.
»Ich brauch deine Hilfe. Kannst du ermitteln, wo sich die Mutter der Brakel gegenwärtig aufhält? Auch den Freund der Brakel müssten wir finden. Irgendetwas scheint da nicht mehr im Lot zu sein. Die Wohnung wurde seit Wochen nicht betreten, als ob alle aus dem Umfeld der Brakel spurlos verschwunden sind. Mir ist das suspekt.
Ich bin auch der Meinung, dass in der Wohnung ein Kind gelebt haben muss. Die Brakel kann aber nicht die Mutter sein. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass sie niemals schwanger war.«
Voßwinkel nickte nur, notierte eifrig die Daten aus den Akten.
»Tja, und wenn du das Umfeld vielleicht auch mal etwas beleuchten könntest. Wovon hat sie gelebt, mit wem hatte sie Umgang, na du weißt ja.
Ich glaube, da könnte ein Ansatz für weitere Ermittlungen liegen, die etwas erfolgsversprechender sein können als unser bisheriges Tun.
Nägelein drängt darauf, das Umfeld an der Oder im Auge zu behalten. Er hält fest an seiner Theorie mit Menschenschmuggel und Prostitution. Aber da ist meiner Meinung nach die Brakel nicht die passende Person.«
»Na mal schau’n, was wir da so rausbekommen.«
»Außerdem müssten die nächsten Angehörigen der Brakel benachrichtigt werden. Meines Erachtens sind das ihre vier Schwestern, allesamt in Süddeutschland lebend. Sie ist ja eigentlich eine Berlinerin, aber der ganze Vorgang liegt nun mal in unseren Händen.
Ich glaube, da bist du auch nicht so sehr betrübt darüber, wenn wir da weitermachen.« Linthdorf schaute Voßwinkel direkt an.
Der nickte erleichtert. Es gab genug unangenehme Dinge zu tun. Er blätterte etwas zerstreut in seinem Notizbuch herum, blickte schließlich hoch und fragte Linthdorf: »Haste noch Zeit für nen Kaffee?« Die Beiden trotteten einträchtig nebeneinander den langen Gang entlang Richtung Kantine.
Es war ein eigenartiges Bild, so dass sich viele nach ihnen umdrehten. Linthdorf war es gewöhnt, dass er für Aufsehen sorgte dank seiner körperlichen Präsenz, für Voßwinkel jedoch war der Zustand ungewohnt. »Mein Gott, ermitteln mit dir zusammen stelle ich mir auch lustig vor.«
Potsdam
Mittwoch, 1. Februar 2006
Am Mittwoch wartete in seinem Dienstzimmer bereits ein Stapel Faxe auf ihn. Es waren die Rückmeldungen zu den Anfragen über die psychedelischen Buchtitel, die er aus dem Antiquariat mitgenommen hatte. Alles wie er befürchtet hatte, weder literarisch wertvoll noch sonst wie brauchbar. Leere Floskeln mit Allerweltsweisheiten.
Es gab inzwischen auch ein paar brauchbare Fotos der entstellten Frau aus dem Eis. Damit ließ sich schon etwas mehr anfangen. Er stellte das Material zusammen zu einem Rundschreiben, welches an alle Polizeidienststellen in Brandenburg und Berlin gehen sollte.
Ebenfalls hatte er ein Amtshilfeersuchen an die Berliner Kripo verfasst. So hoffte er, etwas mehr über die letzten Tage der Toten herauszubekommen.
Die Ermittlungen in Berlin konnte er nicht einfach so fortführen. Immerhin war Berlin ja ein anderes Bundesland mit anderen Zuständigkeiten. Als Brandenburger LKA-Mitarbeiter hatte Linthdorf für Ermittlungen in der großen Nachbarstadt von Potsdam jedes Mal eine spezielle Genehmigung zu beantragen. Das war lästig, da oftmals die Wege der Verdächtigen dorthin führten.
Die scherten sich wenig um fiktive Verwaltungsgrenzen. Es gab diverse Vordrucke im LKA, die nur ausgefüllt zu werden brauchten. Aber irgendwie waren diese nervigen Bürokratiehemmnisse für ihn ein Grund zu grollen. Längst hätte man die Arbeit der beiden Landespolizeien zusammenlegen können.
Die Geschwister der Brakel hatte er inzwischen auch benachrichtigt. Diese Augenblicke waren besonders nervend. Irgendwie musste er sich jedes Mal zusammenreißen, wenn er den Angehörigen den unerwarteten und gewaltsamen Tod eines ihnen nahestehenden Menschen mitzuteilen hatte. Es gab auch keine Routine bei solchen Momenten, jedes Mal reagierten die Menschen anders auf die Nachricht.
Linthdorf wünschte sich für diese Gespräche eigentlich eine etwas bessere psychologische Schulung. Aber erstaunlicherweise wurde er mit solchen Begegnungen ziemlich allein gelassen. Mit ein paar seiner engeren Mitarbeiter hatte er sich schon des Öfteren darüber unterhalten, wie man es am besten den Angehörigen beibrachte. Voßwinkel war der Meinung, dass es immer am besten sei, nicht lange um den heißen Brei herum zu reden, sondern direkt und in klaren Sätzen zur Sache zu kommen. Das hatte er inzwischen auch als die gangbarste Methode akzeptiert.
Die Schwestern reagierten erstaunlich gefasst auf die Nachricht. Sie waren mehr daran interessiert, wo ihre Mutter abgeblieben war. Linthdorf glaubte aus den kurzen Telefongesprächen herauszuhören, dass die vier Schwestern zu ihrer in Berlin lebenden jüngsten Schwester ein eher angespanntes Verhältnis hatten. Er bat sie allesamt nach Berlin, um die Leiche zu identifizieren und sich um die Formalitäten zur Beerdigung zu kümmern. Bei der Gelegenheit wollte er sie auch noch einmal zum Vorleben ihrer Schwester befragen.
Auch das Ausbleiben der Mutter nahm immer mysteriösere Züge an. Linthdorf war inzwischen überzeugt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem gewaltsamen Tod in der Oder, dem Verschwinden der Mutter und des Lebenspartners der Brakel gab. Vielleicht könnten die Geschwister da etwas Licht hineinbringen.
Der Tag plätscherte mit wenig befriedigenden Arbeiten weiter dahin.
Am späten Nachmittag traf sich Linthdorf noch mit seinem Chef. Der wollte natürlich auch Ergebnisse sehen. Kriminaloberrat Dr. Nägelein war ein pedantischer Mensch, stets korrekt im grauen Anzug und dezenter Krawatte auftretend. Ein exakt gezogener Seitenscheitel verlieh ihm ein ausgesprochen strenges Aussehen, vergleichbar mit den UFA-Stars in den alten Schwarz-Weiß-Filmen aus den dreißiger Jahren. Ähnlich war auch seine Sprache.
So etwas von emotionslos schnarrend und hölzern, als ob er Dienstanweisungen auswendig gelernt hatte. Linthdorf versuchte sich Nägelein als Privatmenschen vorzustellen. Es gelang nicht. Er blieb ein Mann ohne Eigenschaften.
Draußen am Wannsee sollte er mit Familie eine nette Villa besitzen. Keiner der Mitarbeiter hatte jemals ein Familienmitglied zu Gesicht bekommen und auch um die Villa rankten sich inzwischen zahlreiche Gerüchte, da die Anschrift von Nägelein bewusst verheimlicht wurde. Das Treffen mit ihm fiel dementsprechend wieder sehr unterkühlt aus.
Es dauerte nur knapp zehn Minuten. Linthdorf konnte sich glücklich schätzen, dass er immerhin so viel Zeit für die »Audienz« bekam. Nägelein hob nur einmal kurz die linke Augenbraue, als Linthdorf ihm von dem Erfolg bei der Klärung der Identität berichtete. Diese Regung war als Lob aufzufassen.
Mit schleppender Stimme wies Nägelein noch mal darauf hin, bei den Ermittlungen in Berlin doch bitte die Dienstwege einzuhalten und nicht auf eigene Faust zu ermitteln, man lebe ja schließlich in einem zivilisierten Lande und nicht im rechtsfreien Raum.
Als rechtsfreien Raum titulierte Nägelein immer die alte DDR. Damals, als er seinen Dienst im neugeschaffenen Land Brandenburg antrat, rümpfte er über die heimischen Mitarbeiter nur die Nase und teilte ihnen bei seiner Antrittsrede mit, dass die Zustände in dem rechtsfreien Raum nun ein Ende haben sollten und dass sich doch alle, die hier noch weiterarbeiten wollten, sich entsprechend mit den Gesetzen der Bundesrepublik anfreunden sollten. Nach und nach dünnte er den alten Personalstamm aus, so dass nur noch ein kläglicher Rest ehemaliger Ostdeutscher übrigblieb.
Linthdorf war einer dieser letzten Mohikaner. Er hatte das ungute Gefühl, dass auch er zu den hier noch zu entfernenden Leuten gehörte. Allerdings konnte Nägelein auf ihn nur schwer verzichten. Das über viele Jahre aufgebaute Netzwerk von Verbindungen und die Ortskenntnisse Linthdorfs, der wahrscheinlich ganz Brandenburg als Landkarte im Kopf gespeichert hatte, machten ihn für die Arbeit unentbehrlich.
Linthdorf schaute etwas irritiert an Nägelein vorbei. Etwas Ungewöhnliches befand sich hier im Dienstzimmer. Eine große, glitzernde Narrenkappe war sorgfältig auf dem Regal aufgestellt.
Nägelein registrierte den Blick, räusperte sich: »Ja, man muss ja auch etwas für die Kultur tun. Ich bin Mitglied im Potsdamer Karnevalsverein, und wir haben am Rosenmontag unser große Festsitzung mit anschließender Feier.« Linthdorf stellte sich seinen Chef als Ausbund an Fröhlichkeit vor. Wieder ein Bild, das nicht passen wollte. Wenn alle Mitglieder des Karnevalsvereins solche Typen waren, dann konnte man sich ja auf wahre Spaßtiraden und ursprünglich deftigen Humor freuen.
Ihm war dieser verordnete Humor sowieso suspekt. Für ihn verbarg sich hinter diesem Hang zur Kostümierung und derben Vergnügungen nur ein psychisches Problem der Beteiligten. Endlich mal unerkannt Dinge sagen, die man sich sonst nicht zu sagen traute, und ohne die üblichen Verklemmungen Frauen anbaggern, die man sonst nur höflich grüßte.
Im Übrigen fand er auch, dass dieses laute Karnevalstreiben vielleicht ganz gut in den rheinischen Gefilden aufgehoben war und nicht unbedingt hierher ins nüchterne, preußisch geprägte Brandenburg exportiert werden sollte. Aber im Zuge der Hauptstadtverlegung von Bonn nach Berlin waren tausende rheinischer und schwäbischer Frohnaturen mit an die Spree gezogen, die natürlich auch ihre eigenartigen Bräuche mitbrachten. In Berlin gab es neuerdings sogar eine Karnevalsparade mit Prinzen und Funkenmariechen, die am Brandenburger Tor defilierten.
Für Linthdorf ein Gipfel der Geschmacklosigkeit, er floh vor all solchen neuen Großveranstaltungen.
Mit einem leicht ironischen Unterton verabschiedete er sich von Nägelein: »Na denn noch viel Spaß ...«, nickte dabei vielsagend Richtung Narrenkappe und stand geräuschvoll auf, baute sich in aller Seelenruhe zu seiner vollen Größe auf und ging, den Kopf einziehend, aus dem Dienstzimmer. Nägelein schaute ihm verdutzt nach, wusste nicht, ob das mit dem Spaß ernst gemeint war oder nicht.
Undines Tod
Eine Anzeige im »Havelkurier«

Großer Faschingsball im »Alten Fährhaus« Plaue:
Zu Samstag, den 4. Februar, laden wir zum diesjährigen Großen Faschingsball ein. Ab 18 Uhr erwartet Sie ein buntes Programm mit den Karnevalisten des Plauer FV, des KC Kirchmöser und den Brandenburger Havelnarren. Für musikalische Unterhaltung sorgen die »Swingenden Luchgeister« und die Blaskapelle Rathenow. Höhepunkt des Abends werden unsere große Nixenversteigerung und das mitternächtliche Feuerwerk an der Havel sein. Einlass nur in Kostüm!
Telefonische Voranmeldungen täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr unter 03381-3043498
Preis inkl. Abendessen (Buffet) und einer Flasche Wein Ihrer Wahl 39,- €
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Zauberspruch

Wassernixe, du musst sterben
In dem tiefen Wasserloch!
Wassernixe, bist getroffen?
Wassernixe, lebst du noch?
Im Norden von Berlin
Donnerstag, 2. Februar 2006
Ein kalter Wind pfiff durch die Vorstadtstraßen. Feiner Eisregen hatte eingesetzt. Die Frau versuchte vergeblich, sich gegen diesen Eisregen zu schützen. Die modische Baskenmütze hatte sie tief ins Gesicht gezogen und die pelzbesetzte Kapuze ihres Mantels mit einem Schal festgezogen.
Sie stand da am Straßenrand mit zwei Rollkoffern und schien auf jemanden zu warten. Immer wieder schaute sie zu der Kurve am Ende der Straße. Aber es tat sich nichts. Langsam ergriff sie eine Unruhe. Nervös blickte sie immer wieder auf ihre Armbanduhr. Die Zeit schien ihr davonzulaufen. Sie nestelte an ihrer Umhängetasche herum, förderte ein Lederetui zutage, das sie mühsam aufknöpfte.
Endlich hatte sie das Handy griffbereit. Mit zitternden Fingern tippte sie eine Nummernfolge ein, wartete, fluchte.
Ein Besetztzeichen ...
Wahlwiederholung ... wieder Besetzt!
Das Ganze wiederholte sich dreimal. Endlich hatte sie Glück. »Wo bleibt denn mein Taxi? Sollte schon längst hier sein? Hier ist aber niemand. Können Sie noch einmal den Fahrer anrufen, vielleicht hat er sich verfahren. Danke!«
Ärgerlich stampfte sie auf der Stelle. Die Kälte stieg langsam erst in die Füße und von dort die Beine hinauf. Bewegung! Sie musste sich bewegen!
Sonst würde sie vielleicht wieder krank, und das konnte sie im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Sie wusste, dies war ihre letzte Chance. Wenn sie dieses Projekt nicht erfolgreich abschließen würde, wäre sie weg vom Fenster. Zu viele Misserfolge hatten in den letzten Monaten ihr sonst so selbstsicheres Auftreten empfindlich gestört. Und dann war da noch dieser Zusammenbruch! Jedes Mal, wenn sie daran dachte, stieg ihr die Schamesröte ins Gesicht.
Sich eine solche Blöße zu geben, wäre ihr nie im Traum auch nur eingefallen.
Mein Gott! Sie war doch die Beste!
Alle wussten es ..., und dann so etwas.
Hart hatte sie für diese Position gekämpft. Hatte Wege beschritten, die teilweise an der Grenze der Legalität waren. Alles hatte sie diesem Erfolg untergeordnet. Manchmal fiel es ihr schwer, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Aber dann hatte sie sich wieder im Griff und alles lief nach Plan. Und jetzt sollte es wieder wie nach Plan weiterlaufen. Einen Durchhänger hatte jeder einmal. Sie hatte auch dies gemeistert. War wieder fit.
Ihr Handy klingelte. »Das kann doch nicht möglich sein! Dann schicken Sie Ersatz! Ich muss in zwei Stunden am Flughafen sein. Egal, wie!«
Unfall! Was für eine banale Ausrede.
Der hatte verpennt!
Sie hasste unfähige Leute. Überall begegneten sie ihr. Und jedes Mal schienen genau diese unfähigen Leute ihr ein Bein stellen zu wollen. Sie konnte noch so sehr ihre Projekte durchplanen, irgendeine Kleinigkeit schien sich immer wieder in eine mittlere Katastrophe auszuwachsen und das ganze Projekt dadurch zu gefährden.
In den letzten Monaten war es wie verhext. Dauernd kreuzte ein solch unfähiger Mensch ihre Pläne und ließ sie auflaufen.
Wieder sah sie auf ihre Uhr. Sieben Minuten waren inzwischen vergangen und von einem Taxi war nichts zu sehen. Verärgert griff sie die beiden Rollkoffer und marschierte Richtung Bushaltestelle. Sie kannte nicht genau die Abfahrtszeiten der beiden Buslinien, die hier hielten, wusste aber, dass jede Viertelstunde eine der beiden Linien hier anhielt. Mit dem Bus konnte sie Richtung S-Bahnhof fahren und dort gab es ja auch immer Taxen, die auf Kundschaft warteten.
Und wirklich, nur kurze Zeit später rollte ein mit bunter Werbung bedeckter Bus um die Ecke. Erleichtert stieg sie ein. Sie war die einzige Mitfahrerin. Beim Busfahrer löste sie ein Ticket, wuchtete ihre beiden Rollkoffer hinein und ließ sich erschöpft auf einen Sitzplatz nahe an der Tür fallen.
Sie spürte plötzlich ein Hungergefühl aufkommen. Sie hatte nur einen Kaffee getrunken, bevor sie das Haus verlassen hatte. Der Magen rebellierte ziemlich heftig. Auf der Zunge hatte sie einen unangenehm säuerlichen Geschmack.
In ihrer Manteltasche fand sie eine Rolle Pfefferminzdrops. Rettung für wenigstens fünf Minuten!
Endlich hatte der Bus den S-Bahnhof Pankow erreicht. Vor dem Bahnhofsgebäude war eine kleine Imbissbude bereits geöffnet. Die zehn Minuten hatte sie noch übrig.
Da sah sie ihn.
Ein Mann in einer schwarzen Lederjacke und mit einem dieser sonderbar unmodischen Basecaps bekleidet, stand ihr gegenüber an dem kleinen runden Stehtisch. Er hatte eine Tasse Kaffee vor sich stehen, von der er ab und zu nippte.
Er nickte ihr zu: »Na, auch verreisen? Nach Tegel?«
Sie kannte ihn. Er ging bei Wendelstein ein und aus. Und er war ein Widerling, ein echter Kotzbrocken. Sie nickte nur und biss herzhaft in ihre Currywurst.
»Ich muss auch rüber, jemanden abholen. Wenn du willst, kann ich dich mitnehmen.«
Sie traute ihren Ohren nicht so recht, als sie diese beiden Sätze vernahm.
Bei diesem Ekelpaket ins Auto steigen?
Niemals.
Lieber verpasste sie das Flugzeug.
Andererseits ..., sie wusste, dass sie sich keine weiteren Fehler mehr leisten konnte.
Und warum auch nicht? Etwas Glück konnte sie nun wirklich gebrauchen.
Dankbar lächelte sie.
»Dann müssen wir jetzt aber gleich los.«
Der Mann mit dem Basecap nickte, stellte den Kaffeebecher ab und trabte Richtung Parkplatz davon.
»Ich bin gleich da, du kannst in aller Ruhe aufessen.«
Er grinste dabei unverschämt, als ob er sie zu sich ins Bett holen wollte.
Sie nickte nur, trank einen großen Schluck Kaffee und putzte sich die Finger ab. Dann sah sie schon den schwarzen Geländewagen aus der Parklücke rangieren. Na ja, besser als ne Taxe und bequemer ist der auch noch! Sie kannte das Modell.
Wendelstein, ihr Chef, fuhr privat auch einen Cayenne. Froh über die glückliche Wendung lief sie mit ihren beiden Rollkoffern dem Wagen entgegen.
Als sie einstieg, bemerkte sie einen eigenartigen Geruch, der ihr irgendwoher bekannt vorkam.
»Wie riecht’s denn hier?«
Der Fahrer lachte nur kurz und fuhr mit zügigem Tempo vom Parkplatz. Es sollte Bettina Khorffs letzte Reise werden ...

Havelufer bei Plaue
Donnerstag, 2. Februar 2006
Als sie aufwachte, hatte sie einen schalen Geschmack auf der Zunge. Es roch nach billigem Fusel und nach etwas noch viel Unangenehmeren. Alles schien sich um sie zu drehen. Ihr war schlecht, eigentlich kotzübel. Außerdem fror sie. Die Zähne klapperten aufeinander. Direkt auf ihrer Haut spürte sie kalte Nässe.
Keine schützende Textilschicht schien zwischen ihrer Haut und dem Untergrund vorhanden zu sein. Sie war nackt. Außerdem konnte sie nichts sehen. Vor den Augen war ein Tuch fest um den Kopf gezurrt. Auch ihre Arme und Beine konnte sie nicht bewegen. Irgendetwas war ihr um die Arme und Beine gewickelt, etwas Klebriges, was es ihr unmöglich machte, sie zu bewegen. Sie wollte schreien, aber nur ein kraftloses Gurgeln drang aus dem tiefsten Innern ihrer Lunge.
Sie spürte eine Angst in sich aufkommen, die sie noch nie vorher auch nur ansatzweise erlebt hatte. Es war etwas Existentielles, eine Grundangst. Instinktiv hatte sie urplötzlich Angst um ihr Leben.
Wenn früher die Gespräche um den Tod gingen, blieb sie erstaunlich ruhig und gelassen. Selbst beim Tod ihrer Mutter hatte sie sich beherrscht. Sie redete sich stets ein, dass sie keine Angst vor dem Tode habe. Souverän meisterte sie das Leben.
Sie war klug, schön, fit ..., der Tod war etwas in sehr weiter Ferne. Und plötzlich war er ganz nah. Sie konnte seine Präsenz spüren. Ihre Sinne erfassten da etwas, was sich nur schwer eingrenzen ließ.
War es ein bestimmter Duft, der die Umgebung ausfüllte? Oder ein Schwingen unsichtbarer Energien, das von ihrem Zwerchfell erspürt wurde?
Sie glaubte ins Bodenlose zu stürzen, als diese Angst von ihr immer mehr Besitz nahm.
Um sie herum war es still. Die einzigen Geräusche, die an sie drangen, waren schwer zu identifizieren. Es konnte vielleicht das Plätschern von Wasser sein. Aber das konnte auch täuschen. Sie traute diesen Geräuschen nicht so richtig. Das letzte, woran sie sich klar erinnern konnte, war die Imbissbude vor dem S-Bahnhof, und dann war da noch dieser schwarze Geländewagen ...
Sie hörte Schritte. Ein ungewöhnliches, schmatzendes Geräusch war bei jedem Schritt zu vernehmen, als ob der Untergrund schlammig oder modderig war.
Jetzt konnte sie auch den merkwürdigen Geruch zuordnen. Es war dieser eigentümliche Geruch, den Flüsse und Seen verströmten. Eine Mischung aus Moder, Fisch und Verwesung. Speziell, wenn die Wetterlage umschlug, wurde ein solcher Geruch spürbar.
Sie war irgendwo an einem Wasser. In der Ferne war ein Zug zu hören. Es war das letzte Geräusch, das sie wahrnahm. Ein stechender Schmerz in der Bauchregion nahm ihr den Atem. Sie schnappte nach Luft. Wieder zuckte sie zusammen, ein weiterer Schmerz war hinzugekommen, diesmal in der rechten Seite. Sie versuchte, dem Schmerz auszuweichen, aber es ging nicht, Beine und Arme waren wie gelähmt. Sie wollte wenigstens schreien. Selbst das funktionierte nicht mehr.