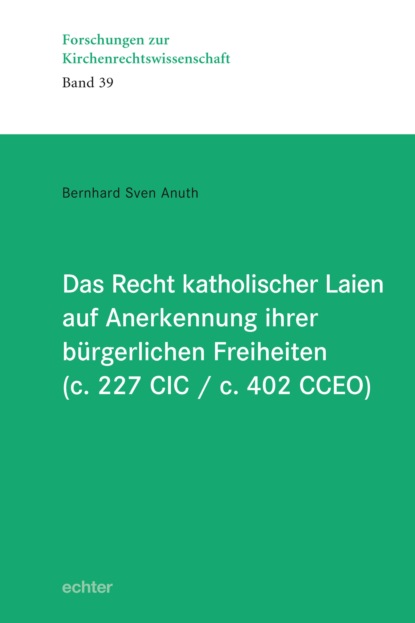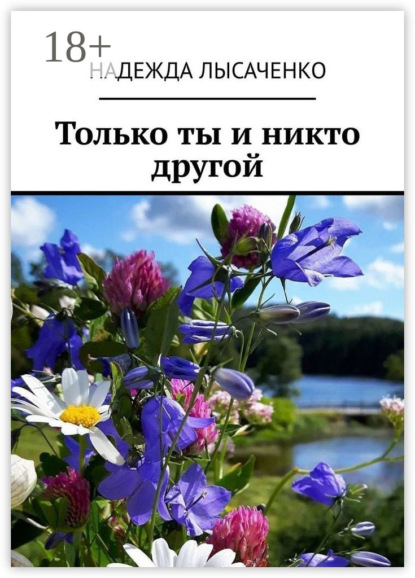Der Ausschluss des Gattenwohls als Ehenichtigkeitsgrund
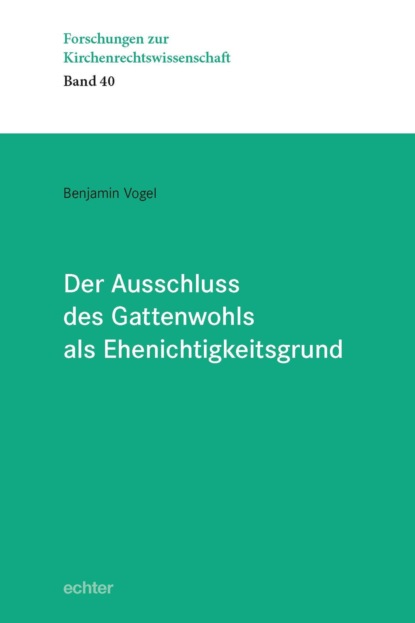
- -
- 100%
- +
85Vgl. Lüdecke: Eheschließung, 791f.
86Damit ist sicherlich nur ein Teil des konziliaren Neuansatzes in der Ehelehre aufgezeigt. Von grundlegender Bedeutung für das konziliare Eheverständnis sind zudem die Beschreibung der Ehe als Bund (anstelle einer rein vertragsrechtlichen Auffassung) sowie der konsequente Ausgang der Pastoralkonstitution von der konkreten menschlichen Person. Vgl. zur Entscheidung für die Bundeskategorie Lüdecke: Eheschließung, 804–820; vgl. zum personalen Ansatz Chenu: Aufgabe, 229–242; Lüdicke: Consent, 481–492 sowie unten Kapitel 6.3.
87Vgl. Koch: Lehrbuch, 602; Montagna: Bonum, 415–417.
88Vgl. Lüdecke: Eheschließung, 708–714.
89Schmitz: CIC, 25. Vgl. auch Lüdecke: Eheschließung, 713f.
90Vgl. Paul VI.: Ansprache v. 20.11.1965, 988: „Nunc admodum mutatis rerum condicionibus – cursus enim vitae celerius ferri videtur – ius canonicum, prudentia adhibita est recognoscendum: scilicet accommodari debet novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vaticani Secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur, et novis necessitatibus populi Dei.“ Für eine Zusammenschau der einzelnen Arbeitsphasen der Codexrevision allgemein und der beteiligten Personen vgl. Metz: Codification, 117–145; Schmitz: Reform, 9–88 sowie Schwendenwein: Weg, 120–125.184–206.
91Die Arbeitsgruppe bestand zu Beginn aus einem Berichterstatter und 14 Konsultoren; vgl. Communicationes 1 (1969), 34. Eine Übersicht der Zusammenkünfte findet sich in Communicationes 36 (2004), 212–215.
92Diese fanden vom 24.–29.10.1966 bzw. vom 03.–08.04.1967 statt; vgl. Communicationes 32 (2000), 175–227 bzw. 228–252.
93Conformatio meint im übertragenen Sinne eine Formung oder Gestaltung; vgl. Georges: Handwörterbuch, Bd. 1, 1459f.
94Vgl. Communicationes 32 (2000), 217–221. Nur einmal werden Casti connubii und GS 48 als Quellen angegeben, wahrscheinlich greifen auch die anderen Vorschläge für den Begriff der conformatio auf die Eheenzyklika Papst Pius’ XI. zurück. Wenige Tage vor dieser Beratung hatte der Sekretär der Revisionskommission, Ramón Bigador, auf diese Stelle aus der Eheenzyklika hingewiesen; vgl. ebd., 183.
95Vgl. ebd., 217: „Indole sua naturali hoc matrimonii institutum amorque coniugalis ad conformationem interiorem coniugum mutua sui ipsius donatione perficiendam atque ad procreationem et educationem prolis ordinatur […].“
96Ebd., 217.
97Vgl. ebd., 218: „Primaria matrimonii causa et ratio sunt mutua coniugum interior conformatio assiduumque sese invicem perficiendi studium in intima communitate vitae et amoris coniugalis.“
98Vgl. bspw. ebd., 177, ebenso eine Äußerung des ersten Konsultors: „Nunc, post Concilium, canon mutari debet; finis personalis matrimonii ne nimis fini biologico et procreativo subordinetur, tamen fines expressis verbis aequali gradu poni non debent; quaestio de hierarchia finium suspendatur, usquedum a theologis et a Magisterio clarificetur; uterque finis simpliciter affirmetur.“ (ebd., 181). Bemerkenswert ist die Aussage des Pro-Präses Pericle Felici: „Concilium, ubi clarum non sit, interpretandum est iuxta doctrinam traditionalem.“ (ebd., 230).
99Vgl. ebd., 182.
100Vgl. ebd., 219f. Nach Auffassung des Berichterstatters ist in Gaudium et spes ein Idealbild der Ehe entworfen, das die Kanonisten durch Angabe einer rechtlichen Untergrenze zu ergänzen hätten.
101Vgl. bspw. ebd., 182f.
102Vgl. ebd., 181, 183, 218, 221.
103Vgl. Communicationes 3 (1971), 70: „Eandem constitutionem [GS; B. V.] secutus, coetus in hac paragrapho notionem finis primarii, procreationis scilicet atque educationis prolis, et finis secundarii, nimirum mutui adiutorii et remedii concupiscentiae, iam adhibendam non esse censuit.“ Gleichwohl war in der Diskussion über die Entwürfe häufig die Rede von fines im Allgemeinen und den Primär- und Sekundärzwecken im Speziellen.
104„Rev.mus Secretarius: Prae oculis habendum est hodie communius non admitti subordinationem finium ut est in canone 1013; post Concilium canon nequit incipere verbis ‚ Finis primarius matrimonii est…‘.“ (Communicationes 32 (2000), 230).
105Vgl. ebd., 182: „Rev.mus quintus Consultor: Distinctio inter fines primarios et secundarios omitti non potest […].“ Vgl. auch ebd., 220.
106Ebd., 235.
107Vgl. ebd., 235.
108Vgl. ebd., 235.
109Vgl. ebd., 176.
110Vgl. ebd., 218.
111In der Arbeitsgruppe sprach sich eine Mehrheit für die Beibehaltung von „intima“ aus, obwohl angemerkt wurde, dass dadurch der „totius vitae coniunctio“ nichts hinzugefügt werde; vgl. Communicationes 9 (1977), 122f.
112Vgl. ebd., 123.
113Als Alternativen für coniunctio waren communio und consortium bzw. Ergänzungen wie permanens und arctissima im Gespräch; vgl. ebd., 123.
114„Circa verba «quae indole sua naturali ad prolis procreationem et educationem ordinatur» duae praecipuae quaestiones factae sunt, quod nempe sub his verbis latet indirecta affirmatio de hierarchia finium matrimonii et quod opportunum sit ut etiam alii fines matrimonii in canone recenseantur.“ (ebd., 123 (Übersetzung B. V.)).
115„Ad primam quaestionem respondet unus Consultor, qui dicit textum canonis non fuisse bene interpretatum a quibusdam organis consultationis, quae censuerunt in canone directe affirmari finem matrimonii esse procreationem. E contra mens Coetus fuit statuere in quo consistat matrimonium: matrimonium fundamentaliter est coniunctio vitae quae coniunctio ordinatur ad prolem; fines autem matrimonii includuntur in hac definitione, quia coniunctio ordinata ad prolem importat sive procreationem, sive mutuum adiutorium, sive remedium concupiscentiae etc., quin in canone directe vel indirecte aliquid dicatur de hierarchia finium.“ (ebd., 123). Da keine Anmerkungen und Ergänzungen der übrigen Mitglieder der Arbeitsgruppe zu diesen Aussagen bekannt sind, lässt sich an dieser Stelle keine Aussage treffen, ob hier eine Einzelmeinung oder die mens coetus ausgedrückt ist.
116Vgl. ebd., 123.
117Ebd., 123.
118Unmittelbar davor war ein Änderungsvorschlag hinsichtlich des vorangehenden Canons diskutiert worden, der eine Beschreibung des Ehebundes enthielt: „Ex institutione Christi ad sacramenti dignitatem evehitur ipse contractus matrimonialis inter baptizatos, foedus coniugale instaurans quo mysterium unitatis et foecundi amoris Christum inter et Ecclesiam significant et participant et spiritu Christi roborantur, ita ut sibi invicem in propria perfectione et sanctificatione atque in prolis susceptione et educatione adiutorio sint.“ (ebd., 121). Auch wenn hier kein direkter Zusammenhang zwischen der Vervollkommnung und Heiligung der Partner und dem bonum coniugum hergestellt wird, lässt sich ein Stück weit erahnen, was die Konsultoren mit dessen Aufnahme in den folgenden Canon ausdrücken wollten; vgl. Lavin: Approaches, 130.
119Vgl. Communicationes 9 (1977), 123: „Circa secundam quaestionem aliqui Consultores non sunt contrarii ut mentio fiat etiam de fine personali matrimonii, quare variae propositiones perpenduntur et tandem ex compositione duarum formularum propositarum a duobus Consultoribus trahitur haec nova formula, quae omnibus Consultoribus placet […].“
120Vgl. ebd., 212.
121C. 1008 Schema/1980. Vgl. auch Communicationes 10 (1978), 125f. Die Formulierung entspricht bis auf wenige Änderungen c. 1055 CIC/1983. Bei einer Vorstellung der Arbeit der Kommission 1980 fehlte das Adjektiv intima bereits; vgl. Communicationes 12 (1980), 227.
122Die anonymisierten Eingaben sind abgedruckt in Communicationes 14–16 (1982–1984). Der Text der Relatio mit Klarnamen wurde zudem als Relatio complectens veröffentlicht.
123Vgl. Konzil von Florenz: Bulle Exsultate Deo: Dekret für die Armenier, DH 1327.
124Vgl. Catechismus Romanus, pars II, cap. VIII.
125Vgl. Relatio complectens, 242 bzw. Communicationes 15 (1983), 219f.
126Vgl. cc. 1104–1107 CIC/1917 bzw. cc. 1060–1064 CIC/1917. Vermutlich zielt der Einwand darauf ab, dass bei einer geheimzuhaltenden ebenso wie bei einer konfessionsverschiedenen Ehe gewisse Bereiche des gemeinsamen Lebens ausgeschlossen sind. Dem wäre zu entgegnen, dass der Gesetzgeber diese besonderen und sehr unterschiedlichen Konstellationen im Codex berücksichtigt und damit die u. U. auftretenden Herausforderungen an das Eheleben als nicht so gravierend ansieht, dass bei Beachtung der rechtlichen Vorgaben keine gültige Ehe zustande kommen würde. Außerdem verwies Palazzini auf die Unvereinbarkeit der Formulierung mit einem Urteil der Rota. Dabei handelt es sich um eine Sententia coram Wynen v. 22.01.1944, die auf Wunsch Papst Pius’ XII. in den AAS veröffentlicht wurde und die Ehezwecke und ihr Verhältnis ausführlich behandelt; vgl. Relatio complectens, 242f. bzw. Communicationes 15 (1983), 220. Aus den veröffentlichten Unterlagen zur Codexrevision wird allerdings nicht klar, worauf sich der Relator konkret bezieht. In den nn. 20–24 referierte der Ponens die damalige Rechtslage, nach der das ausschlaggebende Vertragsobjekt das ius in corpus ist und einem Ausschluss der Sekundärzwecke keine rechtliche Relevanz zukommt. Womöglich wird auf die Aussage in n. 21 des Urteils abgezielt, dass nämlich ein totius vitae consortium auch zwischen Bruder und Schwester möglich sei und es sich daher um keine spezifisch eheliche Gemeinschaftsform handle. Da der Gesetzgeber die Ehe in c. 1055 § 1 als totius vitae consortium beschreibt und angesichts der beiden ehewesentlichen Hinordnungen die sexuelle Dimension miteinschließt, ist eine Verwechslung nicht zu befürchten.
127„[F]inis rei creatae est semper extra essentiam rei. Nunc vero bonum coniugum non est res extra matrimonium, sed pertinet ad eius essentiam tanquam mutuum complementum […] principaliter in plano sexuali physico et psychico. Praesentari ergo nequit uti finis matrimonii. Esset finis operantis sed non operis.“ (Relatio complectens, 243 bzw. Communicationes 15 (1983), 220 (Übersetzung B. V.)).
128„Est philosophice absurdum ad aliquod ens assignare plus quam unum finem essentialem et principalem.“ (Communicationes 15 (1983), 220 (Übersetzung B. V.)).
129Vgl. ebd., 220. Zur Unterscheidung von finis operis bzw. finis operantis vgl. oben Kapitel 4.2.4 sowie Lüdicke: Ehezwecke, 42: „Der finis operantis ist die Zielsetzung, die jemand mit seinem Handeln verbindet, das, was er damit erreichen will. Der finis operis ist hingegen das, was den Akt selbst wesentlich bestimmt, was als Zweck zu seiner Definition gehört. Wird dieser Zweck abgesondert, ausgeschlossen, wird das Wesen selbst verletzt.“.
130Vgl. Relatio complectens, 243 bzw. Communicationes 1 (1983), 221.
131„Ordinatio enim matrimonii ad bonum coniugum est revera elementum essentiale foederis matrimonialis, minime vero finis subiectivus nupturientis.“ (Relatio complectens, 244 bzw. Communicationes 15 (1983), 221 (Übersetzung B. V.)). Da Palazzini für seine Kritik zwar mehrfach auf Thomas von Aquin verwies, die Stellen aber nicht miteinander in Bezug setzte oder eine „philosophische Standortbestimmung“ vornahm, fällt eine Auseinandersetzung schwer. So ist es fraglich, ob sich die Ehe nicht auch bereits innerhalb des mittelalterlichen Ordo-Denkens in mehr als einem Ordo und somit mit mehreren „Primär“-Zwecken denken lässt. Dass eine Auseinandersetzung mit den Argumenten innerhalb der Relatio ausblieb, kann darauf hindeuten, dass man sich des begrenzten Nutzens einer philosophischen Diskussion auf dieser Grundlage bewusst war. Zur Unzulänglichkeit einer scholastischen Antwort auf die heutige Frage nach dem „Warum“ der Ehe vgl. Kahler: Ausschluss, 302f.
132Vgl. Relatio complectens, 244 bzw. Communicationes 15 (1983), 221.
133„Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.“ (Digesten lib. 23, 2, 1).
134Vgl. Relatio complectens, 244 bzw. Communicationes 15 (1983), 222.
135Vgl. Relatio complectens, 244f. bzw. Communicationes 15 (1983), 222.
136Vgl. c. 1055 § 1 SchemaNov.
3. DAS BONUM CONIUGUM IM CIC/1983
Nach der Darstellung der Textgeschichte soll im Folgenden untersucht werden, wie der Begriff des bonum coniugum im geltenden Recht verwendet wird und wie er formal zu bestimmen ist.
3.1 Die Hinordnung auf das bonum coniugum in c. 1055 § 1
Der Begriff des bonum coniugum kommt im geltenden Recht ausschließlich in c. 1055 § 1 vor.137 Die Ehe wird hier als ein Bund beschrieben, durch den Mann und Frau eine Gemeinschaft gründen, die ihr ganzes zukünftiges Leben umfasst und betrifft. Dieses totius vitae consortium138 als Wirkung des ehelichen Bundes bleibt nicht unbestimmt, sondern wird durch die anschließende Partizipialkonstruktion mit indole spezifiziert. Es handelt sich um eine Gemeinschaft, die „durch ihre natürliche Eigenart“ zum einen auf das bonum coniugum, zum anderen auf die Zeugung und die Erziehung von Nachkommen hingeordnet ist.139 Das Partizip ordinatus ist von ordinare140 abgeleitet, das in seinen verschiedenen Konjugationsformen zusammen mit ad mehrfach im Gesetzestext vorkommt.141 Stets wird damit die Ordnung oder Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel hin ausgedrückt.142 Die Ehe ist demnach auf Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft sowie auf das bonum coniugum ausgerichtet.
Der Begriff bonum hat ein breites Bedeutungsspektrum: Er kann erstens einen guten Zustand beschreiben oder ein moralisches, physisches und psychisches Gut, Glück sowie eine Tugend bezeichnen, zweitens einen Vorteil oder einen Nutzen und schließlich drittens ein materielles Gut im Sinne von Vermögen.143 Eine Hinordnung der Ehe auf materielles Vermögen hat keinen Rückhalt in der kirchlichen Ehelehre, daher scheidet diese Bedeutungsebene aus. Dass die Ehe auf einen Nutzen oder Vorteil der Eheleute ausgerichtet sein soll, lässt nach einem Bezugspunkt fragen: Einen Nutzen was oder wem gegenüber hätte die Ehe und in welcher Hinsicht sollte dieser bestehen? Auch diese Bedeutungsebene scheidet aus. Übrig bleibt die erstgenannte Bedeutung, die sich zudem als schlüssig und sinnvoll erweist: Es geht um einen guten Zustand, um ein Wohlbefinden bzw. Wohlergehen. Dieser Befund wird von den kodikarischen Parallelstellen für bonum bestärkt.144 Auch hier bezeichnet bonum, abgesehen vom vermögensrechtlichen Kontext, in den meisten Fällen das Wohl einer oder mehrerer Personen.145
Die Personengruppe auf deren Wohl die Ehe hingeordnet ist, wird durch das Attribut coniugum angegeben: Es geht um das Paar aus Mann und Frau, die eine Ehe konstituieren wollen und fortan als Ehegatten leben. Das Wort coniux spielt auf die Verbindung der Partner untereinander an und bedeutet klassisch überwiegend „Gatte“ bzw. „Gattin“.146 Coniux/coniuges wird kodikarisch einheitlich in diesem Sinne verwendet.147 Eine nähere inhaltliche Bestimmung dieses Wohls oder Wohlergehens der Eheleute wird in c. 1055 § 1 nicht vorgenommen. Das bonum coniugum wird nicht auf einzelne Bereiche beschränkt, bspw. auf das physische oder das geistliche Wohl. Ausgehend vom Wortlaut der Norm ist das Wohlergehen der Partner in einem umfassenden Sinn gemeint. Eine weitergehende inhaltliche Bestimmung ist auf der Basis des Gesetzestextes nicht möglich; die Frage danach muss vorerst offen bleiben und ist auf der Grundlage des noch zu erhebenden Befundes aus Rechtspraxis und Doktrin weiter zu verfolgen.148
Der Gesetzgeber normiert in c. 1055 § 1, dass die Ehe nicht allein auf das Wohl der Ehegatten hingeordnet ist, sondern auch auf die Zeugung und die Erziehung von Nachkommen. Beide Hinordnungen werden mit der kopulativen Konjunktion atque verbunden, die eine Gleichstellung ausdrückt.149 Von daher besteht nicht eine Rangfolge zwischen der Hinordnung auf das bonum coniugum bzw. der Hinordnung auf Elternschaft, sondern es handelt sich um zwei gleichrangige Dimensionen. Diese Gleichrangigkeit wird jedoch verschiedentlich bestritten, indem – zutreffend – darauf hingewiesen wird, dass im Codex unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der beiden Hinordnungen getroffen werden: So können Partner, bei denen eine Zeugungsunfähigkeit vorliegt, eine gültige Ehe schließen, obwohl sie die Hinordnung auf Elternschaft physisch nicht verwirklichen werden können.150 Zulässig ist auch der Verzicht auf Kinder im Sinne der sog. Verantworteten Elternschaft.151 Vergleichbare Bestimmungen für das Gattenwohl bestehen hingegen nicht.152 Dass eine gültige Ehe mit der Unfähigkeit zur Verwirklichung des Gattenwohls oder mit einem vorehelich erklärten Verzicht auf seine Realisierung vereinbar sei, wird in der Doktrin nicht vorgetragen. Bruno Primetshofer zieht hieraus den Schluss, dem bonum coniugum komme „der Primat im System des kanonischen Eherechts zu.“153 Klaus Lüdicke folgert, zwar gehöre die Hinordnung auf das Gattenwohl konstitutiv zum Ehebegriff, nicht aber die Hinordnung auf Elternschaft.154 Während der erste Teil dieser Aussage in der Literatur nicht auf Widerspruch stößt, wird Lüdickes Auffassung zur Bedeutung der Elternschaft kritisiert.155 Der Gesetzgeber lege nämlich zwar keine unbedingte Pflicht zur Zeugung fest, dass er damit dem Gattenwohl einen höheren Rang vor der Elternschaft einräume oder die Elternschaft aus dem Wesensbereich der Ehe herausnehme, sei allerdings nicht ersichtlich.156 In der Tat stehen beide Hinordnungen der Ehe in c. 1055 § 1 gleichgeordnet nebeneinander – eine bewusste Entscheidung der Revisoren des CIC, die auf diese Weise die Ehelehre von Gaudium et spes mit Bedacht übernommen haben, um die Rangfolge der ehelichen Sinngehalte zu überwinden.157
3.2 Formale Bestimmung des bonum coniugum
Das bonum coniugum ist ein neuer Begriff im kanonischen Eherecht. Zu seiner formalen Bestimmung werden verschiedene Konzepte und Kategorien herangezogen.
Ein Ansatz greift auf die Ehelehre des Augustinus zurück. Sie hat bis heute Einfluss darauf, wie kirchliches Lehramt und Kanonistik die Ehe und ihr Wesen beschreiben.158 Augustinus entwickelte seine Position in Auseinandersetzung mit dem Manichäismus.159 Diese das Leibliche und damit auch die Sexualität verdammende Weltanschauung bedeutete eine Infragestellung der jüdisch-christlichen Tradition, nach der die Ehe als von Gott gestiftet und damit als gut gilt.160 Zur Rechtfertigung der Ehe setzte Augustinus dem Manichäismus drei Güter (bona) entgegen, welche die Ehe auch nach dem Sündenfall als solche gut machen: Die Ehe ist gut, weil es gut ist, Nachkommen zu zeugen und zu erziehen (bonum prolis), weil es gut ist, dass sich die Ehepartner ein Leben lang treu sind (bonum fidei) und sich durch die Ehe untrennbar gebunden wissen (bonum sacramenti).161
Versteht man den prokreativen Sinngehalt der Ehe als bonum prolis, könnte es (wenigstens begrifflich) naheliegend erscheinen, das bonum coniugum als partnerschaftlichen Sinngehalt analog zu den drei augustinischen bona matrimonii zu bestimmen. In diesem Sinne erweitern einzelne Autoren augustinische Güter-Trias um ein viertes bonum, das bonum coniugum.162 Dabei wird nicht berücksichtigt, dass die augustinischen Ehegüter weder Aufnahme in den Codex von 1917 noch in den von 1983 gefunden haben. Sie können daher nur sehr eingeschränkt zur Bestimmung des Wesens der Ehe aus rechtlicher Perspektive dienen.163 Bedeutsamer ist allerdings ein sachlicher Aspekt: Die Gatten sind nicht – wie die übrigen bona – ein Qualitätsmerkmal der Ehe, also etwas, das die Ehe gut macht oder ihr einen Wert verleiht.164 Die Eheleute sind nicht Objekte zur Rechtfertigung der Ehe, sondern die Subjekte, die miteinander diesen Lebensbund begründen und eingehen. Eine Bestimmung des bonum coniugum als Ehegut analog zu den augustinischen bona matrimonii ist daher weder in der Sache angemessen, noch kann sie sich auf den Gesetzestext berufen; sie ist daher abzulehnen.
Ein weiterer Versuch, das bonum coniugum formal zu bestimmen, setzt bei der Kategorie der Ehezwecke aus dem CIC/1917 an. Dort wurden Zeugung und Erziehung von Nachkommen als Primärzweck (finis primarius) der Ehe bestimmt, sekundär diente die Ehe zur gegenseitigen Hilfeleistung der Partner sowie zur Heilung der Begierlichkeit.165 Der CIC/1983 hat den Begriff der Ehezwecke nicht übernommen, in Kanonistik und Judikatur wird jedoch auch nach Inkrafttreten des neuen Codex damit operiert. Gattenwohl und Elternschaft werden als neue Ehezwecke identifiziert.166 Beide Sachbereiche lassen sich im neuen Codex jedoch nicht länger mit dieser Kategorie erfassen: Das geltende Recht beinhaltet die Zwecklehre des CIC/1917 nicht mehr, sie wurde „völlig aufgehoben“167. Die Ehe ist angesichts der in Gaudium et spes vorgelegten Lehre nicht mehr als „Mittel zum Zweck“, also zur Zeugung von Nachkommen und zu einer bestimmten Form von Unterstützung der Eheleute, anzusehen. Das Wohl der Gatten und die Zeugung und Erziehung von Nachkommen gehören vielmehr als „Finalität in die Relation von Wille und Ziel“168, sind kein von den Partnern losgelöstes Gegenüber, dem diese bloß zustimmen und in das sie durch die Eheschließung eintreten, „sondern die Hinordnung gründet innerlich in der Eigenart der Ehe als umfassender Lebensgemeinschaft.“169 Das ordinatum ad drückt ein Ausgerichtet-Sein, eine Zielrichtung aus. Bonum coniugum und Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft können daher als Ziele der Ehe aufgefasst werden. „Zweck“ und „Ziel“ wurden im älteren deutschen Sprachgebrauch häufig synonym verwendet,170 in jüngerer Zeit wird mit „Ziel“ im Unterschied zum Zweckbegriff eine „innere Wesens- und Sinnbestimmung“171 ausgedrückt. Die Rede vom „Zweck“ hingegen suggeriert das Vorhandensein bestimmter Mittel zu dessen Erfüllung. Auch deshalb erscheint der Zielbegriff im Zusammenhang mit Gattenwohl und Elternschaft angemessener als das Zweck-Konzept. In der deutschsprachigen Kanonistik findet eine weitergehende terminologische Differenzierung statt, indem nicht einfachhin von Zielen der Ehe die Rede ist, sondern bonum coniugum und procreatio et educatio prolis aus c. 1055 § 1 als Sinnziele,172 Wesenssektoren173 oder Wesensziele174 bezeichnet werden. In der vorliegenden Arbeit wird der Terminus Sinnziel verwendet, weil er einerseits die sprachliche Abhebung vom Zweckbegriff ermöglicht und im Gegensatz zu bspw. Wesenssektor andererseits die in c. 1055 § 1 ausgedrückte Zielperspektive zum Ausdruck bringt. Es besteht ein Grundzusammenhang zwischen der Ehe und ihren Sinnzielen Gattenwohl und Elternschaft, sie stellen die beiden Dimensionen dar, auf welche die Ehe als umfassende Lebensgemeinschaft hingeordnet ist.
3.3 Bonum coniugum und Ehenichtigkeit
Um zu erklären, inwiefern das bonum coniugum bzw. die ordinatio ad bonum coniugum für die Ehegültigkeit relevant sind, zieht die Kanonistik c. 1101 § 2 heran.175 Die Norm beschreibt mehrere Formen von volitiven Konsensmängeln, die dann vorliegen, wenn einer oder beide Nupturienten durch einen Ausschluss den Ehewillen so verändern, dass keine gültige Ehe zustande kommt. Der Gesetzgeber unterscheidet dabei zwischen dem Ausschluss der Ehe selbst, dem Ausschluss einer Wesenseigenschaft und dem Ausschluss eines Wesenselements der Ehe und nennt damit drei mögliche Anknüpfungspunkte für eine formale Bestimmung des bonum coniugum.
Nach Ansicht mancher ist bonum coniugum ein Synonym für die Ehe.176 Dabei wird jedoch die Aussagestruktur des c. 1055 § 1 übersehen: Die Ehe ist hingeordnet auf zwei gleichrangige, aber voneinander unterschiedene und unterscheidbare Sinnziele, von denen eines das bonum coniugum ist. Wären bonum coniugum und Ehe synonyme Begriffe, ergäbe sich nach c. 1055 § 1, dass die Ehe hingeordnet wäre auf die Ehe selbst – womit die Aussage tautologisch würde. Vielmehr bezeichnen Gattenwohl und Elternschaft zwei Ausrichtungen der ehelichen Lebensgemeinschaft, nämlich die partnerschaftliche und die prokreative. Keines dieser beiden Sinnziele kann folglich mit der Ehe selbst identisch sein.