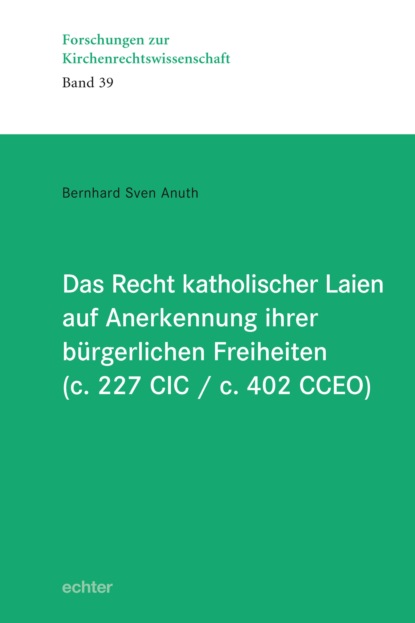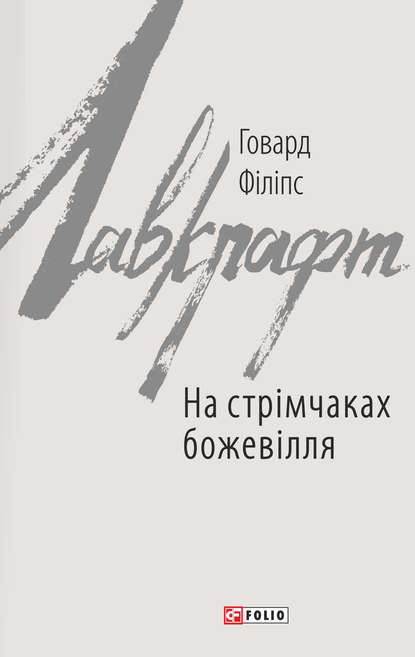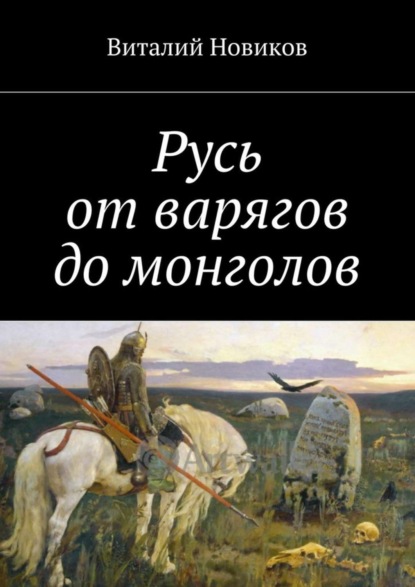Der Ausschluss des Gattenwohls als Ehenichtigkeitsgrund
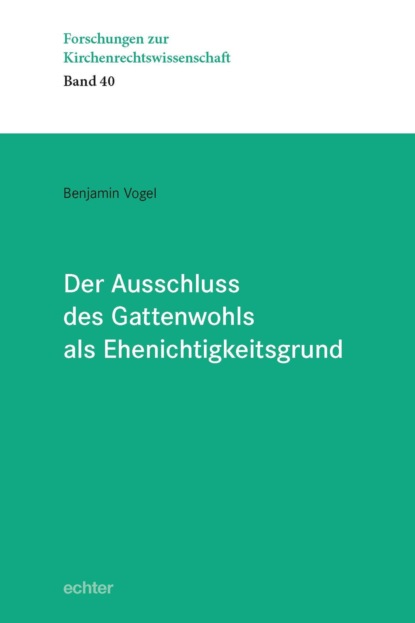
- -
- 100%
- +
Das bonum coniugum ist auch nicht eine Wesenseigenschaft der Ehe.177 Dagegen spricht der Umstand, dass c. 1056 nur Einheit und Unauflöslichkeit als Wesenseigenschaften der Ehe nennt und für weitere Wesenseigenschaften keinen Raum lässt.178 Auch begrifflich entspricht das Gattenwohl nicht einer essentialis matrimonii proprietas. Denn die Frage: „Wie ist die Ehe?“ lässt sich mit „Wohl der Gatten“ nicht beantworten.179
Diesem Einwand entgeht Pierro A. Bonnet, indem er nicht das bonum coniugum, sondern die Hinordnung darauf (ordinatio ad bonum coniugum) als eine von insgesamt vier Wesenseigenschaften der Ehe qualifiziert.180 Er erkennt zutreffend, dass Gattenwohl und Elternschaft als Ziele der Ehe nicht identisch mit ihrem Wesen sind, sondern außerhalb desselben liegen und dennoch in einer engen Beziehung zum Wesen stehen. Um diesen Zielen angemessen zu sein, müsse das Wesen der Ehe allerdings so beschaffen sein, dass die Ziele auch verwirklicht werden können. Das werde durch die Wesenseigenschaften erreicht: Sie seien notwendig mit dem Wesen verbunden, gehen aus diesem hervor und beschreiben dessen erforderliche Beschaffenheit.181 Damit das Ziel bonum coniugum erreicht werden könne, müsse das Wesen der Ehe über die Eigenschaft ordinatum ad bonum coniugum verfügen.182
Bonnets Ansatz hat gegenüber der o. g. Position, das bonum coniugum als Wesenseigenschaft zu bestimmen, den Vorteil, dass „Hingeordnet auf das Wohl der Gatten.“ durchaus eine passende Antwort auf die Frage „Wie ist die Ehe?“ darstellt. Gleichwohl hat auch dieser Ansatz keinen Rückhalt im Gesetzestext, wo ausschließlich unitas et indissolubilitas als Wesenseigenschaften normiert sind.183 Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass es sich bei unitas und indissolubilitas um absolute Begriffe handelt, die nicht zur Disposition stehen. Eine Ehe kann z. B. nicht nur in Teilen unauflöslichlich sein. Gattenwohl und Elternschaft hingegen stecken einen Rahmen ab, der von den Partnern unterschiedlich mit Leben gefüllt werden kann.184 Sowohl rechtssystematisch als auch rechtspraktisch ist eine eindeutige Klassifizierung und Terminologie vorzuziehen. Vor diesem Hintergrund vermag die Redeweise von der ordinatio ad bonum coniugum als einer Wesenseigenschaft nicht zu überzeugen.185
Es bleibt als Anknüpfungspunkt, den c. 1101 § 2 bietet, die Kategorie des Wesenselementes (elementum essentiale). Elementum bezeichnet einen Grund- oder Urstoff.186 Im Codex wird der Terminus jedoch eher im Sinne von „einzelner Bestandteil“ verwendet, was auch in c. 1101 § 2 als sinngemäße Übersetzung erscheint.187 Doch geht es in c. 1101 § 2 nicht um jedweden Bestandteil der Ehe, sondern um diejenigen, die als essentiale, als ihr Wesen ausmachend,188 beschrieben werden. Welche Elemente der Gesetzgeber als ehewesentlich betrachtet, lässt sich dem Wortlaut der Norm allerdings nicht entnehmen; ebenso wenig gibt es Parallelstellen im Codex für matrimonii essentiale elementum.189
Zur Frage, ob das bonum coniugum als ein solches Wesenselement der Ehe gelten kann, ist die Textgeschichte des Canons aufschlussreich.190 Während der Codexrevision wurde erwogen, auch das Recht auf die Gemeinschaft des Lebens (ius ad vitae communionem) als möglichen Gegenstand eines Ausschlusses zu berücksichtigen.191 Dabei war durchaus die Schwierigkeit vor Augen, dieses ius ad vitae communionem so zu beschreiben, dass es justiziabel wäre.192 In der Konsultationsphase wurde daher einerseits die Streichung, andererseits eine genauere Definition dieses Rechts gefordert. In den Beratungen zu den Eingaben hielt die Studiengruppe an der personalen Dimension fest, unklar blieb jedoch deren formale Einordung.193 Der Vorschlag, die drei augustinischen bona im Canon zu nennen, damit die Rechtsprechung die weitere Zuordnung vornehmen könnte, wurde jedoch abgelehnt.194 Zustimmung fand der Vorschlag, das ius ad vitae communionem in ius ad ea quae vitae communionem essentialiter constituunt zu verändern.195 Allerdings wurde später auch diese Formulierung als problematisch angesehen und zum besseren Verständnis schließlich durch matrimonii essentiale aliquod elementum196 ersetzt mit dem Auftrag an Doktrin und Rechtsprechung, diese Elemente zu konkretisieren. Neben der Berücksichtigung der theologischen und kanonistischen Tradition wäre dabei ausdrücklich der spätere c. 1055 § 1 zu berücksichtigen.197
Zahlreiche Autoren bestimmen daher die Hinordnung auf das Gattenwohl als ein Wesenselement der Ehe.198 Diese Klassifizierung nimmt den in c. 1055 § 1 formulierten Zielcharakter des bonum coniugum ernst und stellt den Zusammenhang her zwischen diesem Sinnziel und dem Wesen der Ehe bzw. ihren in c. 1101 § 2 benannten Wesensbestandteilen: Es gehört zum Wesen der Ehe, auf das bonum coniugum hingeordnet zu sein. Sie entspricht ferner dem textgeschichtlichen Befund. Als Antwort auf grundsätzliche Anfragen bezüglich des bonum coniugum vor der Plenaria 1981 wurde ausdrücklich festgehalten: „Locutio ‚ad bonum coniugum‘ manere debet. Ordinatio enim matrimonii ad bonum coniugum est revera elementum essentiale foederis matrimonialis, minime vero finis subiectivus nupturientis.“199
Oftmals wird das bonum coniugum selbst als Wesenselement qualifiziert.200 Gegen diese Auffassung wird jedoch zum einen angeführt, das bonum conigum als ein Ziel der Ehe könne nicht Teil ihres Wesens sein: Es gelte der scholastische Grundsatz, dass der finis einer Sache stets außerhalb ihrer essentia liegen müsse.201 Eine Sache könne nicht auf etwas hinsteuern, das bereits wesentlich in ihr enthalten sei. Da das bonum coniugum in c. 1055 § 1 vom Gesetzgeber als ein Sinnziel des Ehebundes vorgestellt wird, könne es sich daher nicht gleichzeitig um ein Wesenselement handeln.202
Zum anderen wird geltend gemacht, das Wohl der Partner könne kein Wesenselement sein, weil sonst jeder Ehe, in der ein gewisses Maß an Gattenwohl nicht erreicht wird, etwas Wesentliches fehlen würde. Eine ähnliche Unterscheidung wird bereits seit der Scholastik im Hinblick auf das andere Sinnziel, die Elternschaft, getroffen: So wird differenziert zwischen den Kindern, die tatsächlich aus einer Ehe hervorgehen (bonum prolis in seipsum), und der grundsätzlichen Ausrichtung der Ehe auf Nachkommenschaft (bonum prolis in suis principiis). „Nach dem allgemeinen Grundsatz, daß das Sein einer Sache nie von deren tatsächlichem Gebrauch abhänge, sei auch die rechtliche Existenz der Ehe weder von ihrem tatsächlichen Vollzug noch von der tatsächlichen Existenz von Kindern abhängig.“203 Demnach ist es für das Wesen der Ehe unerheblich, ob aus ihr tatsächlich Kinder hervorgehen oder nicht, wobei die Ausrichtung der Ehe auf Nachkommenschaft zu ihrem Wesen gehört und mithin nicht fehlen darf. Auf das Gattenwohl übertragen kann gefolgert werden: Nicht die tatsächliche Realisierung des bonum coniugum ist Teil des Wesens der Ehe, sondern die Ausrichtung, die Hinordnung auf das bonum coniugum.204 Entsprechend stellt nicht das bonum coniugum ein Wesenselement der Ehe dar, sondern die ordinatio ad bonum coniugum.
Formal und terminologisch lässt sich zwischen dem bonum coniugum als einem Sinnziel der Ehe und der ordinatio ad bonum coniugum als einem Wesenselement der Ehe unterscheiden. Psychologisch besteht für den einzelnen Nupturienten kein Unterschied zwischen der Ablehnung des Wohlergehens des Partners und der Ablehnung einer Gemeinschaft, die auf das Wohlergehen des anderen hingeordnet ist.205 Wer das Wohl des Partners ausschließt, lehnt auch ab, dass die Lebensgemeinschaft dem Wohlergehen des anderen dienlich ist. Insoweit ist nicht zu beanstanden, dass Doktrin und Judikatur die beiden Formulierungen nicht selten synonym verwenden. Wo nachfolgend vom „Ausschluss des bonum coniugum“ die Rede ist, handelt es sich dabei meist um eine verkürzte Redeweise, die für den Gesamtkomplex „Ausschluss der Hinordnung auf das bonum coniugum“ stehen soll.
137Die entsprechende Norm im Codex der katholischen Ostkirchen, c. 776 § 1 CCEO, unterscheidet sich zwar in einzelnen Formulierungen, ist aber in Bezug auf das Gattenwohl mit c. 1055 § 1 identisch: „Matrimoniale foedus a Creatore conditum eiusque legibus instructum, quo vir et mulier irrevocabili consensu personali totius vitae consortium inter se constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum ac ad filiorum generationem et educationem ordinatur.“
138Consortium ist abgeleitet von consors, einer Person, die „des gleichen Loses (Anteils) teilhaftig“ ist, und bedeutet allgemein Teilhaberschaft oder Gemeinschaft (Georges: Handwörterbuch, Bd. 1, 1542). Der Begriff kann klassisch eine Vielzahl unterschiedlicher Gemeinschaftsformen beschreiben: eine societas bonorum, eine societas vitae, eine societas fortunae sowie eine immerwährende Gemeinschaft (vgl. Huber: Coniunctio, 403–406). Josef Huber zeichnet die Bedeutung der während des Revisionsprozesses verwendeten Begriffe coniunctio, communio und consortium im klassischen Latein nach und zeigt, dass consortium aufgrund seiner Bedeutungsvielfalt zur Beschreibung der Ehe besonders angemessen ist; vgl. ebd., 397– 406. Consortium begegnet im CIC ausschließlich in den cc. 1055 § 1, 1096 § 1, 1098 und 1135. Es ist mithin „ein rein eherechtlicher Fachterminus“ (Lüdecke: Ausschluß, 139).
139Indoles begegnet in seinen diversen Deklinationsformen 29-mal im Codex (cc. 113 § 2, 244, 259 § 2, 315, 366, 394 § 1, 403 § 2, 407 § 2, 578, 588 § 3, 598 § 1, 607 § 3, 611, n. 1, 633 § 2, 642, 652 § 2, 659 § 2, 667 §§ 1 u. 3, 680, 708, 722 § 2, 735 § 3, 776, 779, 819, 1055 § 1, 1243, 1702), stets im Sinne einer von außen oder innen vorgegebenen Art bzw. Eigenart. In 13 Fällen kommt finis im direkten Umfeld vor, folglich wohnt indoles in c. 1055 § 1 auf der Ebene der Wortbedeutung keine Finalität inne. Es handelt sich um eine weiter zu bestimmende Beschaffenheit der Ehe. Eine direkte Verknüpfung mit natura bzw. naturalis gibt es außerhalb von c. 1055 § 1 nicht, wobei indoles klassisch mit der Konnotation natürlich oder angeboren verwendet wird; vgl. Georges: Handwörterbuch, Bd. 2, 204. Die Zweitbedeutung Nachwuchs, Jugend (vgl. ebd., 205) kommt in c. 1055 nicht in Betracht, wird die Hinordnung auf Nachkommenschaft doch im Anschluss normiert.
140Die Bedeutungen von ordinare sind vielfältig, z. B. etwas in eine bestimmte Reihe, Reihung bzw. Ordnung bringen, regeln, einrichten, abfassen, verordnen; vgl. ebd., 1393–1394.
141Vgl. cc. 244, 317 § 4, 323 § 2, 445, 473 § 1, 646, 667 §§ 2–3, 674, 897, 1061 § 1, 1096 § 1, 1650 § 2. An den beiden eherechtlichen Belegstellen für ordinatum […] ad (cc. 1061 § 1 bzw. 1096 § 1) ist allein die Hinordnung der Ehe auf die Zeugung von Nachkommen ausgesagt, wohingegen das Wohl der Gatten sowie die Erziehung der Nachkommen nicht erwähnt werden.
142Vgl. auch Sachs: Elternschaft, 29f.
143Vgl. Georges: Handwörterbuch, Bd. 1, 852f.
144Vgl. für diese: Ochoa: Index, 56–58. Ochoa unterscheidet die Verwendungsweisen von bonum „in sensu spirituali“ und „in sensu materiali“.
145Ausnahmen sind im Sakramentenrecht bei den Gelübden zu finden, wo bonum allgemein „etwas sittlich Gutes“ (Althaus: MKCIC c. 1191, Rn. 4) und nicht ein „Wohl“ bezeichnet. In c. 1313 § 2 ist die Aufstellung von Sühnestrafen normiert, die „ein geistliches oder zeitliches Gut entziehen“ können, auch hier ergibt die Bedeutung „Wohl“ keinen Sinn. Hingegen ist in manchen Fällen eine Übersetzung mit „Wohl“ ebenso möglich wie mit „Gut“, z. B. bei maius bonum in c. 459, das durch die Beziehung der Bischofskonferenzen untereinander gefördert werden soll (vgl. auch c. 1299 § 2). In c. 614 ist spirituale bonum mit „geistlicher Nutzen“ zu übersetzen.
146Vgl. Georges: Handwörterbuch, Bd. 1, 1490f.
147Vgl. Ochoa: Index, 101.
148Vgl. unten Kapitel 4–6.
149Vgl. Georges: Handwörterbuch, Bd. 1, 675–678.
150Vgl. c. 1084 § 3: „Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098. – Unfruchtbarkeit macht die Eheschließung weder unerlaubt noch ungültig, unbeschadet der Vorschrift des can. 1098.“ Verschiedentlich wird hierzu bemerkt, die Hinordnung auf Zeugung und Erziehung von Nachkommen könne bei sterilen Partnern bspw. durch Adoption oder die gemeinsame Sorge um Kinder im weiter gefassten familiären bzw. gesellschaftlichen Bereich als Realität im Leben der Eheleute erfahrbar werden; vgl. Carreras: Bonum, 136. Vgl. auch Franziskus: Amoris laetitia, nn. 178–180. Das ist zwar zutreffend, erfasst aber weder die Hinordnung auf Zeugung, noch wird – der Komplexität des Sachverhalts Rechnung tragend – ein entsprechendes Handeln rechtlich gefordert.
151Für eine Erläuterung dieses Konzeptes vgl. Sachs: Elternschaft, 18–24 sowie unten Kapitel 7.2.2.
152Körperliche Einschränkungen, die jemanden physisch unfähig zur Beförderung oder Realisierung des Gattenwohls machen, sind vermutlich selten, denn auch bei schwersten körperlichen Einschränkungen ist eine Partnerschaft möglich, die von beiden als glückend erlebt wird. Das gilt auch für den Fall, dass Aufgaben sehr ungleich verteilt sind und dem eingeschränkten Partner ein hohes Maß an Sorge und Pflege zukommen muss. Weil jede Ehe eine einzigartige Beziehung zwischen zwei Menschen ist, sind auch die Voraussetzungen für Gattenwohl in jeder Ehe verschieden. Dass eine erhebliche Ungleichheit der Lastenverteilung eine Herausforderung für Paare darstellt, steht nicht in Zweifel, ist aber für das kirchliche Eherecht nicht von Belang und wird entsprechend nicht gesetzlich geregelt oder von der Judikatur verlangt; vgl. Kimengich: Bonum, 143 mit Verweis auf ein Urteil coram Burke v. 12.12.1991, n. 9: „Facile quis dicere posset quod alteruter sponsus bono coniugum pari modo contribuere debet. Practice, tamen, aeaqualitas contributionis sub aspectu morali aegre mensuratur, nullo vero modo sub aspectu iuridico.“ Eine Unfähigkeit zur Eheführung aus psychischen Gründen i. S. v. c. 1095, n. 3 berührt hingegen beide Sinnziele; vgl. unten Kapitel 8.2.3 sowie Vanzi: Incapacità, 190–212.
153Primetshofer: Ausschluss, 355 unter Berufung auf Carreras: Bonum, 156.
154Vgl. Lüdicke: MKCIC c. 1055, Rnn. 15f. Klaus Lüdicke hat dies in mehreren Veröffentlichungen eingehend dargelegt, vgl. bspw. Lüdicke: Familienplanung, 260–339; Lüdicke: Ehezwecke, 39–57.
155Für eine Auseinandersetzung mit Lüdickes Position vgl. Sachs: Elternschaft, 112–136.
156Vgl. ebd., 117–124.
157Vgl. Lüdecke: Ausschluß, 179; Posa: Bonum, 39–41; Sachs: Elternschaft, 134.
158So ist in der Relatio synodi der Außerordentlichen Bischofssynode vom 18.10.2014 die Rede von den Ehegütern; vgl. Relatio synodi 2014, n. 21. Vgl. exemplarisch für die Doktrin Errázuriz: Senso, 586. In Urteilen der Rota ist nicht etwa bspw. vom „Ausschluss der Wesenseigenschaft der Unauflöslichkeit“ die Rede, sondern von der „exclusio boni sacramenti“; vgl. bspw. RR: Sententia coram Turnaturi v. 10.04.2003, n. 40.
159Vgl. für eine kurze Erläuterung, weitere Quellenbelege und Literaturhinweise Flasch: Augustin, 28–35.
160Vgl. Gen 1–2.
161Vgl. Augustinus: De bono coniugali, n. 32: „[…] haec omnia bona sunt, propter quae nuptiae bonum sunt: proles, fides, sacramentum.“ Vgl. für die jeweiligen bona Lüdicke: Familienplanung, 9–94 (ausführliche rechtshistorische Entwicklung); Bruns: Auswertung sowie Bruns: Ehe-sacramentum.
162Vgl. O’Loughlin: Marriage, 367; Wrenn: Essence, 535; Matthews: Elements, 116–118.
163Vgl. Lüdicke: Nichtigerklärung, 16–18. Anderer Auffassung ist Urbano Navarrete, der eine Anwendung der augustinischen bona aufgrund ihrer Tradition und häufiger Anwendung in der Rechtsprechung für zulässig hält. Vgl. Navarrete: Beni, 93. 97.
164Vgl. in diesem Sinne auch Lüdicke: Bonum, 338.
165Vgl. c. 1013 § 1 CIC/1917: „Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae.“
166Vgl. Banjo: Relevance, 13–15.19–21; De Luca: Reflections, 130–132; Kimengich: Bonum, 4–8; Gramunt: Reflections, 613: „From the formulation of the ends of marriage in the 1917 Code (can. 1013,§ 1), as primary and secondary, canonists drew the conclusion that marriage is primarily defined by ‚procreation and education of offspring‘ and secondarily by mutual help as an end subordinated to the primary end. In the Code of 1983, the ends to which ‚marriage is ordered of its own very nature‘ are formulated as ‚the good of the spouses and the procreation and education of offspring‘ (can. 1055,§ 1) […].“ Für eine Reihe weiterer Belege aus der Doktrin vgl. Lüdicke: Ehezwecke, 46–49, als Beispiel für das Festhalten an den Ehezwecken sowie der Zweckhierarchie in der Rechtsprechung vgl. unten Kapitel 4.2.5.
167Zapp: Eherecht, 39. Vgl. auch Lüdecke: Ausschluß, 153–156. Dass in c. 1125 § 3 dennoch von „finibus […] essentialibus matrimonii“ die Rede ist, steht dazu nicht im Widerspruch, da es sich um eine wörtliche Übernahme aus dem MP Matrimonia mixta Papst Pauls VI. handelt. C. 1125 führt die Lehre von den Ehezwecken nicht durch die „Hintertür“ wieder ein, sondern ist gemäß der das Eherecht einleitenden Normen auszulegen; vgl. Lüdecke: Ausschluß, 153. Auch die Rede von fines matrimonii in GS 48.50 kann nicht als Beleg für die Weitergeltung der Ehezwecklehre angeführt werden, stellt der Konzilstext doch eine „bewusste[r] Abkehr vom ersten Schema ‚De castitate, virginitate, matrimonio, familia‘, das die herrschende Doktrin spiegelte“, dar; (Lüdicke: Wiedergeburt, 452). Vgl. auch oben Kapitel 2.2. Anderer Auffassung ist Nikolaus Schöch: Ehe, 1245f.: „Das geltende Recht (c. 1055 § 1 CIC; c. 776 § 1 CCEO) erwähnt die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenzwecken der Ehe nicht mehr, ohne diese abgeschafft zu haben, sondern stellt fest, dass der Ehebund seiner Eigenart nach auf das Wohl der Ehegatten und auf die Zeugung und die Erziehung der Nachkommenschaft ausgerichtet ist.“
168Lüdecke: Ausschluß, 154.
169Ebd., 154. Vgl. ebenso Lüdecke: Konsequenzen, 129: „Göttliche Urheberschaft meint inhaltlich ganz im Sinne des reichhaltigen Konzilsvotums des US-amerikanischen Erzbischofs Shehan von Baltimore/USA keinen göttlichen Oktroi, sondern die Beanspruchung des Menschen als Geschöpf durch seinen ihn in seine verantowrtliche [sic!] Freiheit entlassenden Urheber.“
170Vgl. De Vries: Ziel, 481f.
171Müller: Wörterbuch, 360.
172Vgl. Zapp: Eherecht, 39.
173Vgl. Lüdecke: Ausschluß, 136.
174Vgl. Althaus: Eherecht, 9; Zotz: Elementum, 233.
175Vgl. c. 1101 § 2: „At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit. – Wenn aber ein oder beide Partner durch positiven Willensakt die Ehe selbst oder ein Wesenselement der Ehe oder eine Wesenseigenschaft der Ehe ausschließen, ist ihre Eheschließung ungültig.“
176Vgl. Cuschieri: Bonum, 344: „In the mind of the Code, the « bonum coniugum », in its ontological perspective, is the very essence of marriage. Being the matrimonial covenant itself, the bonum coniugum incorporates in itself the two essential properties, unity and indissolubility.“ Vgl. auch RR: Sententia coram Huot v. 02.10.1986, n. 18.
177Richard Barret stellt eine Nähe zwischen dem bonum coniugum und der Kategorie der ehelichen Wesenseigenschaften fest; vgl. Barret: Reflections, 524f.
178Vgl. c. 1056: „Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. – Die Wesenseigenschaften der Ehe sind die Einheit und die Unauflöslichkeit, die in der christlichen Ehe im Hinblick auf das Sakrament eine besondere Festigkeit erlangen.“ C. 1013 § 2 CIC/1917 ist als Vorgängernorm inhaltlich identisch: „Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti.“
179Vgl. Lüdicke: Bonum, 338.
180Vgl. Bonnet: Essenza, 123.
181Vgl. ebd., 90–92; vgl. ebenso Bonnet: Bonum, 436–438; Pellegrino: Bonum, 809.
182Vgl. Bonnet: Essenza, 129: „L’ ‚ordinatio ad bonum conigum‘ quindi, insieme all’ ‚ordinatio ad bonum prolis‘ all’unità e all’indissolubilità, qualifica lo stato di vita matrimoniale. Di più, quelle stesse proprietà individuano realmente ed effetivamente il matrimonio ‘in facto esse’ solo nella loro globalità, quasi specificazioni diverse di un’unica proprietà. Questo in qualche modo può dirsi una particolarità del nostro istituto, particolarità che si evidenzia inoltre nel fatto che tutte quelle stesse proprietà si pongono anche come espressione dell’adeguatezza dell’essenza ai fini.“
183Vgl. Navarrete: Beni, 94: „Il legislatore infatti si referisce esclusivamente a queste due proprietà, e non attribuisce il termine di proprietà ad altri aspetti del matrimonio che concettualmente possono avere una notevole affinità con l’unità e l’indissolubilità del matrimonio.“
184Vgl. Lüdecke: Ausschluß, 168.
185Einen anderen Zusammenhang zwischen bonum conuigum und den Wesenseigenschaften der Ehe stellte kürzlich Papst Franziskus in Amoris laetitia her. Einheit und Unauflöslichkeit seien Bestandteile des Gattenwohls: „«[…] Risulta particolarmente opportuno comprendere in chiave cristocentrica le proprietà naturali del matrimonio, che costituiscono il bene dei coniugi (bonum coniugum)» che comprende l’unità, l’apertura alla vita, la fedeltà e l’indissolubilità, e all’interno del matrimonio cristiano anche l’aiuto reciproco nel cammino verso una più piena amicizia con il Signore.“ (Franziskus: Amoris laetitia, n. 77). Der erste Teil des Zitats stammt aus n. 47 des Abschlussberichts der XVI. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode von 2015. Die deutsche Übersetzung dieser Passage der Relatio synodi unterscheidet sich dabei von allen anderen veröffentlichten Sprachversionen und setzt das Gattenwohl mit den Wesenseigenschaften gleich: „Es erweist sich als besonders angemessen, die natürlichen Eigenschaften der Ehe, das eheliche Gut (bonum coniugum) christozentrisch zu verstehen.“ (Relatio synodi 2015, n. 47). Da der Papst diese Verbindung zwischen Gattenwohl und Wesenseigenschaften nur in einem sehr allgemeinen Sinn aussagt und nicht weiter vertieft, ist eine eingehendere Untersuchung nicht möglich.
186Vgl. Georges: Handwörterbuch, Bd. 1, 2381.
187Vgl. Ochoa: Index, 164.
188Vgl. Georges: Handwörterbuch, Bd. 1, 2470. Unbenommen des komplexen philosophiegeschichtlichen Zusammenhangs, in dem essentia steht (vgl. Capone Braga: Essenza), wird der Begriff hier wohl nach Thomas von Aquin im Sinne der quidditas, der Washeit, bzw. der Natur der Sache gebraucht. „Sed sciendum, quod esse dicitur tripliciter: Uno modo dicitur esse ipsa quidditas vel natura rei, sicut dicitur quod definitio est oratio significans quid est esse; definitio enim quidditatem rei significat. Alio modo dicitur esse ipse actus essentiae; sicut vivere […]. Tertio modo dicitur esse quod significat veritatem compositionis in praepositionibus secundum quod est dicitur copula“ (Thomas von Aquin: Scriptum, I, disp. 33, q. 1, art. 1, ad 1 (766)). Essentia meint das, was eine Sache ihrer Natur nach ist; vgl. Vollrath: Essenz, 754. Die Position des Canons innerhalb der Normen über den Konsens bzw. die Konsensmängel legt den Schluss nahe, dass essentia hier in dieser relativ allgemeinen Bedeutung zu verstehen ist.
189Vgl. Ochoa: Index, 164.173. Da der Wortlaut der Norm im CCEO im Wesentlichen mit c. 1101 § 2 übereinstimmt, erbringt ein Vergleich mit dem Codex der katholischen Ostkirchen keine weitere Erkenntnis in diesem Punkt. Vgl. c. 824 § 2 CCEO: „Sed si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludit matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum vel essentialem aliquam proprietatem, invalide matrimonium celebrat.“