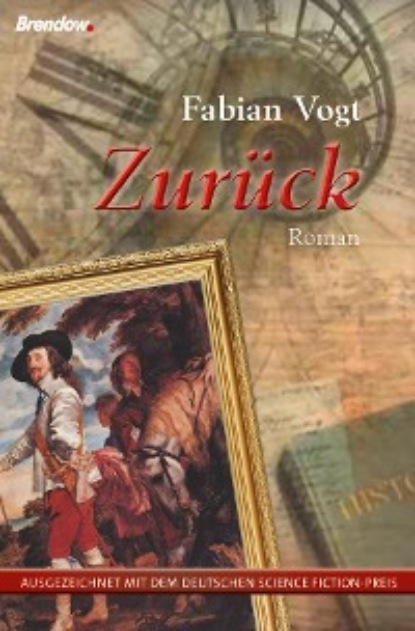- -
- 100%
- +
Die Eindrücke, die eben noch wie eine Lawine über mich hereinzustürzen drohten, waren wie weggewischt. Ein angehaltenes Uhrenpendel, ein ausgeschalteter Presslufthammer, ein gefallener Bühnenvorhang. Ich war wieder ich. Ich atmete erleichtert die kalte Nachtluft ein und blickte in die Runde.
Anna fiel mir um den Hals und küsste mich auf den Mund, weich und einladend. Ich runzelte die Stirn.
„Hey, was ist?“, fragte sie und beugte sich ein wenig zurück. „Sei doch nicht immer so ernst. Ein frohes neues Jahr!“
„Ein frohes neues Jahr“, murmelte ich und wollte mich von ihr lösen, aber sie umschlang mich schon wieder, drückte ihre Brüste sinnlich gegen meinen Oberkörper und knabberte an meiner Unterlippe. Ich war so verblüfft, dass ich sie einfach gewähren ließ. Irgendetwas lief hier falsch. Sie streichelte meinen Rücken, schmiegte sich an mich und blitzte mich mit ihren grünen Augen verheißungsvoll an.
„Freust du dich auf das neue Jahr?“
„Na, ich weiß nicht so recht.“
Ein Hauch von Ärger zog über ihr Gesicht, aber ehe sie sich aufregen konnte, kamen Freunde und Bekannte von allen Seiten herbeigeströmt, um mit uns anzustoßen. Alle waren so gut gelaunt, dass ich mich anstecken ließ. Einige Freunde hatte ich den ganzen Abend über noch gar nicht wahrgenommen und ich fand es lustig, die ewig gleichen Sprüche zu hören. Alles schien wieder in Ordnung zu sein.
„Hallo, Max, ein gutes neues!“
Jemand klopfte mir auf die Schulter und hielt sich dann daran fest. Ich drehte mich um – und da stand Thomas. Jetzt wurde mir endgültig flau. Meine Gedanken zuckten wie Fische in einem Netz.
Thomas war ein Freund, mit dem ich schon als Schüler die örtliche Pfadfindergruppe unsicher gemacht hatte; der hoch aufgeschossene Verfahrenstechniker mit dem kleinen, unverkennbaren Muttermal am Kinn. Er stand da und grinste. Ich stand da und gefror innerlich. Wie eine Dunstglocke umhüllten mich die aufgeregten Stimmen der Freunde, wurden immer dumpfer und sperrten mich in mir ein.
Vor mir stand Thomas. Ich war im Juni bei seiner Beerdigung gewesen. Mit all den Leuten, die hier um uns feierten. Aber das schien niemandem außer mir aufzufallen. Ein widerlicher Unfall. Thomas war bei einer Nachtfahrt auf gerader Strecke mit dem Motorrad von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Keiner konnte sich erklären, wie es dazu gekommen war, denn er hatte jahrelang während des Studiums als Testfahrer für BMW gearbeitet und wusste, wie man mit schweren Maschinen umging.
Ich war bei der Trauerfeier nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder in Tränen ausgebrochen, als ein ehemaliger Mitschüler einen melancholischen Gospel angestimmt hatte. Die Familie hatte später entschieden, dass ich einige altsprachliche Bücher und zwei Lexika von Thomas bekommen sollte. Sie standen seither direkt neben meinem Schreibtisch und erinnerten mich jeden Tag an ihn. Ich musste schlucken und brachte kein Wort heraus. Thomas dagegen war völlig entspannt.
„Na, ihr zwei Hübschen. Was machen denn die Heiratspläne? Ist es dieses Jahr endlich soweit? So etwas nimmt man sich doch an Silvester vor, oder nicht?“
Er zwickte Anna in die Seite, die sich kichernd nach vorne beugte. Sie druckste herum: „Na, alles zu seiner Zeit.“
„Max, was ist denn los? Du siehst aus, als ginge es dir nicht gut.“
Ich ertrug die Situation nicht mehr und rannte davon: „Entschuldigt mich einen Augenblick!“
Ich lief ins Haus, um mich zum Nachdenken auf die Toilette zu verziehen, wie ich es in solchen Momenten immer tue, gerade dann, wenn mich Panik überkommt. Es gibt Zeiten, in denen ich für mich sein muss. Und dieser Alptraum war Grund genug.
Aber ich kam nicht dazu. Denn als ich mich an den Resten des Büfetts vorbeigezwängt, einem halben Dutzend Freunden gequält ein gutes neues Jahr gewünscht und mich zum Flur durchgekämpft hatte, verlor ich völlig die Kontrolle über meinen Verstand. Normalerweise bin ich nicht leicht zu erschüttern, aber diesmal durchzog mich ein kalter Schauder, der nicht aufhören wollte. Mein Herz raste.
Es hatte auch allen Grund dazu: Im Gang stand ich! Ich selbst! Der, den ich sonst nur im Spiegel erblickte. Ich sah mich in angeregtem Gespräch vor der Tür zum Badezimmer stehen, etwa dreieinhalb Meter von mir entfernt. Da lehnte ich an der Wand und plauderte mit einer hübschen Brünetten, die schon im Jahr zuvor auf der Party gewesen war. Ich glaube, sie hieß Julia, aber das war mir in diesem Augenblick völlig gleichgültig.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand verstehen kann, was da geschah: Ich sah mich als mein Gegenüber. Zum ersten Mal in meinem Leben begegnete ich mir selbst. Und als ich in den großen Spiegel neben der Eingangstür blickte, stand ich tatsächlich zweimal da. Ich wollte schreien – und konnte nicht. Ab da weiß ich kaum noch, was geschah.
Da sich mein anderes Ich in diesem Moment suchend umdrehte, ließ ich mich zwischen die Jacken und Mäntel an der Garderobe fallen und versuchte verzweifelt, meinen Herzschlag wieder unter Kontrolle zu bekommen. Was ist los? Was ist los? Was passiert hier? hämmerte es in mir, während ich flach und schnell atmete. Bevor ich auch nur eine irgendwie geartete Antwort zuließ, nahm ich völlig verstört meinen Mantel und rannte hinaus. Nach einigem Suchen fand ich an einem Taxistand einen einsam vom Widerschein der Raketen glitzernden Wagen und ließ mich völlig fassungslos auf die Rückbank gleiten.
„Ein gesegnetes Jahr 1999“, sagte der Taxifahrer.
Auf der Fahrt fiel mir ein, dass letztes Jahr, als Anna und ich die Feier verlassen wollten, meine Jacke verschwunden war und wir mit einigen Freunden eine Stunde lang danach gesucht hatten. Ich fand sie später zu Hause mit allen Papieren wieder, wurde stinksauer, und Anna beteuerte vergeblich, dass es sich dabei nicht um einen ihrer üblichen Scherze gehandelt habe.
„Können Sie bitte das Radio anschalten?“, bat ich den Taxifahrer, als ich sah, dass es gerade ein Uhr war. Der Jingle lief schon: „Nachrichten. Es ist ein Uhr morgens. Wir wünschen allen Hörern ein frohes neues Jahr 1999.“
„Danke, das reicht. Schalten Sie bitte wieder aus!“
Der Taxifahrer brummte und drückte auf einen Knopf.
„Was denken Sie über Oskar Lafontaine?“, fragte ich. Schließlich war der Politiker als Finanzminister im März 1999 zurückgetreten.
Mein Fahrer schob seine dicke Mütze nach hinten, drehte sich kurz zu mir um, als wolle er an meinem Gesichtsausdruck erkennen, was er antworten könne, und murmelte dann: „Ich finde, die ersten hundert Tage sollte man einer neuen Regierung schon gönnen, dann kann man immer noch anfangen zu schimpfen.“
Ich schwieg. Ich war noch nie einem Phänomen begegnet, das ich nicht erklären konnte. Zumindest keinem, das so nach einer Erklärung schrie. Ich war es gewohnt, in Büchern nach Antworten auf strukturierte Fragen zu suchen und aus kleinen Indizien historische Schlüsse zu ziehen. Aber ich war es nicht gewohnt, aus dem Jahr 2000 zurück in das Jahr 1999 versetzt zu werden.
Ich weiß nicht, ob es die Müdigkeit, die Verzweiflung oder einfach völlige Ratlosigkeit war, jedenfalls wurde ich mit einem Mal ganz ruhig.
Ich schloss die Augen, lehnte mich zurück und verwandelte mich in den korrekten Wissenschaftler, den Anna so hasste und der alle Probleme als logische Herausforderung betrachtet. Ich schalte dann meine Gefühle aus, atme tief durch und analysiere mich und die Umgebung so lange, bis ich eine rationale Erklärung finde. Ich weiß, dass das erbärmlich ist, aber es hat mir immer geholfen, wenn ich kurz vor der Verzweiflung stand.
Zu Hause angekommen, holte ich einen alten Koffer vom Speicher, den ich nicht vermissen würde, und packte einige Kleider zusammen, die Anna ohnehin nicht gefielen und die ich deswegen normalerweise nie trug. Ich ließ mir noch einmal von unserem Fernseher und vom Computer das Datum bestätigen, stellte schon gar nicht mehr überrascht fest, dass die von Thomas geerbten Bücher nicht mehr, beziehungsweise noch nicht in meinem Regal ruhten, fand im Küchenregal auch tatsächlich den kaputten Toaster wieder, den ich im Sommer 1999 eigenhändig zerlegt und entsorgt hatte, nahm den Schlüssel zur Gartenhütte meiner Eltern und einen Ersatz-Hausschlüssel aus dem Schlüsselkasten und ließ die Tür hinter mir ins Schloss fallen.
So fing es an.
1635 Van Dyck schob mir einen Becher Wein zu, den er auf eine Holzkiste gestellt hatte, die zwischen uns stand, und forderte mich wortlos auf, daraus zu trinken.
„Du behauptest also, du wärst im Jahr 2000 zurück ins Jahr 1999 gesprungen?“
„Nicht nur das. Seitdem wache ich jeden Morgen ein Jahr früher auf. Ich wollte es anfangs selbst nicht glauben. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ehe ich wirklich realisiert hatte, was passiert war, verging eine ganze Woche, in der ich jeden Tag hoffte, dass jemand von der, Versteckten Kamera‘, ein überdrehter Wissenschaftler oder ein Psychologe zu mir in die Gartenhütte käme, um mir zu sagen, dass das alles nur ein Spiel, ein Experiment oder eine Täuschung gewesen sei. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben.
Als das Unbegreifliche zur Gewissheit wurde, stand auf den Zeitungen am nahe gelegenen Kiosk in der Datumsspalte bereits 1993. Donnerstag, der 7. Januar 1993. Die Tage liefen weiter, aber die Jahreszahlen sprangen zurück.“
Es fällt mir schwer, dieses Gespräch aufzuschreiben, denn ich werde schon wieder von diesem bedrückenden Gefühl überwältigt, das meine Stunden im Atelier bestimmt hat; eine seltsame Mischung aus Hilflosigkeit, Stolz und Wut. Ich soll etwas erklären, was unerklärlich scheint. Welch eine Aufgabe. Niemand hat jemals mein Schicksal geteilt, und darum ringe ich voller Ehrgeiz mit den Worten und erkenne schnell, dass sie mich wahrscheinlich zu Boden werfen werden. Ich bin nicht einmal sicher, ob mich Van Dyck verstanden hat; immerhin lassen seine Rückfragen darauf schließen; wenn ich denn sein von einem starken niederdeutschen Akzent geprägtes Altenglisch richtig interpretiere. Ich könnte seine Erwiderungen natürlich im Original wiedergeben, aber wer weiß, ob ich sie dann in einigen Jahren noch begreifen werde. Schließlich ist es ungewiss, wie lange meine Reise dauern wird.
Was soll ich also machen? Ich kann nur von dem schreiben, was ich selbst begreife. Ich denke, ich werde alle Eindrücke so wiedergeben, wie mein Verstand sie empfangen hat, der ja auch jede Botschaft übersetzt, damit ich sie einordnen kann.
Mein Van Dyck spricht meine Sprache, und ich kann hier ohnehin nur das festhalten, was ich gehört und begriffen habe. Außerdem bin ich es, der das Rätsel lösen will, nein, lösen muss. Das Rätsel Maximilian Temper. Wer könnte mir verbieten, meine Sicht der Dinge zu berichten? Sollte ein anderer irgendwann einmal diese Zeilen lesen, dann wird er die Welt aus meinen Augen sehen und mit meinen Ohren hören. Er wird dann nicht nur meine Reise, sondern auch mich kennen lernen.
Eines jedenfalls konnte ich die ganze Zeit spüren: Van Dyck brannte darauf, zu hören, wie meine Geschichte weiterging.
1993 Jeden Morgen war ich erwartungsvoll aus der winterlich leeren Kleingartensiedlung in das nächste Einkaufszentrum gerannt. Und jedes Mal war ich fest davon überzeugt gewesen, dass es sich bei all dem nur um ein Missverständnis handeln konnte, einen irren Traum, vielleicht durch eine Droge in einem der Drinks auf der Party verursacht. Jeden Morgen vertraute ich darauf, dass sich nun alles aufklären würde. Doch schon, wenn ich mich dem Supermarkt genähert hatte, hatten mich zu viele Kleinigkeiten darauf hingewiesen, dass ich noch weiter in die Vergangenheit vorgedrungen war: Die dichten Büsche waren kleiner geworden, die Markisen hatten heller geleuchtet und die Verkäuferinnen frischer gewirkt. Jeden Tag waren weniger Menschen mit Handys unterwegs und die Autos wurden immer eckiger.
Dann hatte sich jedes Mal mein Schritt verlangsamt, ich war die letzten Meter bis zum Zeitungsständer gewankt und hatte schon gewusst, was ich auf den Titelseiten lesen würde. Und irgendwann hatte sich der letzte Rest Hoffnung in nichts aufgelöst. Als es keinen Zweifel mehr daran gab, dass ich zu einem Gefangenen der Zeit geworden war, stieg in mir Wut hoch. Warum gerade ich?
An einem dieser Tage rannte ich zurück zu meinem Schlafplatz, verbittert und voller Hass. Es war, als müsste sich die ganze Anspannung lösen. Ich musste etwas zerstören, um nicht selbst zerstört zu werden. Also ließ ich all meine Wut raus.
Innerhalb einer halben Stunde zerlegte ich die gesamte Einrichtung der Gartenhütte. Ich war wie von Sinnen, prügelte unkontrolliert mit einem Besen auf die Möbel ein, zerkratzte vor Wut die Tischplatte, riss die Schubladen aus den Schränken und trat gegen alles, was mir in den Weg kam. Ich riss die Tapete von den Wänden, hebelte die Steckdosen aus den Leisten und bohrte mit einem Messer Löcher in den Boden. Und erst als ich ausgebrannt und weinend auf den kalten Dielen lag, wurde mir wieder bewusst, wie erschüttert meine Eltern 1993 gewesen waren, als „irgendwelche“ Vandalen in ihrer Hütte randaliert hatten.
Die nächsten Tage brachte ich damit zu, mit dem Schicksal zu verhandeln. Ich war fest davon überzeugt, dass es möglich sein müsse, diesem Zeitenschwund ein Ende zu bereiten. Es musste etwas geben, das mir helfen konnte: Dämonenaustreiber, Physiker, Historiker, Wunderheiler oder eine Wallfahrt nach Lourdes. Ich spannte endlose Theorien, um den an diesem Leben Schuldigen die Sinnlosigkeit meiner neuartigen Existenz zu beweisen, aber da war niemand, dem ich mein Plädoyer hätte vorlegen können.
Tagelang versank ich in mir und wälzte immer wieder die gleichen Argumente hin und her. Ich verdächtigte alles und jeden, entwickelte ominöse Verschwörungstheorien und überlegte, ob nicht vielleicht am 1. Januar 2000 die Welt untergegangen war. Aber dann fiel mir kein Grund ein, warum jemand gerade mich auf eine derart seltsame Weise davor gerettet haben sollte. Der Irrsinn der Verzweiflung.
Ich lief sogar einige Tage durch die Straßen und versuchte herauszufinden, ob es unter den Passanten vielleicht noch andere Zeitspringer gab. Gemeinsam hätten wir ja möglicherweise eine Chance gehabt, dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Aber woran sollte ich sie erkennen? Einige Personen, die auf mich einen ziellosen Eindruck machten, sprach ich sogar an. Ich betrachtete sie lange, und wenn sie sehr unkoordiniert, unsicher und verloren wirkten, verfolgte ich sie vom Supermarkt bis auf die Straße.
Leider gab es überall Fußgänger, auf die diese Beschreibung zutraf, sodass ich immer erst dann mit ihnen in Kontakt trat, wenn sie mehrfach auf das Datum der Zeitung geblickt hatten, ohne sie zu kaufen. Aber selbst zu dieser Sorte Mensch zählten noch so viele, dass ich nicht jeden befragen konnte. Außerdem hatte ich Angst, mich lächerlich zu machen. „Was halten Sie von Zeitreisen?“, hielt ich für die unverfänglichste Frage. Doch ich erntete nur misstrauische, nichts sagende oder befremdliche Blicke. Einmal gaben mir zwei Schüler erstaunlich passende Antworten, die mich aufhorchen ließen, bis ich merkte, dass mich die beiden zum Besten hielten.
Daraufhin zog ich mich wieder zurück und versank im Kerker meiner Gedanken. Ich verabschiedete mich aus der Welt, um mich ihr nicht stellen zu müssen. Tag für Tag zog ein Jahr an mir vorüber. Die deutsche Einheit verpasste ich dabei genauso wie beim ersten Mal. Ein historisches Ereignis, das lautstark an mir vorüberschritt und mich doch nicht erreichte. Die Fragen der Welt verblassten hinter meinen Fragen. Meine Angst und meine Niedergeschlagenheit drängten sich so in den Vordergrund, dass für alles andere kein Platz mehr war. Ich war nur noch ich. Zerrissen, verwundet, hasserfüllt und trotzig. Ein Bär im Winterschlaf, der nicht mehr an den Frühling glaubt. Am 11. Januar 1989 begriff ich endlich, dass das alles keinen Zweck hatte.
1635 Durch das dunkel gewordene Atelier ging ein Luftzug. Heftig und erfüllt mit dem Geruch von Mehlschwitze und Fett.
Van Dyck fluchte: „Es ist grauenhaft. Jeden Abend öffnen diese verblödeten Mägde die Küchentüren und hier fliegen die Leinwände durch den Raum.“
Er stand auf, holte aus einer Truhe zwei Decken und warf mir eine davon zu: „Hier! Wir wollen ja nicht, dass du bis zu den Zeiten Karls des Großen Schnupfen hast.“ Er kicherte leise, wurde aber gleich wieder ernst. „Was meinst du jetzt? Warum passiert so etwas? Warum reist jemand wie du durch die Zeit?“
Ich wickelte mich in den groben Stoff und blickte nicht auf: „Wenn ich das wüsste, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Und weil ich es nicht weiß, bin ich der unglücklichste.“
Van Dyck ging zurück zu seinem Sitzplatz und zog die Nase hoch: „Dann musst du es herausfinden!“
„Eine großartige Idee! Was meint Ihr, warum ich Euch das alles erzähle? Ich hoffe, dass Ihr in meinen Geschichten etwas entdeckt, das Euch und mich dem Geheimnis etwas näher bringt.“
Der Künstler beugte sich nach vorne, um eine weitere Kerze anzuzünden. „Gut, dann lass uns weitermachen. Was geschah nach, entschuldige, vor dem 11. Januar 1989?“
1988 Ich war durch und durch müde. Nicht unausgeschlafen, sondern von einer lähmenden Schwere erfüllt, die jede Bewegung zu einer Qual und jeden Gedanken zu einer unliebsamen Anstrengung macht. Seit ich mein Los akzeptiert hatte, ergab ich mich ihm. Ich wusste nicht, wohin, und darum gab es auch keinen Grund, einen ersten Schritt zu tun. Tagsüber wanderte ich unstet durch das ehemalige Bundesgartenschaugelände an der Nidda, diesem stinkenden Kanal, der sich übermütig Fluss nennt, schaute kleinen Kindern beim Spielen zu und kehrte früh in die Hütte zurück. Ich existierte, aber ich lebte nicht.
Am 12. Januar 1988 wachte ich gegen ein Uhr morgens auf, weil ich fror. Die Kälte kroch in den alten Armeeschlafsack meines Vaters und legte sich heimtückisch um meinen nackten Körper. Zwischen den Wolken lugte bisweilen der Mond hervor, um sich gleich darauf wieder schamvoll zu verstecken.
Ich stand auf und sprang schlotternd umher, bis die Kälte aus meinen Gliedern gewichen war. Und erst dabei wurde mir bewusst, was passiert war: Durch meinen mitternächtlichen Zeitsprung war ich in einem Jahr gelandet, in dem es das kleine Blockhaus noch gar nicht gegeben hatte. 1988 hatten meine Eltern ein neues „Gartendomizil“, wie sie ihre Hütte immer nannten, gebaut und es bewusst in den hinteren Teil des Gartens gesetzt, um nicht wie vorher ab dem späten Nachmittag den Schatten des kleinen Unterschlupfes auf dem Rasen zu haben. Aber das war nur ein Grund gewesen. Mein Vater hatte sich auch deshalb wütend zum Kauf einer festeren Hütte entschlossen, weil die alte Baracke jedes Jahr im Winter aufgebrochen wurde, „von einem dieser Penner, die dann darin übernachten“, wie der stets korrekte Ingenieur in unregelmäßigen Abständen bemerkte.
Mir fiel auf, wie oft meine Reise in die Vergangenheit in meinem ersten Leben Spuren hinterlassen hatte, ohne dass es mir aufgefallen war. Denn es gab keinen Zweifel: Der Penner war ich; ich würde gleich die alte Hütte aufbrechen, zu der ich natürlich keinen Schlüssel hatte. Aber was blieb mir anderes übrig? Ich musste Gewalt anwenden, wenn ich nicht erfrieren wollte. Und genau das tat ich. Glücklicherweise war der alte Heizlüfter noch oder schon da, sodass ich bald wieder im Warmen saß.
Als mein Blick am nächsten Morgen in den ovalen Spiegel fiel, der über dem durchgesessenen Sofa in der alten Hütte hing, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass ich inzwischen wirklich wie ein Penner aussah. Ich hatte mich zwar einige Male gewaschen, eine Dusche aber gab es in dem Kleingarten natürlich nicht. Unrasiert, mit fettigen, verzottelten Haaren, langen, dreckigen Fingernägeln und ungepflegten Zähnen grinste ich mich verstohlen an – und schämte mich.
Da beschloss ich, endlich wieder zu leben. Ich fand es plötzlich unendlich dumm, mit dem Schicksal zu hadern. Und als ich an diesem Morgen an der Bahntrasse entlang in die Stadt lief, war ich sehr zuversichtlich. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich wieder um mich zu kümmern. Und zwar um uns beide: nicht nur um den verwirrten Reisenden, der jeden Morgen froh war, dass ihn zumindest die Dinge, die er am Körper trug, in die Vergangenheit begleiteten, sondern auch um mein altes Ich.
Dieser Gedanke beflügelte mich. Da war dieser ahnungslose Max, der in den achtziger Jahren vor sich hinlebte, ohne zu wissen, was ihm bei der Jahrtausendwende passieren sollte – und keiner kannte ihn so gut wie ich. Ich wollte mir helfen, mich begleiten und mir wichtige Ratschläge geben. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Das war das einzige Ziel, das mir blieb. Ich konnte versuchen, aus mir das Beste zu machen.
1986 Am Dienstag, den 14. Januar, besuchte ich mich zum ersten Mal in der Universität. Mein altes Ich war gerade 21 geworden, und ich war immer noch 35 und hatte mir in den vergangenen zwei Wochen so viel Bart wachsen lassen, dass ich mich auf keinen Fall erkennen würde. Ich war lange unsicher gewesen, ob ich diese Begegnung riskieren sollte, aber dann hatte ich mich daran erinnert, dass mir 1986 eine merkwürdige Kneipen-Tour mit einem ausgeflippten Unbekannten, der sich „Christoph“ nannte, den ersten Anstoß gegeben hatte, von Sonderpädagogik zur Altphilologie zu wechseln.
Ich hatte damals die Nase gestrichen voll von all den Schulpraktika, in denen es nicht um die Qualität des Unterrichtsstoffes, sondern um reine Machtfragen ging. Wer zeigt hier wem, was eine Harke ist? Der Lehrer den Schülern oder umgekehrt? (Van Dyck blickte mich verständnislos an.) Und wenn mir meine Schutzbefohlenen einmal nicht den Krieg erklärten, dann hingen sie wie gelähmt in den Stühlen, ließen meine anfangs noch sehr motivierten Unterrichtsentwürfe gähnend über sich ergehen oder starrten Löcher in die Decke.
Ich war 21 und sehr frustriert. In meiner Fantasie existierte Schule so unterhaltsam und freundlich wie im „Fliegenden Klassenzimmer“ von Erich Kästner, in der Realität aber war von diesem Vertrauen zum Lehrer, von der Freundschaft, der Wissbegierde und der Sehnsucht nach Gemeinschaft bei den Schülern nur wenig zu spüren. Und trotzdem wäre ich ohne einen äußeren Anstoß sicher Lehrer geworden, denn einen Wechsel des Studiengangs hätte ich aus eigener Kraft kaum vorangetrieben.
Ich stieg an der Bockenheimer Warte aus der Straßenbahn und schlenderte an den ewig gleichen Ständen mit gebrauchten Büchern vorbei, die sich dort vor dem Campus in Reih und Glied auf wackeligen Tapeziertischen nach neuen Lesern sehnten. Zeigefinger wanderten die Buchrücken entlang, verharrten bei einzelnen Titeln, um sich dann ab und an doch zwischen den Seiten zu verlieren. Eine junge Frau, die erschreckend hohe Absätze trug, holte gerade ihr Portemonnaie heraus, stellte aber offensichtlich fest, dass ihr Geld nicht für die gewählten antiquarischen Angebote reichte. Missmutig steckte sie die Börse zurück und lief eilig davon. ‚Es hat sich nichts geändert‘, dachte ich und wusste doch, dass alles anders war. Und dann sah ich es auch: Das „Depot“ hatte sich aus einer modernen Kultur- und Begegnungsstätte wieder in eine alte Eisenbahnhalle verwandelt und der McDonald‘s im Eckhaus war noch nicht da.
Mehrfach traf ich Bekannte aus der Studienzeit, traute mich aber nicht, sie zu grüßen. Sie hätten mich ohnehin nicht erkannt. Außerdem ging es mir ja um mich. Ich hatte mich daran erinnert, dass zu jener Zeit jeden Dienstag eine gut besuchte Vorlesung über „Die Pädagogik des 20. Jahrhunderts“ angeboten wurde, und mir vorgenommen, mich dort zu treffen, sah mich dann aber schon vorher vor dem Schaufenster des studentischen Reisebüros stehen und nach billigen Reisen Ausschau halten. Das Wissen, dass ich mit einem Flugzeug in wenigen Stunden in einer anderen Welt sein konnte, hatte mich schon immer fasziniert.
1635 Van Dyck wirkte angestrengt. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass es für ihn fast unmöglich sein musste, sich diese Zukunft vorzustellen. Immer wieder verzog er sein Gesicht, wenn meine Erzählung seinen Erfahrungshorizont überstieg, hörte mir aber tapfer weiter zu und nippte gedankenverloren an seinem Wein. Meine Geschichte war für ihn nicht nur durch die Reise in die Vergangenheit eine Zumutung, sie erforderte darüber hinaus seine ganze Vorstellungskraft. Kaum etwas von dem, was ich beschrieb, existierte in seiner Welt. Die 365 Jahre, die uns trennten, waren wie ein unüberbrückbarer Graben. Trotzdem nahm er erst die Flugzeuge, die ich ihm gegenüber salopp als Reisevögel bezeichnet hatte, zum Anlass nachzufragen.