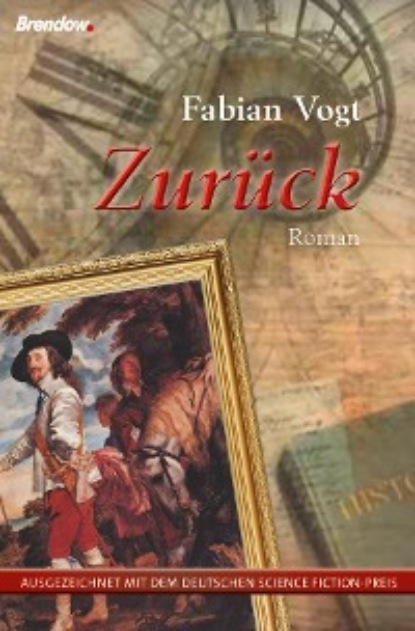- -
- 100%
- +
Er blickte mich durchdringend an: „Wie lange braucht so ein Reisevogel von London nach Florenz oder Palermo?“
Ich stutzte, weil er mich unterbrochen hatte: „Na ja, ungefähr zweieinhalb Stunden! Und in vier Stunden ist er in Jerusalem.“
„Das ist unmöglich! In dieser Zeit kommt man ja nicht einmal bis Brighton. Ein Reisevogel? Was soll das eigentlich sein? Ein gigantischer Geier oder was?“
„Nein, Sir, eine Maschine aus Metall. Sie hat Flügel, aber auch Räder, auf denen sie immer schneller rollt, bis sie abhebt. Aber ich kann Eure Zweifel verstehen: Fast alles, was Menschen erfunden haben, galt einmal als unmöglich.“
Der Künstler schenkte sich noch etwas Wein ein. Dann atmete er hörbar aus und lehnte sich zurück: „Vergiss meine Fragen und erzähl weiter!“
1986 Ich stand neben mir, also neben dem Maximilian des Jahres 1986, und sprach mich an: „Na, schon in Urlaubslaune? Sag mal, kennst du dich hier aus?“
Mein jüngeres Ich blickte mich fragend an. Ich sprach weiter: „Ja, ich habe gerade die Uni gewechselt und noch überhaupt keine Ahnung, wo‘s langgeht.“
„Was studierst du denn?“, fragte mein jüngeres Ego.
„Sonderpädagogik“, sagte ich, „übrigens: Ich heiße Christoph!“ „Ich bin Max. Na, da hast du ja wirklich Glück gehabt, ich studiere nämlich den gleichen Quatsch.“
Ich fing an, mir die Vor- und Nachteile des Frankfurter Fachbereichs zu erklären, und ich hatte Zeit, mich in Ruhe anzuschauen. Max als Studienanfänger. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, wie sehr sich Menschen verändern. Der hochaufgeschossene Jüngling, der da mit kieksiger Stimme auf mich einredete, war ich und war doch nicht ich. Dem da fehlte so viel an Erfahrung, an Reife und an Gelassenheit. Ein typischer Student. Ich war enttäuscht.
Mein 21-jähriges Ich entpuppte sich als unangenehmer Kerl, mit dem ich bestimmt keine Freundschaft geschlossen hätte: zutiefst von sich überzeugt, schnoddrig, unreflektiert, aber vollgestopft mit altklugen Sprüchen. Die dünnen Härchen am Kinn und die schulterlangen Haare wirkten vernachlässigt, und die Hände zuckten die ganze Zeit nervös zur Seite, als wollten sie etwas greifen. Kein Wunder, dass ich damals so oft Krach mit meinem Vater hatte, durchfuhr es mich. Ich war zwar während meines Zivildienstes in Kassel von zu Hause ausgezogen, dann aber wieder zurückgekehrt.
Nach dem Seminar gingen wir zusammen ins „Piccolo Giardino“, ein kleines italienisches Restaurant im Nordend, und ich fragte mich nach meinen Zukunftsplänen: „Willst du später ernsthaft als Sonderschullehrer arbeiten?“
Max, der jüngere, zögerte einen Moment, dann sagte er: „Keine Ahnung. Ich mache erst mein Studium fertig, dann gucke ich weiter.“
„Das klingt ja sehr begeistert“, sagte ich.
Er spielte mit dem Salzstreuer, in dem kleine Reiskörner wie Fische im Aquarium schwammen, und zuckte mit den Schultern: „Na, findest du diese Jugendlichen in den Schulbänken etwa toll?“
„Nein, deswegen werde ich auch zum nächsten Semester das Fach wechseln. Ich werde mit Altphilologie weitermachen!“
„Aha!“ Er grinste mich spöttisch an: „Meinst du nicht, dass du in deinem Alter mal langsam einen Abschluss machen solltest?“
Ich knurrte nur, weil mir in diesem Augenblick klar wurde, dass es mir niemals gelingen würde, mich in der Gestalt eines 35-Jährigen von einem Studienfachwechsel zu überzeugen. Ich erinnerte mich daran, wie kritisch ich damals gegenüber Bummelstudenten gewesen war, die fünfmal mit einem neuen Fach anfangen und dann nach dem Examen direkt die Rente beantragen.
Also versuchte ich einen anderen Weg: „Kennst du Lukian?“
„Nee, nie gehört! Wer soll das denn sein?“
Ich schlug die Beine übereinander: „Das ist ein Kabarettist und Schriftsteller aus dem zweiten Jahrhundert, dessen Karriere mit einem Traum anfing, den er als junger Mann hatte. Er wollte unbedingt Anwalt und Redner werden. Und es gab nur einen ernsthaften Hinderungsgrund: Lukian lebte in Samosata am Euphrat, also in Syrien, die Weltsprache der damaligen Zeit war aber Griechisch. Doch er wusste, dass man, wenn man eine Vision für sein Leben hat, groß denken muss. Also setzte er sich hin und studierte monatelang bei verschiedenen Lehrern Griechisch, bis er die fremde Sprache fließend sprechen und schreiben konnte. Und dann zog er los und fing an, seinen Traum zu leben.“
Max wirkte genervt: „Ja und?“
„Du meinst, warum ich dir das erzähle? Weil mich der Typ fasziniert. Weil er einer war, der wusste, was er wollte. Und dafür war ihm kein Weg zu mühsam und kein Hindernis zu groß. Ich glaube, dass ich jetzt in meinem Studium auch endlich an dem Punkt bin, an dem ich weiß, welchen Traum ich habe. Und ich bin jetzt auch bereit, was dafür zu investieren. Ich habe zu lange alles mit halbem Herzen gemacht, jetzt fang ich an.“ Ich machte eine Pause, dann blickte ich ihm direkt in die Augen: „Weißt du, was du willst?“
Er wich meinem Blick aus. „Keine Ahnung! Meinst du, ich soll Griechisch lernen, oder was? Das hat mir schon an der Schule gereicht.“
„Na ja, es gibt sicher Schlimmeres. Eines ist jedenfalls sicher: Wenn dich das Unterrichten jetzt schon ankotzt, dann wäre es ja wohl das Sinnloseste, die nächsten 30 Jahre damit zu verbringen.“
Mein jüngeres Ich schaute mich genervt an. „Und was hat dieser Lukian davon gehabt? Heute kennt ihn keiner mehr!“
„Na, immer langsam! Ich bin ziemlich sicher, dass er ein sehr zufriedener Mensch war. Und es ist ja nicht übel, nach 1800 Jahren immer noch gedruckt zu werden. Das können nur wenige von sich sagen. Außerdem hat Lukian eine Menge anderer Dichter und Denker inspiriert. Goethe hat sogar die Geschichte vom Zauberlehrling von ihm geklaut. Ich jedenfalls gehe fest davon aus, dass ich als Altphilologe mehr über das Leben lerne als in der Sonderpädagogik.“
Irgendwie wusste ich nicht weiter. Ich kam mir dumm vor. Ich saß da und versuchte, mich selbst von etwas zu überzeugen, von dem ich als 35-Jähriger gar nicht mehr überzeugt war. Und doch musste ich mich vor einem Beruf retten, der mich ruiniert hätte.
Ich starrte auf meinen Teller, stocherte lustlos in meinen „Fettucine a la panna“, grübelte vor mich hin und suchte nach Argumenten. Max sah mich nachdenklich an. Als ich mit dem Blick dem Weinglas folgte, das er zum Mund führte, bemerkte ich, wie sich der geblümte Vorhang vor dem Windfang bewegte und eine Gruppe gut gelaunter Studentinnen aus der Kälte hereinkam. Die ersten beiden setzten sofort ihre Brillen ab, die in dem stickigen Raum beschlugen, und blickten mit großen Augen in den Raum. Die dritte strich sich genüsslich die Haare aus dem Gesicht und gab ihrer Freundin eine flapsige Antwort auf etwas, das diese gesagt hatte. Es war Verena.
Verena, die Wilde, die Verrückte, die einzige Liebe meiner Studentenzeit. Verena, die Frau, die immer in der Angst lebte, etwas zu versäumen. Sie war es, die mir beigebracht hatte, Dinge um ihrer selbst willen zu tun: Tanzen, Singen und Spazierengehen, Weinen oder Streiten. Wir hatten drei wundervolle Jahre miteinander verbracht, in denen ich angefangen hatte, das Leben zu lieben. Als sie dann nach Hamburg gezogen war, um ihr Studium zu beenden, führten wir noch eine Zeit lang eine Wochenendbeziehung.
Doch es ging uns wie so vielen. Da wir uns nur selten sahen, hatten wir keine gemeinsame Geschichte mehr. Wenn wir jetzt Zeit miteinander verbrachten, drehten wir uns nur noch umeinander und verloren dabei den Alltag völlig aus dem Blick. Nach den Wochenenden kehrte jeder in eine dem anderen unbekannte Welt zurück. Trotzdem hätte unsere Beziehung vielleicht überlebt, wenn ich sie nicht mit meiner Eifersucht kaputt gemacht hätte. Verena hasste es nämlich, kontrolliert zu werden, und ich hasste es, wenn sie immer wieder von Kommilitonen erzählte, mit denen sie ausgegangen war. Einmal hatte ich in meiner Wut und Ohnmacht, als sie mir am Telefon von einer „tollen“ Party mit „echt netten Männern“ erzählte, ein Stück aus dem Glas gebissen, das ich gerade in der Hand hielt.
Ich glaube nicht, dass sie mich jemals betrogen hat, aber es reizte sie so sehr, mein Vertrauen auf die Probe zu stellen, dass sie in ihrem Übermut immer verfänglichere Situationen herbeiführte. Je eifersüchtiger ich wurde, desto herausfordernder lebte sie: Sie ging ständig mit Studienkollegen in die Sauna, ließ nach langen Lernabenden Freunde bei sich übernachten, berichtete stolz, welche Männer an ihr interessiert seien und betonte bei all dem, dass sie doch wohl nicht mein Eigentum sei.
Für sie war das alles ein amüsantes, reizvolles Spiel, aber sie beendete es nicht, solange sie die Spielregeln noch kontrollieren konnte. Und ich Idiot war so eifersüchtig, dass ich anfing, ihr Verbote zu erteilen; was sie natürlich nur noch mehr reizte und anstachelte. In meiner Hilflosigkeit und Verzweiflung verlor ich wohl all die Eigenschaften, die Verena jemals an mir geliebt hatte. Und als wir uns trennten – das dachte ich damals jedenfalls –, wollte keiner von uns beiden, dass es passierte. Aber wir hatten uns zu sehr herausgefordert.
Später heiratete sie einen Mediziner, der vor ihrer Scheidung mehrfach fremd ging. Ich schäme mich noch heute dafür, dass mir diese Entwicklung eine innere Genugtuung bereitete. Aber das sollte ja alles erst sehr viel später kommen.
Jetzt war die 20-jährige Verena im Raum, und mir fiel wieder ein, dass ich ihr an diesem Abend das erste Mal begegnet war, am 14. Januar 1986. Ich konnte mir das Datum damals gut merken, weil es einen Monat vor dem Valentinstag lag.
Spontan rief ich: „Hallo, Verena!“
Sie sah mich irritiert an, und erst da wurde mir bewusst, dass ich für sie ein völlig Unbekannter war. Einer, der plötzlich die Anonymität aufbrach. Sie winkte unsicher zurück, und man konnte ihr ansehen, dass sie verzweifelt versuchte, mich einzuordnen, diesen 35-jährigen Kerl, der so vertraut tat. Es war für sie offensichtlich einer dieser grauenhaften Momente, in denen man sich nicht blamieren will, obwohl man mit dem fröhlich grüßenden Gegenüber nichts, aber auch überhaupt nichts anfangen kann. Sie zögerte.
Ich aber wusste plötzlich, dass ich jetzt etwas tun musste, weil sonst mein 21-jähriges Ich niemals die Bekanntschaft dieser Prachtfrau machen würde. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, mir etwas Gutes zu tun. Nein, ich musste sogar die Initiative ergreifen, wenn mein Leben nicht völlig anders verlaufen sollte, als ich es kannte.
Weil Verena immer noch unschlüssig zwischen unserem Tisch und ihrer Clique hin- und herblickte, winkte ich sie herüber. Sie flüsterte ihren Freundinnen etwas zu und kam dann an unseren Tisch.
„Sei nicht böse, aber ich kann mich im Augenblick gar nicht erinnern, woher ich dich kenne!“
Ich lachte: „Du kennst mich auch nicht, aber jedes Mal, wenn eine schöne Frau den Raum betritt, rufe ich ‚Hallo, Verena‘, und nach 144 Versuchen hat es endlich geklappt. Du ahnst gar nicht, wie selten der Name Verena ist.“
Sie strich irritiert ihre Haare aus der Stirn: „Erzähl keinen Mist. Also, woher kennen wir uns?“
„Ich sage es dir, wenn du dich zu uns setzt.“
Die Neugier siegte. „Aber nur einen kurzen Moment, ich bin ja nicht allein hier.“
Sie nickte in Richtung ihrer Freundinnen, hängte ihre Handtasche über die Stuhllehne, und dann saß sie bei uns, Verena, die Kantige, die Frau mit den lachenden Augen und dem wissbegierigen Blick. Die Schöne mit den geschwungenen Augenbrauen, in deren Zügen sich noch Spuren ihrer tschechischen Vorfahren fanden. Ich war verzaubert. Meine Nase erkannte ihr Parfum wieder und verliebte sich sofort.
„Ich bin Christoph, das ist Maximilian.“
Sie stutzte: „Seid ihr Brüder?“
„Nein, wieso?“
„Ihr seht euch irgendwie ähnlich.“
Maximilian lachte, und ich verzog den Mund zu einem bübischen Lächeln: „Um es mit einem alten Indianersprichwort auszudrücken: ‚In unsern Adern fließt das gleiche Blut.‘“
„Ach“, sagte Max, „das wusste ich ja noch gar nicht!“
Verena blickte sich um. „Also, Christoph, auch jetzt, wo ich deinen Namen weiß, fällt mir nicht ein, wann und wo wir uns schon einmal gesehen haben.“
Ich strahlte: „Du hast mich noch nicht gesehen. Ich dich schon!“
Sie feixte und ließ zwei kleine Grübchen auf ihren Wangen blitzen. „Ach, bist du ein Spanner?“
„Nein, ich bin … na, sagen wir mal, ein Prophet, ein Hellseher, ein Wahrsager oder so etwas Ähnliches.“
„Komisch!“, sagte Maximilian, „ich dachte, du studierst Altphilologie!“
„Noch nicht, das war doch auch eine Prophezeihung. Ich kann übrigens genauso gut in die Gegenwart sehen. So wie ich Verena auf die Nase zusagen kann, dass ihre Schwester Anja heißt, sie am Palmengarten wohnt und ihr Vater Projektleiter bei der GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, ist.“
Verena zog die Stirn in Falten. „Machst du hier einen auf Privatdetektiv?“
Ich öffnete vielsagend die Hände. „Na, Philipp Marlowe würde wahrscheinlich nur schwer herausbekommen, dass du am liebsten Käsespätzle isst, dass du dieses Jahr nach Korsika fahren willst, und schon gar nicht, dass du es hasst, wenn man dich am Hals küsst.“
Jetzt wurde sie blass. Sie warf einen unsicheren Blick zu ihren Freundinnen, die aber untereinander ins Gespräch vertieft waren. Alles an ihr strahlte Verwirrung aus, als wüssten ihre Gedanken nicht, in welche Richtung sie gehen dürften.
Ich genoss es, mit ihr spielen zu können.
Langsam fasste sie sich. „Augenblick mal, welche Schuhgröße habe ich, und wie heißt unser Hund?“ Sie zog instinktiv ihre Beine zurück, um ihre Füße zu verbergen.
Ich spielte lässig mit der Serviette. „Du hast Größe 36, und euer Hund heißt Saphir, aber alle nennen ihn Schnuff. Dass er Saphir heißt, weil dein Vater deiner Mutter zum Hochzeitstag die Wahl zwischen einem Hund und einem Saphirring ließ, soll niemand erfahren, weil deine Mutter Angst hat, dass jemand sie auslacht.“
Max kniff die Augen zusammen. „Sagt mal, was geht hier eigentlich vor? Habt ihr beiden euch vorgenommen, mich zu verarschen, oder was?“
Verena schüttelte den Kopf. „Das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Da ist doch irgendein Trick dabei.“
Max hob theatralisch die Hand. „Also, ich habe damit nichts zu tun, ich kenne Christoph selbst erst seit heute Mittag. Nebenbei: Könntest du über mich auch so viel erzählen?“
Ich lachte. „Oh, noch viel mehr.“
Ich hatte das Gefühl, dass ich meinem Ziel näher kam. Wenn Verena und Max mich als gemeinsamen Gegner empfanden, war das eine gute Ausgangsposition. Eben noch waren sie sich fremd gewesen, jetzt überlegten sie schon zusammen, worin mein Geheimnis bestand. Sich selbst zu verkuppeln, ist eine schöne Aufgabe.
Ich musste schlucken, weil mir einige der vielen wundervollen Momente einfielen, die die beiden zusammen erleben würden: der erste Kuss auf dem Eisernen Steg, der gemeinsame Korsika-Urlaub auf dem kleinen Campingplatz in dem hoch gelegenen Edelkastanienhain, die Bouillabaisse am Hafen von Ajaccio, die Spaziergänge durch den Grüneburgpark, der Moment, als im Stadtbad Mitte Verenas Glitzerbikini-Oberteil beim Sprung vom Dreimeterbrett riss, sie es nicht bemerkte und, als sie aus dem Becken stieg, nur fragte: „Warum guckt ihr alle so komisch?“, der gemeinsam aufgezogene Igel, der schon ganz steif auf der Terrasse gelegen hatte, oder die zärtlichen Treffen im Gartenhäuschen. Für einen kurzen Moment wurde ich auf mich selbst eifersüchtig.
Während meiner romantischen Gedanken hatte ich an Verena vorbei gesehen. Das war ein Fehler gewesen. Offensichtlich interpretierte sie mein Schweigen falsch. Sie blitzte mich an und sprang wütend auf: „Ich weiß nicht, woher ihr das alles wisst und mit welcher neuen Masche ihr zwei komischen Typen jetzt die Frauen anmacht, aber es ist eine wirklich miese Tour. Habt ihr schon mal etwas von Datenschutz gehört? Hör auf zu grinsen, Christoph, oder wie du wirklich heißt.
Was meinst du: Wie würdest du dich fühlen, wenn plötzlich jemand vor dir stünde, der dir dein ganzes Leben erzählt? Der so tut, als gäbe es keine Geheimnisse mehr. Als wüsste jeder, was du tust und treibst. Kann sein, dass ihr so etwas toll findet, mich widert ihr nur an! Kann auch sein, dass ihr andere Frauen damit ins Bett bekommt, mich garantiert nicht. Egal, wie ihr an die Informationen gekommen seid, ihr habt kein Recht, mich so auszuspionieren.“
Ich konnte mich einfach nicht mehr erinnern, ob diese Situation, als ich sie das erste Mal erlebt hatte, auch so abgelaufen war. Verenas Zorn, der alles kaputt zu machen drohte, wäre mir sicher in Erinnerung geblieben.
Andererseits: 14 Jahre sind eine lange Zeit. Vielleicht hatten die gemeinsamen Glücksmomente den schlechten Start verdrängt, vielleicht werden manche Erlebnisse auch irgendwann aus dem Gedächtnis gelöscht.
Ich wusste es nicht. Ich spürte nur, dass mir die Situation aus der Hand zu gleiten drohte. Verena hatte ihre Handtasche gegriffen und zwängte sich bereits erregt am Nachbartisch vorbei. Trotzdem drehte sie sich noch einmal um, wohl in der Hoffnung, eine Erklärung zu bekommen. Sie war eben schon immer neugierig.
Da beschloss ich, alles auf eine Karte zu setzen: „Hast du den Brief noch, den ich dir vor einem Jahr geschickt habe und den du erst morgen öffnen sollst?“
Verena blieb mitten im Lauf stehen. Natürlich hatte ich die Bemerkung mit dem Brief improvisiert, aber ich hatte ja tatsächlich die Möglichkeit, ihr im Jahr 1985 etwas zu schicken. Langsam drehte sie ihren Oberkörper wieder in unsere Richtung. Ihr Gesicht war eine einzige Frage: „Wie sieht dieser Brief aus?“
Volltreffer. Jetzt hatte ich sie. Ich war bisher nicht auf die Idee gekommen, meine Zeitreise praktisch zu nutzen, jetzt ahnte ich etwas von den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung standen.
Versöhnend sagte ich: „Es ist ein grüner Briefumschlag. Und in diesem grünen Briefumschlag steckt ein zweiter Briefumschlag, ein roter. Darauf steht: ‚Diesen Brief auf keinen Fall vor dem 15. Januar 1986 öffnen. Ein guter Freund.‘“
Verena zog ihre Handtasche vor den Bauch, öffnete sie und holte einen kleinen roten Briefumschlag hervor.
„Dieser hier?“
Ich nickte. Sie aber atmete laut: „Du hast diesen Brief geschrieben? Aber warum? Wir kennen uns gar nicht. Langsam verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich wollte diese mysteriöse Botschaft heute Nacht mit meinen Freundinnen zusammen öffnen, weil wir alle unbedingt wissen wollen, wer und was dahinter steckt. Wir dachten, es sei irgendein Spaßvogel. Oder ein heimlicher Verehrer.“
„Vielleicht trifft ja beides zu!“
Ich prägte mir Form und Farbe des Umschlags ein, denn ich würde morgen, also im Jahr 1985, genau so einen finden und abschicken müssen. Verena sah jetzt entspannter aus. „Warum erzählst du mir nicht einfach, was drin steht?“
„Das, äh, ist kompliziert. Sagt mal, habt ihr beide morgen Abend Zeit? Gut! Ich werde euch dann alles erklären. Um sieben vor der Katharinenkirche?“
Ich erhob mich. Beide folgten mir misstrauisch mit den Augen. Ich konnte ihre Fragen spüren. Verena senkte den Kopf und blickte mich durch ihre dichten Wimpern an. Mir fiel wieder ein, dass sie das immer tat, wenn sie unsicher wurde oder sexuell erregt war. „Was ist jetzt mit diesem Brief?“
Auf diese Frage hatte ich gewartet. „Verena, kann ich dich einen Moment unter vier Augen sprechen? Ja? Bitte! Es dauert auch nicht lange.“
Max sah aus, als habe er etwas dagegen, aber er räusperte sich nur und verdrehte die Augen. Verena streifte ihre Jacke über und ging auf den Ausgang zu. Als ich die Türklinke in der Hand hielt, sah ich die fragenden Blicke ihrer Freundinnen, die uns in die Dunkelheit folgten.
Wir gingen schweigend auf den Adlerflychtplatz, auf dem ich einmal als Vierjähriger meiner Mutter davongelaufen war. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass das das erste Angsterlebnis ist, an das ich mich erinnern kann. Und jetzt war Verena bei mir. Wir setzten uns auf eine der Kinderwippen, die mit dünnem Frost überzogen dastanden und Dinosauriergerippen glichen.
Verena und ich. Es war verrückt. Plötzlich war ich 14 Jahre älter als sie, und sie wusste nicht, wie sehr ich sie geliebt hatte. Wir begannen zu wippen, begleitet von dem leisen Quietschen der Scharniere, das wie eine Fledermaus um uns durch die Bäume jagte. Ich hätte am liebsten gar nichts gesagt, aber sie stieg plötzlich vom Sitz und ließ mich unsanft auf den nur wenig dämpfenden Autoreifen knallen. „Also, was steckt hinter all diesen verrückten Dingen?“
Ich versuchte vergeblich, in der Dunkelheit ihren Gesichtsausdruck zu deuten. Vorsichtig sagte ich: „Das meiste steht in meinem Brief. Ich möchte, dass du ihn morgen liest, ohne deine Freundinnen und ohne Max. Ich werde morgen Abend auch nicht zu eurem Treffen kommen. Aber ich bitte dich: Geh du hin. Triff dich mit Max. Sag ihm … was weiß ich … ich hätte deine beste Freundin ausgequetscht, dadurch wäre ich an all die Detailinformationen gekommen, und letztlich hätte ich dir eine Versicherung andrehen wollen. Wichtig ist, dass Max mich möglichst schnell vergisst und unter der Kategorie ‚Verrückter‘ abbucht. Tu mir den Gefallen und sprich mit ihm. Es ist für ihn, für dich und für mich von entscheidender Bedeutung.“
Verena war jetzt ernsthaft zornig: „Warum sollte ich das alles machen? Ich kenne ihn ja gar nicht!“
Meine Stimme hatte auf einmal diesen tiefen, eindrücklichen Klang, mit dem ich sie früher immer betört hatte: „Das steht in meinem Brief! Lies ihn, bitte, morgen. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen!“
Sie trat auf mich zu. „Und du? Wer bist du?“
„Wer weiß, vielleicht bin ich tatsächlich ein Prophet?“
Ich versuchte, die gedrückte Stimmung wegzulachen, aber es gelang mir nicht. Verena stand im Halbdunkel eines Baumes, der das Licht der Straßenlampen abhielt, und starrte mich an. Mit einem bohrenden Blick. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sanft flüsterte ich: „Weißt du, was der griechische Schriftsteller Lukian den Gott Amor einmal sagen lässt? ‚Wenn ich euch auf das Schöne aufmerksam mache, was tu ich daran so Unrechtes? Lasst ihr euch davon hinreißen, so ist das eure Sache; was gebt ihr mir die Schuld?‘ Vielleicht ist es das, was ich will: Ich möchte dich auf die Schönheit dieses Lebens aufmerksam machen.“
„Ach, du bist also Amor!“
„Nein, natürlich nicht! Obwohl, warum nicht? Ich möchte jedenfalls gerne einer sein, der Sehnsüchte erfüllt. Lass es auf einen Versuch ankommen.“
„Also, Amor, ich werde deinen Brief lesen, und vielleicht gehe ich auch morgen zu diesem Treffen, aber ich hoffe, dass ich bis dahin eine gute Erklärung für das alles habe.“
„Das hoffe ich auch“, sagte ich und verschwand in der Nacht.
1635 Ein älterer Page betrat das Atelier und erschrak, als er Van Dyck und mich in Decken gehüllt auf zwei Kisten sitzen sah. Der Künstler wollte ihn erst brüsk hinausschicken, dann besann er sich: „Robin, zieh deine Jacke aus.“
Der Page zögerte.
„Ich brauche sie für mein Bild. Na, mach schon! Deine Jacke wird in die Ewigkeit eingehen.“
Van Dyck nahm dem betreten dastehenden Pagen die Bekleidung ab, streifte sie mir über und schob mich hinter die Staffelei.
„Sei nicht böse, aber wenn ich bis zwölf Uhr mit deinem Bild fertig sein will, nein, fertig werden soll, dann muss ich noch ein bisschen arbeiten. Du kannst ja dabei weitererzählen. Genau, da hast du gestanden. Nimm bitte den Kopf nicht ganz so hoch, vorher war das Kinn tiefer. Ja, es muss ein unsicherer und trotzdem zielgerichteter Blick in die Vergangenheit sein. Dort kommt alles her. Dort scheint das Licht, das unsere Gegenwart erhellt. Du bist derjenige, der weiß, dass hinter dem Horizont des Vergangenen ein unendlicher Reichtum wartet, von dem wir möglichst viel in die Gegenwart retten sollten, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Ja, jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Stell dich etwas breitbeiniger hin; wer die Vergangenheit kennt, der ist gut geerdet. Ja. Das linke Bein ein bisschen vor, als drängte es dich, wieder zurückzukehren in die leuchtende Historie. Genau, der ganze Schritt muss Hoffnung ausdrücken. Und zugleich hält dich die Gegenwart gefangen, denn du weißt ja, dass man nicht zurück kann. Keiner kann das.“
„Ich kann es!“
Van Dyck strich sich über die Nase: „Stimmt. Merkwürdig, mein Verstand hat das einfach ignoriert. Irgendwie wollen wir das, was wir nicht glauben können, auch nicht wahrhaben. So, wie du jetzt vor mir posierst, habe ich eben in dir wieder ein gewöhnliches Modell gesehen. Verzeih. Erzähl mir, was in diesem Brief stand, den du an deine ehemalige Mätresse geschrieben hattest.“