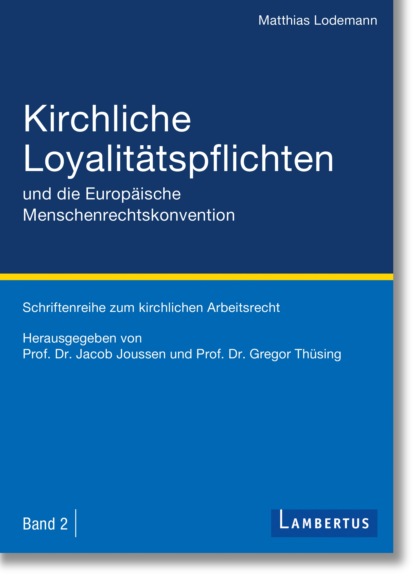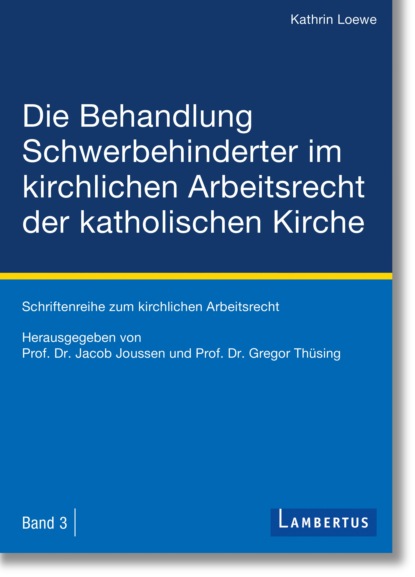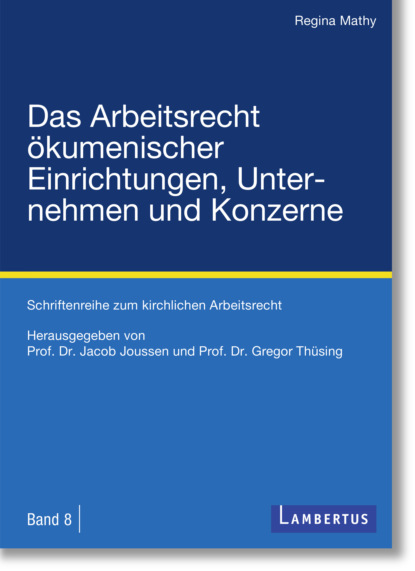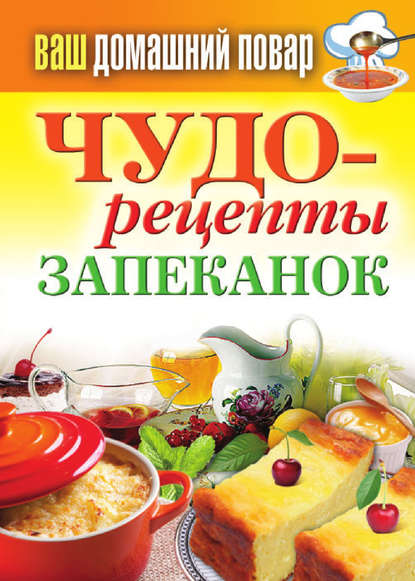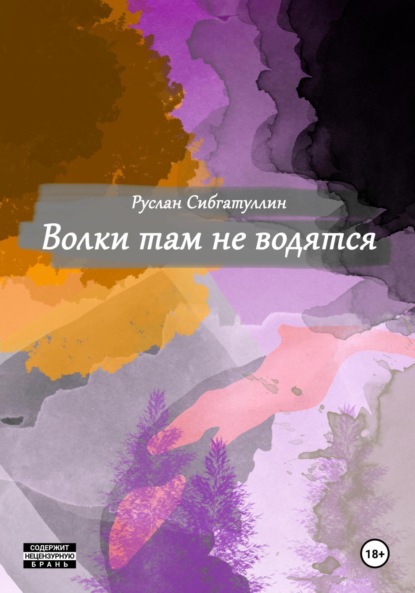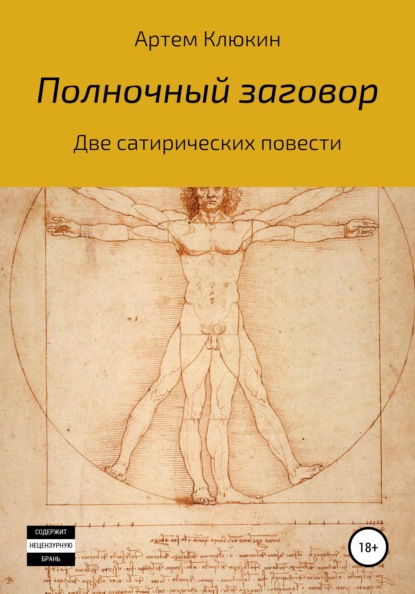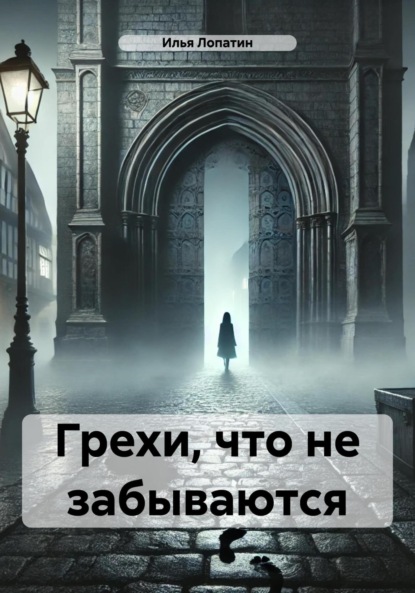Die Integrationsfestigkeit des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts im Rahmen der Kündigung von Arbeitsverhältnissen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG

- -
- 100%
- +
III. Kontrolle des IR-Urteils des BAG „primär“ am Maßstab der Grundrechte des deutschen Grundgesetzes
IV. Ergebnis
B. Durchbrechung des unionsrechtlichen Anwendungsvorrangs zugunsten des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts in der Rechtssache IR
I. Das IR-Urteil des BAG vom 20. Februar 2020 als Gegenstand einer bundesverfassungsgerichtlichen Kontrolle
1. Verfassungsbindung der Gerichte bei der Anwendung von Umsetzungsnormen
2. Unionsrechtlich determinierte Verfassungsverstöße im IR-Urteil des BAG
3. Mittelbar kontrollierbarer unionsrechtlicher Hoheitsakt
4. Ergebnis
II. Anwendung der Grundrechtskontrolle im Fall IR
III. Anwendung der Identitätskontrolle im Fall IR
1. Identitätskontrolle gem. Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 1 GG
a) Materielle Reichweite des Gewährleistungsbereichs des Art. 1 Abs. 1 GG
aa) Menschenwürdegehalt des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts nach der Rechtsprechung
bb) Menschenwürdegehalt des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts nach Ansicht der Literatur
cc) Eigener Standpunkt
(1) Menschenwürdekern der Religionsfreiheit
(2) Verknüpfung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts mit der Religionsfreiheit
(3) Menschenwürdegehalt des religiösen Selbstbestimmungsrechts als Ausprägung der Religionsfreiheit
(aa) Das Recht der Kirche, ein christliches Ethos zu definieren
(bb) Verbindung der Gläubigen in einer kirchlich organisierten Organisationsstruktur zwecks arbeitsteiliger Verwirklichung von Religionszielen
(cc) Selbstbestimmte personelle Zusammensetzung einer Arbeitsgemeinschaft der Gläubigen
(dd) Recht der Kirche zur Kündigung von Arbeitsverhältnissen aufgrund von Verstößen gegen Loyalitätsanforderungen
dd) Zwischenergebnis
b) Persönliche Erstreckung der Menschenwürde
aa) Rechtsprechung
bb) Auffassung der Literatur
cc) Eigener Standpunkt
(1) Die glaubensangehörigen Dienstnehmer als Träger der Menschenwürde
(2) Die Kirche als Trägerin der Menschenwürde
(3) Auswirkung auf die Beschwerdebefugnis
dd) Zwischenergebnis
c) Eingriff in das Menschenwürdeprinzip durch die Prüfungsvorgaben des EuGH in der Rechtssache IR
aa) Das Recht der Kirche, ein christliches Ethos zu definieren
bb) Verbindung der Gläubigen zur arbeitsteiligen Verfolgung des katholischen Sendungsauftrags in einer kirchlich organisierten Dienstgemeinschaft
cc) Selbstbestimmte personelle Besetzung der Glaubensausübungsgemeinschaft
(1) Eingriff durch das Merkmal der „Art“ und „Umstände“ der ausgeübten Tätigkeit
(2) Eingriff durch das Merkmal „wesentliche“
(3) Eingriff durch das Merkmal „rechtmäßige“
(4) Eingriff durch das Merkmal „gerechtfertigte“
aa) Das Merkmal „gerechtfertigte“ mit Öffnungswirkung
bb) Das Merkmal „gerechtfertigte“ ohne Öffnungswirkung
(5) Eingriff durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
d) Vorlageverpflichtung des BVerfG gem. Art. 267 Abs. 3 AEUV
e) Ergebnis
2. Identitätskontrolle gem. Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG i.V.m. Art. 38 Abs. 1 GG
a) Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht als identitätsprägende Grundentscheidungen des deutschen Gesetzgebers
aa) Historische Vorverständnisse
bb) Kulturelle Vorverständnisse
cc) Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels
dd) Zwischenergebnis
b) Demokratische Legitmaton
c) Reichweite der identitätsrelevanten Grundentscheidung
d) Verletzungen der Verfassungsidentität durch das IR-Urteil
aa) Keine prinzipielle Aberkennung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts
bb) Fachgerichtliche Aushöhlung des materiellen Gehalts des Selbstbestimmungsrechts?
(1) Anknüpfungspunkt: „[…] nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos […]“
(2) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
cc) Zwischenergebnis
e) Beschwerdebefugnis
f) Vorlageverpflichtung des BVerfG gem. Art. 267 Abs. 3 AEUV
g) Ergebnis
IV. Anwendung der Ultra-vires-Kontrolle im Fall IR
1. Kompetenzverstoß des EuGH in der Rechtssache IR
2. Hypothetische Kompetenzüberschreitung „praktisch kompetenzbegründend“
3. Offensichtlichkeit des hypothetischen Kompetenzverstoßes
a) Missachtung des Achtungsgebots und des Beeinträchtigungsverbot des Art. 17 Abs. 1, Abs. 2 AEUV
aa) Fehlende Begründungstiefe
bb) Fehlerhafte Bewertung der Verweisung des Gesetzgebers in Erwägungsgrund Nr. 24 der RL 2000/78/EG
cc) Verstoß gegen die unionsrechtliche Normenhierarchie
dd) Ersatz eines Freiheitsrechts durch den Diskriminierungsgrundsatz
ee) Gebot, nationales Recht unangewendet zu lassen
ff) Kein Eingriff in die Autorität des Heiligen Stuhls
b) Zwischenergebnis
4. Beschwerdebefugnis
5. Vorlageverpflichtung des BVerfG
6. Ergebnis
C. Die integrationsfesten Bestandteile des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber im Rahmen der Kündigung von Arbeitsverhältnissen
I. Umfang
1. Integrationsfestigkeit unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde
a) Bildung und Verkündung des Ethos
b) Arbeitsteilige Verbindung der Gläubigen zu einer Dienstgemeinschaft
c) Prinzipielle Freiheit der kirchlichen Arbeitgeber bei der personellen Besetzung der Dienstgemeinschaft von staatlicher Einflussnahme
2. Integrationsfestigkeit unter dem Gesichtspunkt des Demokratieprinzips
3. Integrationsfestigkeit unter dem Gesichtspunkt der Kompetenzgrenze
II. Bedeutung für die Kündigungspraxis kirchlicher Arbeitgeber
1. Arbeitsgerichtliche Kontrolle
2. Normierung von Loyalitätsanforderungen
a) Grundsätzliches
b) Die Ungültigkeit der Ehe als Kündigungsgrund
c) Die Konfessionszugehörigkeit als Einstellungsvoraussetzung
d) Der Kirchenaustritt als Kündigungsgrund
e) Fazit
§ 6 Ergebnisse
A. Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber im Rahmen der Kündigung von Arbeitsverhältnissen in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland
B. Unionsrechtliche Einwirkung auf das Selbstbestimmungsrecht kirchlicher Arbeitgeber im Rahmen der Kündigung von Arbeitsverhältnissen
C. Der Mehrebenenkonflikt im Anwendungsbereich der RL 2000/78/EG
D. Möglichkeiten zur Harmonisierung des Mehrebenenkonflikts
I. Unionsrechtskonforme Auslegung
II. Auswirkung der Recht auf Vergessenwerden-Rechtsprechung des BVerfG
E. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Durchbrechung des unionsrechtlichen Anwendungsvorrangs
I. Identitätskontrolle
II. Ultra-vires-Kontrolle
F. Integrationsfestigkeit des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber im Rahmen der Kündigung von Arbeitsverhältnissen
I. Integrationsfestigkeit des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber als Bestandteil der Verfassungsidentität gem. Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
II. Integrationsfestigkeit gem. Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG i.V.m. Art. 38 Abs. 1 GG
III. Integrationsfestigkeit des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber als Kompetenzgrenze der EU
G. Ausblick
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Lebenslauf
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2020/2021 von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als Dissertation angenommen. Ihr Text wurde im August 2020 abgeschlossen. Rechtsprechung und Literatur wurden nach Möglichkeit bis einschließlich Dezember 2020 berücksichtigt.
Mein großer Dank gilt zunächst meinem Doktorvater, Prof. Dr. Gregor Thüsing LL.M. (Harvard), der die Bearbeitung dieses wunderbaren Themas anregte, den für die Wissenschaft notwendigen Freiraum ließ und stets ein offenes Ohr für meine Fragen hatte. Die Bearbeitung einer so aktuellen Fragestellung war durch seine schnelle gutachterliche Würdigung überhaupt erst möglich. Prof. Dr. Raimund Waltermann danke ich sehr für die ebenso außergewöhnlich zügige Erstellung des Zweitgutachtens und damit verbundene Unterstützung meines Promotionsvorhabens. Bedanken möchte ich mich zudem bei PD Dr. Gerrit Forst LL.M. (Cambridge) als Vorsitzenden meiner Prüfungskommission.
Ich bedanke mich ferner bei meinem Doktorvater und Prof. Dr. Jacob Joussen für die Aufnahme dieser Arbeit in ihre Schriftenreihe.
Darüber hinaus danke ich der Konrad-Adenauer-Stiftung, deren Promotionsförderung mir die notwendige Freiheit einräumte, mich voll und ganz der Beantwortung der vorliegenden Fragestellung zu widmen. In diesem Zusammenhang danke ich meinem Doktorvater sowie Prof. Dr. Constanze Janda für die Unterstützung meines Stipendiums.
Für das gründliche Lektorat und das Stellen der richtigen Fragen bedanke ich mich von Herzen bei meinem Vater Dr. Christoph Förster, meinem Bruder Julius Förster und meiner Freundin Mia Alikhah LL.M. Für zahlreiche Gespräche und die geduldige Begleitung des gesamten Projekts „Doktorarbeit“ danke ich meinem Ehemann Hendrik Völkerding. Für die große emotionale Unterstützung danke ich vor allem meiner Mutter Katrin Förster und meiner lieben Großmutter Irmhild Schlummer. Dank diesen Menschen wird Unmögliches möglich. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.
§ 1 Einleitung
A. Thematische Hinführung und Problemaufriss
Das Wort „Integration“ entspringt dem lateinischen Begriff „integratio“, mittels dessen der Vorgang des „Vollwerdens“, des „Ganzwerdens“ oder der „Erneuerung“ ausgedrückt wird.1
Der vom BVerfG verwendete Begriff der „Integrationsfestigkeit“2 bezeichnet das Gegenteil: Das BVerfG vertritt die Auffassung, die Öffnung des Grundgesetzes zugunsten des europäischen Rechts unterliege Grenzen, die ein „Voll- und Ganzwerden“ der Bundesrepublik mit Europa ausschließen würden.3 Obwohl die vom BVerfG aufgezeigten Grenzen gem. Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG im „Europaartikel“4 selbst angelegt sind, ist diese Rechtsprechung dem teils heftig formulierten Vorwurf ausgesetzt, den „Integrationsauftrag“5 des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG zu verletzen.6
Dass dem „kirchlichen Arbeitsrecht“7 eines Tages eine besondere Rolle im Zusammenhang mit der Frage des Verhältnisses des deutschen (Religions-) Verfassungsrechts und des Primats des Unionsrechts zukommen könnte, wurde in der rechtswissenschaftlichen Literatur im Zusammenhang mit der Einführung der RL 2000/78/EG frühzeitig erkannt.8 Bereits im Jahr 1985 hatte das BVerfG im Stern-Urteil entschieden, dass Kündigungsentscheidungen kirchlicher Arbeitgeber aufgrund von Verstößen gegen kirchliche Loyalitätsanforderungen durch Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV vor einer umfassenden arbeitsgerichtlichen Kontrolle geschützt sind.9 Diesen Grundsatz hat das Gericht 2014 im Chefarzt-Urteil gerade in Bezug auf konfessionell differenzierende Loyalitätsanforderungen mit Nachdruck bekräftigt.10 Über 30 Jahre lang wurde das Prinzip der eingeschränkten arbeitsgerichtlichen Überprüfbarkeit von Kündigungsentscheidungen der häufig als „zweitgrößter Arbeitgeber“11 der Bundesrepublik bezeichneten Kirchen von den Institutionen der EU nicht angetastet.
Im Jahr 2018 entschied der EuGH dann gleich zweimal über den Umfang der gerichtlichen Prüfung von Entscheidungen kirchlicher Arbeitgeber. Das eine Mal ging es um die Konfessionszugehörigkeit als Tätigkeitsvoraussetzung im Dienst der evangelischen Diakonie (Egenberger12) und das andere Mal um die Kündigung aufgrund der Eingehung einer nach katholischem Kirchenrecht ungültigen Ehe (IR13). Die Anwendung der europäischen RL 2000/78/EG14 verlangt nach Auffassung des Gerichtshofs hinsichtlich der den Arbeitgeberentscheidungen zugrunde liegenden kirchlichen Loyalitätsanforderungen eine umfassende, objektive Kontrolle durch staatliche Gerichte.15 Auf Grundlage der EuGH-Urteile entschied sodann das BAG jeweils zu Lasten der kirchlichen Arbeitgeber.16 Die evangelische Diakonie legte in der Rechtssache Egenberger gegen das BAG-Urteil vom 25. Oktober 2018 am 16. März 2019 eine Verfassungsbeschwerde (2 BvR 934/19) ein und machte geltend, die der Entscheidung zugrunde liegende Rechtsprechung des EuGH verletze integrationsfeste Gehalte der Verfassung und finde daher keine Anwendung.17 Das Erzbistum Köln entschied sich aufgrund der zwischenzeitlich überarbeiteten katholischen Loyalitätsanforderungen gegen die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde in der Rechtssache IR.18
Folglich ist in absehbarer Zeit keine höchstrichterliche Beantwortung der Frage zu erwarten, ob das Selbstbestimmungsrecht kirchlicher Arbeitgeber bei der Kündigung von Arbeitsverhältnissen zu den „integrationsfesten“ Bestandteilen des Grundgesetzes zählt. Da aber die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache IR möglicherweise den Weg für weitere Verengungen der kirchlichen Freiheit geebnet hat, ist eine Klärung der Grenzen der unionsrechtlichen Beschränkungsmöglichkeiten mit Blick auf die etwa 1,3 Millionen19 kirchlichen Beschäftigungsverhältnisse sowohl von rechtlicher als auch von volkswirtschaftlicher Bedeutung.
B. Untersuchungsgegenstand
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob ein Mehrebenenkonflikt im Anwendungsbereich der RL 2000/78/EG zwischen den unionsrechtlichen Vorgaben und den verfassungsrechtlichen Besonderheiten der arbeitsgerichtlichen Kontrolle von Kündigungsentscheidungen kirchlicher Arbeitgeber vermieden werden kann. Für den Fall, dass Widersprüche zwischen den unionsrechtlichen Vorgaben und den Maßgaben, die das BVerfG in den Verfahren Stern und Chefarzt für die arbeitsgerichtliche Kontrolle in Kündigungsschutzverfahren getroffen hat, verbleiben, soll geklärt werden, auf welcher rechtlichen Grundlage sich Bestandteile des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber gegen unionsrechtlich determinierte Eingriffe behaupten können. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Beantwortung der bislang von Literatur und Rechtsprechung ungeklärten Frage, ob und in welchem Umfang das Selbstbestimmungsrecht kirchlicher Arbeitgeber speziell im Rahmen der Kündigung von Arbeitsverhältnissen zu der vom BVerfG für „integrationsfest“ erklärten Verfassungsidentität gem. Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG zählt und damit den unionsrechtlichen Anwendungsvorrang durchbricht.20 Insoweit betritt die Arbeit „verfassungsrechtliches Neuland“21.
C. Gang der Darstellung
Zur Bewältigung der Problemstellung nähert sich die Arbeit dem Mehrebenkonflikt in vier Kapiteln schrittweise sowohl auf nationalrechtlicher als auch auf unionsrechtlicher Ebene:
In § 2 wird zunächst ein Überblick über die Verankerung des Selbstbestimmungsrechts der kirchlichen Arbeitgeber im Grundgesetz gem. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV gegeben. Im Anschluss ist die Einordnung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts bei der Festlegung von Loyalitätsanforderungen und der Sanktionierung von Verstößen gegen diese Anforderungen im deutschen Recht Gegenstand näherer Betrachtung. Die Grundlagen des kirchlichen Dienstes werden im Hinblick auf das für die Fragestellung dieser Arbeit ausschlaggebende IR-Verfahren vornehmlich anhand der katholischen Dienstgemeinschaft erläutert. Das Kapitel schließt mit der Zusammenfassung und Bewertung der wesentlichen Aussagen des BVerfG in seinen Leitentscheidungen Stern und Chefarzt zur arbeitsgerichtlichen Kontrolle kirchlicher Kündigungsentscheidungen.
In § 3 soll das Verhältnis des europäischen Rechts zum kirchlichen Selbstbestimmungsrecht bei der Kündigung von Arbeitsverhältnisses untersucht werden. Die Analyse des Art. 17 Abs. 1 AEUV, der die Achtung des mitgliedstaatlichen Status der Religionsgemeinschaften gebietet und dessen Beeinträchtigung durch Unionsrechtsakte verbietet, dient dabei als primärrechtlicher Schlüssel zur Bestimmung des Verhältnisses des Unionsrecht zum deutschen Religionsverfassungsrecht. Es ist zu klären, inwiefern die Auslegung des Art. 4 Abs. 2 RL 2000/78/EG durch den EuGH in den Rechtssachen Egenberger und IR primärrechtskonform war. Unter Zugrundelegung der Ergebnisse des § 2 können Widersprüche zwischen der unionsrechtskonformen Auslegung des § 9 AGG durch das BAG und den Vorgaben des BVerfG aus den Leitentscheidungen Stern und Chefarzt ermittelt werden. Auch soll gezeigt werden, ob die Rechtsprechung des EuGH dem BAG auch eine Entscheidung zugunsten des kirchlichen Arbeitgebers erlaubt hätte.
In § 4 folgt eine vertiefte Analyse des Verhältnis des deutschen Verfassungsrechts zum europäischen Recht. Eine Gegenüberstellung der Perspektiven des EuGH und des BVerfG zum Anwendungsvorrang des Unionsrechts soll zur Schärfung des Bewusstseins für mögliche Konfliktlagen beitragen. Die vorliegende Arbeit strebt eine Systematisierung der Grenzdogmatik des Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG an, die die Bestimmung der Integrationsfestigkeit des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber objektivieren soll. Schwerpunktmäßig sollen hierfür die tatbestandlichen Voraussetzungen einer erfolgreichen Identitätskontrolle und einer Ultra-vires-Kontrolle erarbeitet werden. Die Arbeit geht insbesondere der Frage nach, wie sich die integrationsfeste „Verfassungsidentität“ bestimmen lässt.
In § 5 werden die Anknüpfungspunkte und Grenzen einer möglichen Harmonisierung des Mehrebenenkonflikts analysiert. Im Falle verbleibender Widersprüche zwischen den verfassungsrechtlichen und den unionsrechtlichen Vorgaben werden die in § 4 gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um zu klären, inwiefern der Anwendungsvorrang des Unionsrechts im Fall IR hätte durchbrochen werden können. Der Schwerpunkt liegt auf der Beantwortung der Frage, in welchem Umfang das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen bei der Kündigung von Arbeitsverhältnissen der Verfassungsidentität zuzuordnen ist.
1Stowasser, S. 377 Stichworte: „integratio“ und „integrare“; siehe auch Smend, Staatsrechtliche Abhandlungen, 4. Aufl., S. 482: „Das Wort meint ursprünglich die Wiederherstellung, dann aber überhaupt die Herstellung oder Entstehung einer Einheit oder Ganzheit aus einzelnen Elementen, so daß die gewonnene Einheit mehr als die Summe der vereinigten Teile ist.“ Vgl. zur Geschichte der Verwendung des Begriffs im Staatsrecht König, Übertragung von Hoheitsakten, S. 34.
2BVerfGE 123, 267, 350 und 353 (Lissabon); BVerfGE 140, 317, 334 Rn. 36 (Haftbefehl-II); BVerfGE 134, 366, 389 Rn. 31 (OMT-Vorlagebeschluss); BVerfGE 142, 123, 186 Rn. 115 (OMT-Urteil); BVerfGE 151, 202, 286 Rn. 119 (Bankenunion); BVerfG v. 05.05.2020 – 2 BvR 859/15 u.a., NJW 2020, 1647, 1649 Rn. 101 (PSPP-Urteil).
3BVerfGE 123, 267, 343 (Lissabon): „Mit der sogenannten Ewigkeitsgarantie wird die Verfügung über die Identität der freiheitlichen Verfassungsordnung selbst dem verfassungsändernden Gesetzgeber aus der Hand genommen. Das Grundgesetz setzt damit die souveräne Staatlichkeit Deutschlands nicht nur voraus, sondern garantiert sie auch.“
4Siehe König, Übertragung von Hoheitsrechten, S. 138.
5Siehe BVerfGE 123, 267, 352 (Lissabon); BVerfGE 140, 317, 341 Rn. 49 (Haftbefehl-II); Weiß, JuS 2018, 1046, 1047 ff.; Calliess, NVwZ 2019, 684, 685 f., jeweils m.w.N.
6Siehe etwa Wegener, VerfBlog. v. 05.05.2020. Laut Wegener offenbare das PSPP-Urteil, „[…] eine an Verschrobenheit grenzende Weltferne und Selbstüberschätzung […], von der man trotz aller gegenteiligen Anzeichen bis zum Schluss hoffen musste, sie möge dem Gericht und uns allen erspart bleiben.“ Prantl bezeichnete das BVerfG gar als „Staatsgefährder“, siehe Prantl, Süddeutsche.de v. 09.03.2020.
7Gemeint sind die Modifikationen des staatlichen Arbeitsrechts, die der verfassungsrechtlichen Sonderstellung der Kirche Rechnung tragen, siehe auch Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 1 f.
8Siehe bspw. Müller-Volbehr, Europa und das Arbeitsrecht der Kirchen; Hanau/Thüsing, Europarecht und kirchliches Arbeitsrecht; Schäfer, Das kirchliche Arbeitsrecht in der europäischen Integration; Kehlen, Europäische Antidiskriminierung; Reichegger, Auswirkungen der RL 2000/78/EG; Triebel, Das europäische Religionsrecht; Groh, Einstellungs- und Kündigungskriterien vor dem Hintergrund des § 9 AGG; Plum, Tendenzschutz; Fink-Jamann, Antidiskriminierungsrecht; Schoenauer, Die Kirchenklausel des § 9 AGG.
9BVerfGE 70, 138, 167 f. (Stern).
10BVerfGE 137, 273, 316 Rn. 118 f. (Chefarzt).
11Siehe etwa Fremuth, EuZW 2018, 723, 723 f.; Geismann, Gleichgeschlechtliche Ehe und kirchliches Arbeitsverhältnis, S. 42; Trebeck, ArbRAktuell 2020, 106. Die Bezeichnung ist allerdings irreführend, denn die Vielzahl der den Kirchen zugeordneten Einrichtungen kann schwerlich als „ein“ Arbeitgeber betrachtet werden, siehe auch Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 8. Aufl., Vorwort S. IX.
12EuGH (Große Kammer) v. 17.04.2018 – C-414/16 (Egenberger gegen Evang. Diakonie e.V.), EU:C:2018:257.
13EuGH (Große Kammer) v. 11.09.2018 – C-68/17 (IR gegen JQ), ECLI:EU:C:2018:696.
14ABl. EG L 303/16.
15EuGH (Große Kammer) v. 17.04.2018 – C-414/16 (Egenberger gegen Evang. Diakonie e.V.), EU:C:2018:257 Rn. 63 ff.; EuGH (Große Kammer) v. 11.09.2018 – C-68/17 (IR gegen JQ), ECLI:EU:C:2018:696 Rn. 45 f.
16BAG v. 25.10.2018 – 8 AZR 501/14, NZA 2019, 455; BAG v. 20.02.2019 – 2 AZR 746/14, NZA 2019, 901.
17Siehe Pressemitteilung der EKD-Präsidentin v. 19.03.2019, abrufbar unter: https://www.ekd.de/diakonie-klagt-vor-bundesarbeitsgericht-44274.htm (zuletzt aufgerufen am 21.12.2020).
18Siehe Pressemitteilung vom 02.07.2019, abrufbar unter: https://www.erzbistum-koeln.de/news/Keine-Verfassungsbeschwerde-im-Chefarzt-Fall/ (zuletzt aufgerufen am 21.12.2020): „Maßgeblich hierfür ist insbesondere der Umstand, dass der in Rede stehende Fall aktuell keine arbeitsrechtliche Relevanz mehr hat, da er nach heute geltendem kirchlichen Arbeitsrecht anders zu beurteilen wäre. Die katholische Kirche wird allerdings möglicherweise vom Bundesverfassungsgericht Gelegenheit erhalten, ihre Rechtsauffassung zu den auch aus ihrer Sicht klärungsbedürftigen Grundsatzfragen des Verhältnisses von Religionsverfassungsrecht und Unionsrecht durch eine Stellungnahme in das Verfahren ‚Egenberger‘ der evangelischen Kirche einzubringen, das zurzeit beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist.“