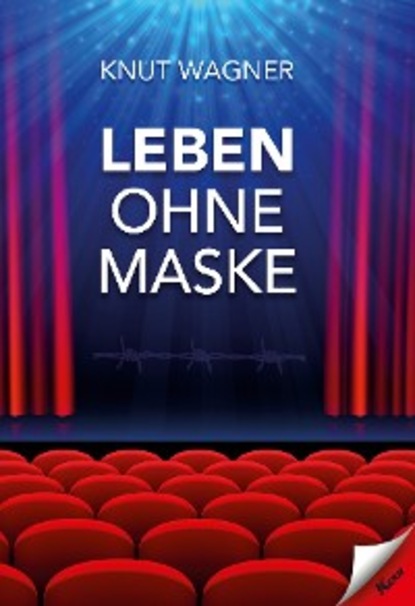- -
- 100%
- +
Während des Mittagessens lernte Wolfgang auch Heidis Großvater kennen, der ihm am Nachmittag sein einstiges Imperium zeigte.
„Vor hundert Jahren wurde der Betrieb gegründet, und vor zehn Jahren musste ich die Zimmerei und das Sägewerk aufgeben“, sagte Oskar Anschütz und schob das schwere Holztor des Sägewerkes, das auf rostigen Metallrollen lief, mit einem Ruck in der Mitte auseinander.
Heidis Großvater war groß und kräftig. Er hatte ein rundes Gesicht, tiefbraune Augen und einen grauen Stoppelbart wie Hemingway, und sein kerzengerader Gang ließ vermuten, dass er einst ein guter Turner gewesen war. Zur Feier des Tages trug er eine schwarze Anzughose, ein langärmliges, weißes Hemd und eine schwarze Weste mit einem grau-glänzenden Rückenteil aus Seide.
Seinen Rundgang durch die kühle, schummrige Dunkelheit der Schneidmühle begann er am Gatter, dem Herzstück des Sägewerks, das nur noch ab und an schlug, wenn Oskar Bamberg für gute Freunde oder Nachbarn aus großen, dicken Stämmen Bohlen schnitt.
Einige Meter hinterm Gatter befand sich ein viereckiger Einstieg, der hinunter in den Spänebunker führte. Der Spänebunker war dunkel und gruselig, denn nur von oben fiel Licht ein. Und Wolfgang, der an Höhenangst litt, war beeindruckt, wie Oskar Anschütz mit seinen 69 Jahren die schmale, lange Holzleiter im Zimmermannsgang hinabstieg. Er war unerschrocken, und Angst vor Ratten, die Wolfgang beim Abstieg in das dunkle Loch befiel, schien er nicht zu haben.
Nachdem der Spänebunker inspiziert worden war, folgte Wolfgang Heidis Großvater in einen nach Hobelspänen riechenden, großen Raum, durch dessen Dielenritzen das Grün der Wiese schimmerte und der Bach, der an der Mühle vorbeifloss, deutlich zu hören war. „Auf dieser Maschine“, sagte Oskar Anschütz, „hoble ich noch heute Fußbodenbretter für die Leute – so nebenbei.“ Anfang der dreißiger Jahre sei diese Spezialhobelmaschine das Modernste gewesen, was es auf diesem Gebiet gegeben habe, wusste er zu berichten. Fürs Hobeln der Fußbodenbretter sei nur noch ein Arbeitsgang nötig gewesen. Unter- und Oberseite wurden erstmals gleichzeitig bearbeitet.
Und dass Oskar Anschütz zur gleichen Zeit zwei Francis-Turbinen in Betrieb genommen habe, erfüllte ihn noch immer mit Stolz. Er habe einen Kunstgraben angelegt, um die Wasserkraft besser nutzen zu können, und mit den zwei Turbinen habe er sich unabhängig von der Stromversorgung gemacht, die während des Krieges und in der Nachkriegszeit oft zusammengebrochen sei.
Oskar Anschütz griff nach einem großen Hebel an der Wand und sagte: „Den brauchte ich nur runterziehen, und Strom für die Maschinen, das Licht im Haus und im Stall war da. Wir waren unabhängig von dem, was geschah. Und durch die Landwirtschaft, die wir hatten, konnten wir uns selbst versorgen. So kamen wir über die schlechten Zeiten, ohne Hunger zu leiden.“
Mit jedem Wort, das dem wortkargen Oskar Anschütz über die Lippen kam, mit jedem Schritt, den Wolfgang in eine ihm unbekannte, nach Harz, Sägespänen und Rinde riechende Welt tat, wurde er in die wechselvolle Geschichte der Schneidmühle hineingezogen, die im Jahre 1867 begonnen hatte. Da nämlich hatte der Dielenschneider Christian Anschütz sich mit seiner zweiten Frau Johanna Regina und sechs Kindern in Silberberg niedergelassen und aus einer alten Ölmühle eine konkurrenzfähige Schneidmühle gemacht.
Der Rundgang durch die schummrige, spinnwebige Dunkelheit der Schneidmühle endete, wo er begonnen hatte: am Gatter, dem Herz des Sägewerks, das kaum noch schlug. Denn 1957, in sozialistischer Zeit, ließen sich Zimmerei und Sägewerk nicht mehr halten. Dem Privateigentum an Produktionsmitteln wurde zu Walter Ulbrichts Zeiten der Garaus gemacht, und Betriebe in der Größenordnung von der Schneidmühle Anschütz wurden verstaatlicht oder kaputtgemacht.
„Um das Unternehmen zu retten, mussten wir die Produktion umstellen und die Beschäftigten-Zahl auf unter zehn herunterfahren“, sagte Oskar Anschütz und trat, zusammen mit Wolfgang, aus dem dunklen Tor der Schneidmühle in das gleißende Sonnenlicht dieses heißen Augusttages.
Sie standen auf dem leeren, kiesgrauen Holzplatz, auf dem sich früher unzählige Holzstapel getürmt hatten, und Heidis Großvater sagte: „Vor zehn Jahren bekam ich nicht mehr die Holzzuteilungen, die ich brauchte, und die Schneidmühle war nicht mehr zu retten.“
Er blickte auf die Stallungen, die sich zwischen der Schneidmühle und dem Wohnhaus befanden: „Früher holten wir das Langholz mit eigenen Fuhrwerken aus dem Wald, und neben der Schneidmühle betrieben wir eine große Landwirtschaft. Wir hatten Pferde und Kühe und Schweine. Und Geflügel sowieso. Aber seit der Kollektivierung der Landwirtschaft vor zehn Jahren ist das vorbei.“
Wolfgang hörte Heidi sprechen und während Oskar Anschütz an den Stallungen vorbei auf das Wohnhaus zulief, folgte Wolfgang Heidis Stimme. Er fand Heidi und Tante Lisa auf der Wiese hinterm Haus im Schatten eines alten Apfelbaums. Sie unterhielten sich laut. Theo saß am seichten Wasser des Baches. Er hielt eine Weidenrute in der Hand und tat, als würde er angeln.
Von der Wiese aus sah Wolfgang an der Rückseite der alten Schneidmühle hoch, und ihm kam die Schneidmühle wie eine Arche vor, die Oskar Anschütz über schwierige Zeiten wie Inflation und Weltwirtschaftskrise, Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit und das erste Jahrzehnt DDR gebracht hatte.
„Hat er dir erzählt, dass er vor der Inflation der reichste Mann im Dorf war?“, fragte Tante Lisa, die schwer im weichen Gras lagerte. „Nein“, sagte Wolfgang. „Er hat nur von einem kleinen, schwarzen Notizbuch gesprochen, in dem er damals genau festhielt, was er den elf Zimmerleuten an Wochenlohn zahlte.“
„Das kann ich dir zeigen!“ Lisa stand auf, zupfte sich die trockenen Grashalme von ihrem Rock, und Wolfgang folgte ihr ins Kontor, in dem Lisbeth Stillmark gearbeitet, Rechnungen geschrieben und vielleicht auch Courths-Mahler gelesen hatte.
Das Kontor war klein. Vorm Fenster zum hinteren Garten stand ein großer, schwerer Schreibtisch. An der Wand links hing ein riesiger Stammbaum, auf dem die Anschützens bis ins sechste Glied lückenlos aufgeführt waren, und in die Wand rechts war ein Tresor eingelassen. Tante Lisa öffnete ihn und gab Wolfgang das kleine, schwarze Notizbuch zu lesen. Ein Wilhelm Möller bekam während der Inflationszeit Anfang Oktober 1923 vier Millionen Reichsmark als Wochenlohn, las Wolfgang. Anfang November waren es bereits 300 Milliarden 300 Millionen, die Oskar an Wilhelm Möller zahlte. Auch eine Ausgabe des Thüringer Hausfreunds vom 7. April 1923 wurde wie ein Heiligtum behandelt und im Tresor aufbewahrt. Im lokalen Anzeigenteil stand, dass der Zimmermeister und Sägewerksbesitzer Emil Anschütz infolge einer schweren Operation im vollendeten 60. Lebensjahr am 6. April 1923 gestorben sei. Und von historischem Wert, wie Wolfgang fand, war die Titelseite, auf der vermeldet wurde: „Eben erhalten wir ein Telegramm aus Moskau, nach dem Lenin an den Folgen eines Herzleidens gestorben ist. Mit ihm barst eine Säule, die das neue Rußland getragen hat. Sein richtiger Name war Wladimir Iljitsch Uljanow.“
Ein Tresor voller historischer Raritäten, dachte Wolfgang und gab Lisa die Zeitung und das schwarze Notizbuch zurück.
Durch das einzige Fenster des Kontors konnte Wolfgang sehen, wie Heidi auf der Wiese hinterm Haus mit Theo Fußball spielte, und Lisa sagte: „Wenn du genau wissen willst, wen du da zur Freundin hast, solltest du mal einen Blick auf diesen Stammbaum werfen.“
Wolfgang bestaunte die weitverzweigte Ahnenreihe, die den Platz einer halben Wand einnahm, und Lisa, die in der Verwandtschaft als die große Bewahrerin angesehen wurde, deutete auf den Namen ihres Ur-Ur-Großvaters Heinrich Anschütz, der am 7. Februar 1784 in Zella-Mehlis geboren und Kohlenbrenner gewesen war.
Sich intensiv mit dem Stammbaum der Anschützens zu beschäftigen hätte bedeutet, der Geschichte von Johann Heinrich Anschütz, seinem Sohn Christian und dessen Sohn Emil und dessen Sohn Oskar und dessen Kindern und Kindeskindern nachzugehen und sich eingehend mit dem Schicksal von Kohlenbrennern und Dielenschneidern, von Schneidmüllern und Zimmermeistern zu befassen. Aber dazu war keine Zeit an diesem Nachmittag. Denn in der grau gestrichenen Gartenlaube, die Oskar Anschütz vor Jahrzehnten selbst gezimmert und aufgestellt hatte, saßen bereits Heidi, Minna, Oskar, Onkel Rolf, Tante Herta, Onkel Fritz und der kleine Theo am Geburtstagstisch.
Als Tante Lisa und Wolfgang sich zu ihnen setzten, pustete Heidi die 22 Kerzen aus, die flackernd auf dem reich gedeckten Tisch standen, und schnitt zur Feier des Tages die Schwarzwälder Kirschtorte an. Bis in den späten Abend hinein wurde gefeiert und getrunken. Man probierte die Erdbeerbowle, die Minna gemacht hatte. Man trank Bier und prostete sich mit Schnaps zu. Man stieß mit Wein an und ließ die Sektkorken knallen.
Als Tante Lisa ihren Sohn, der total übermüdet war, ins Bett brachte, verließ auch Oskar Anschütz die Geburtstagstafel. Auch er ging ins Bett, obwohl es noch hell war. „Er geht zwar mit den Hühnern ins Bett. Aber morgens steht er nicht mit ihnen auf“, kommentierte Onkel Rolf Oskars vorzeitigen Aufbruch.
„Vor neun lässt er sich kaum blicken“, sagte Fritz. Und Rolf, der voller Häme gegen den Alten schien, wollte von Wolfgang unbedingt wissen, was Oskar Anschütz ihm beim großen Rundgang durch die Schneidmühle so erzählt hatte.
„Er hat mir erzählt, dass er noch heute auf der Spezialmaschine, die er Anfang der 30er-Jahre angeschafft hat, für die Leute Fußbodenbretter hobelt.“
„Und hat er dir auch gesagt, was er mit dem Geld macht?“
„Nein.“
„Das trägt er in den Konsum. Dafür kauft er sich Schokolade, die er heimlich isst, und Schnaps“, sagte Tante Herta erbost. Im Gegensatz zu Lisa war sie flachbrüstig, schielte leicht und hatte ein mausgraues Kostüm an, unter dem sie eine herrenhemdartige, hoch geschlossene Bluse trug.
„Vorgestern“, sagte Rolf, „hat sich Oskar den Kopf mit Kampferspiritus eingerieben, weil sein Eiswasser alle war. Und als er merkte, dass seine Kopfhaut zu brennen anfing, hat er geschrien, und ich habe ihm eine ganze Dose Panthenolspray auf den Kopf gesprüht.“
„Wie eine Frau lief Oskar den halben Tag mit seiner Kopfpackung herum“, sagte Onkel Fritz, und alle lachten.
„Er ist eben ein schrulliger, alter Mann“, sagte Lisa, die ihren Vater nicht weiter dem Gespött preisgeben wollte. Wolfgang sagte, dass er den Schneidmüller bewundere. Er besitze Charisma und sei für sein Alter noch unheimlich vital.
„Vital ist er“, sagte Onkel Rolf, „weil er sich geschont hat, seit ich ihn kenne.“
„Wenn wir auf der Wiese standen und Heu machten, lag er auf seinem Sofa, weil er angeblich die Hitze nicht vertrug. Aber wir mussten sie ertragen“, erzählte Onkel Fritz. „Und abends dann, wenn das Heu vom Wagen in die Scheune gegabelt werden musste, spielte er den starken Mann.“ „Komm, Mann“, sagte Tante Herta. „Es ist spät.“ Und Onkel Rolf gehorchte. Bevor er sich jedoch erhob, griff er nach einer dicken, schwarzen Zigarre und steckte sie in die aufgenähte Brusttasche seines kurzärmligen, karierten Campinghemds. „Wegzehrung“, sagte er lächelnd.
„Hast du gesehen, was für ein Nassauer er ist?“, sagte Fritz zu Wolfgang. Die Konkurrenz zwischen den Schwiegersöhnen war spürbar. Jeder der beiden fühlte sich zum Chef berufen. Aber der Alte gab die Zügel nicht aus der Hand.
Nachdem Onkel Rolf und Tante Herta gegangen waren, eröffnete Heidi ihrer Großmutter, ihrer Patentante und ihrem Patenonkel, dass sie sich im nächsten Jahr verloben und in zwei Jahren heiraten wolle.
Daraufhin sagte Lisa: „Mädchen, Mädchen, mach bloß die Augen auf, Heiraten ist kein Pferdekauf.“
„Wenigstens das Mittelstück passt“, meinte Fritz, schenkte Wolfgang Schnaps nach und prostete ihm zu.
Heidis Großmutter tat, als habe sie die frivole Bemerkung ihres Schwiegersohns nicht gehört, und sagte: „Als Oskar und ich uns das Jawort gaben, war ich 18 Jahre alt und im dritten Monat schwanger. Lisbeth kam am 10. September 1922 zur Welt.“
9. Kapitel
Als Heidi und Wolfgang am nächsten Vormittag wieder in Arnsbach eintrafen, wollte August Stillmark von Wolfgang unbedingt wissen, wie ihm der Alte gefallen habe. Heidi kam Wolfgangs Antwort zuvor: „Er hat ihn stark beeindruckt.“ Tatsächlich war Wolfgang fasziniert von Oskar Anschütz, weil er groß und kräftig war und einen Stoppelbart wie Hemingway hatte.
August Stillmark hingegen hasste seinen Schwiegervater und sagte: „Wenn der alte Schneidmüller mal stirbt, werde ich nicht zu seiner Beerdigung mitgehen, und mein Name wird auch nicht unter den trauernden Hinterbliebenen zu finden sein.“
Wolfgang wurde das Gefühl nicht los, dass August Stillmark alles unternahm, um seinen Schwiegervater abzuqualifizieren. Es schien, als wolle er dem Niedergang der Schneidmühle den rasanten Aufstieg einer PGH entgegensetzen, die er mit aufgebaut hatte, und Wolfgang hatte das Gefühl, als wolle August Stillmark ihm vor Augen führen, dass er mehr als sein Schwiegervater vorzuweisen habe. Denn von dem Sägewerk, in dem einst 21 Leute beschäftigt waren, war nichts als eine kleine Metallbude übrig geblieben, in der zwei Männer und eine Frau Kofferscharniere stanzten.
„Als ich beim alten Menz vor 13 Jahren als Werkzeugmacher anfing, waren wir drei Leute“, sagte August Stillmark zu Wolfgang. „Aber das war nur in den ersten drei Jahren der Fall. Dann stockten wir jedes Jahr die Personaldecke mehr und mehr auf, und da es sich herumgesprochen hatte, dass es bei uns gutes Geld zu verdienen gab, hatten wir ziemlichen Zulauf und konnten uns die besten Leute raussuchen. Jetzt sind wir 21 Mann. Mit uns geht es bergauf, und durch einen Anbau wollen wir die Werkstatt im nächsten Jahr modernisieren und erweitern.“
Bei Gelegenheit wolle er Wolfgang den Betrieb zeigen, in dem er als Werkzeugmacher und Technologe arbeite, sagte August Stillmark. An diesem Samstagvormittag wurde er nicht müde, Wolfgang gegenüber zu betonen, wie gefragt die Messerköpfe der Firma Menz seien, die er mit entwickelt habe.
Stunden später saß Louis Stillmark gedankenversunken auf der verwitterten, grünen Gartenbank, die an der Giebelseite des alten Holzschuppens stand, und Wolfgang setzte sich zu ihm.
Es war heiß an diesem frühen Nachmittag, und Heidi sagte vom Küchenfenster aus: „Heute Abend muss ich unbedingt zum Gießen auf den Friedhof gehen.“
Louis Stillmark, der trotz der Hitze ein langärmliges, weißes Hemd, eine anthrazitfarbene Strickjacke und gelbe, kariert gemusterte Hauslatschen anhatte, meinte plötzlich unvermittelt zu Wolfgang: „Ich hatte Pech mit meinen Frauen. Zwei Mal bin ich Witwer geworden.“
Im Alter von 60 Jahren habe er seine zweite Frau Karoline verloren. Sie habe es mit der Bauchspeicheldrüse gehabt und sei kurz darauf gestorben, sagte Louis Stillmark. Besonders tragisch aber empfand Wolfgang, was Louis Stillmark ihm über die Todesumstände seiner ersten Frau erzählte, und es störte ihn nicht, dass Heidis Großvater weit ausholte.
„Es war im ersten Weltkrieg“, sagte Louis Stillmark. „Ich war Kanonier. In Metz hatte ich als Ungedienter im März 1915 einrücken müssen, ab Februar 1916 hatte man uns ins Schlachtgetümmel an der Ostfront geworfen. Als unser Regiment bei der Offensive in Französisch Flandern Ende Mai 1918 eine strategisch wichtige Hügelkette erstürmte, bekam ich eine Woche später das Eiserne Kreuz zweiter Klasse und durfte zwei Wochen später auf Heimaturlaub fahren. Aber als ich nach Hause kam, erfuhr ich schon am Bahnfof, dass meine Frau am Tag zuvor beerdigt worden war.“
Louis Stillmark machte eine Pause. „Ich war einen Tag zu spät gekommen“, sagte er. Auguste, seine erste Frau, war an Influenza gestorben. Seine fünfjährige Tochter Minna war von einem Tag auf den anderen Halbwaise geworden.
„Glücklicherweise nahm ihre Patentante, deren Ehe kinderlos war, sie so lange zu sich, bis ich im Januar 1919 aus dem Militärdienst in Hersfeld entlassen wurde.“
Obwohl diese Geschichte fast 50 Jahre zurücklag, trieb es Louis Stillmark beim Erzählen noch immer die Tränen in seine hellblauen, vom grauen Star getrübten Augen.
Wenig später betrat August Stillmark den Hof und gesellte sich zu seinem Vater und Wolfgang. Er setzte sich in den Schatten der Halle und begann, die Sense zu dengeln, denn er hatte Tante Anna versprochen, ihr beim Mähen der Wiese zu helfen. Heidi sagte Tante Anna zu der alten Frau, obwohl sie mit Stillmarks nicht verwandt oder verschwägert war. Sie war eine gute Nachbarin, die schwer an Asthma litt.
Als August Stillmark mit dem Dengeln der Sense fertig war, setzte er sich zu Heidi, Wolfgang und Louis Stillmark, die schon mit dem Kaffeetrinken begonnen hatten. Der weiße Gartentisch, an dem sie saßen, stand unter einem alten Apfelbaum. Die ersten frühreifen Äpfel lagen wie Billardkugeln im sommerheißen Gras. Die Grillen zirpten laut, und unter dem dichten, großen Blätterdach des knorrigen Apfelbaums sitzend, konnte man hören, wie der Dachstuhl und die Ziegel vor Hitze knackten und knisterten.
Er könne kaum glauben, dass das Haus vor 40 Jahren gebaut worden sei, sagte Louis Stillmark. „Im Oktober 1926 hatten wir uns entschlossen, ein eigenes Haus zu bauen. Zu Weihnachten lag die Bauzeichnung vor, und im Februar, zu meinem 40. Geburtstag, hielt ich den Bauschein in den Händen, und dem Baubeginn im Frühjahr 1927 stand nichts mehr im Weg“, erzählte er. „Das Grundstück, das wir benötigten, hatte Karoline mit in die Ehe gebracht, und der Hausbau sollte insgesamt 9.100 Mark kosten.“
Bis zum Richtfest und dem Decken des Daches sei alles wie am Schnürchen gelaufen, berichtete Louis Stillmark. „Aber als das Haus im November 1927 bezugsfertig war, geriet ich in arge Bedrängnis. Und ich konnte die Handwerker-Rechnungen nicht bezahlen, weil der Landrat in Kassel uns erst ein Jahr später den zugesicherten Kredit über 2.500 Mark gewährte.“
So habe der Vater seiner ersten Frau, der die Tüncherarbeiten ausgeführt habe, fast zwei Jahre auf sein Geld warten müssen, sagte Louis Stillmark. „Wenn er nicht so viel Verständnis für meine missliche Lage aufgebracht hätte, wäre unser Traum vom eigenen Haus noch in letzter Sekunde geplatzt. Ihm war es zu danken, dass wir das Haus zu viert Ostern 1928 beziehen konnten.“
Als Louis Stillmark mit seiner Hausgeschichte endlich zu Ende war, sagte August Stillmark unüberhörbar laut: „Wer Heidi einmal heiratet, erbt das Haus, ob er will oder nicht.“
Als die Hitze etwas nachgelassen hatte, half August Stillmark Tante Anna beim Mähen. Heidi und Wolfgang machten sich auf den Weg zum Friedhof. Der Gang auf den Friedhof war für Heidi etwas Selbstverständliches und an heißen Tagen obligatorisch. Die Blumen mussten gegossen werden, und ein Grab, das ungepflegt war, war eine Schande.
Im Schatten einer großen Fichte stand ein weißer, großer Grabstein, auf dem mit schwarzer Schrift geschrieben stand: Karoline Stillmark, geb. Büchner, *18. Februar 1888, +3. Oktober 1947 in Arnsbach.
„Ich war zwei Jahre alt, als meine Großmutter starb. Und als sie tot war, habe ich nach ihr gefragt. Ich wollte wissen, wo sie ist“, sagte Heidi. „Als Kind habe ich oft mit meinem Großvater vor diesem Grab gestanden.“
Wolfgang sah Heidi zu, wie sie sich über das Grab bückte, welke Blüten von den lilafarbenen Stiefmütterchen zupfte und anschließend zwei Mal hintereinander mit einer großen Zinkgießkanne goss.
Viele Leute waren an diesem Abend auf dem Friedhof. Gießkannen schwenkend bewegten sie sich zwischen den Grabreihen. Sie verharrten andächtig vor den efeubewachsenen oder blumengeschmückten Gräbern und gedachten ihrer Verstorbenen.
Für Heidi war es ein Leichtes, vor Gräbern in die Familiengeschichte einzutauchen. Für Wolfgang hingegen verlor sich die Spur seiner Vorfahren im Dunkel. Im schlesischen Hausdorf lag sein Großvater begraben, der bei einem Bergwerksunglück ums Leben gekommen war, und Onkel Heinrich, der Bruder seiner Mutter, war in Tschudskoj-Bor südwestlich von Petersburg gefallen.
Krieg und Vertreibung hatten die Familienbande durchschnitten. Die einzige Brücke, die es zwischen damals und jetzt gab, war seine Großmutter, die ihm märchenhaft verbrämt, in Kindertagen Geschichten aus der schlesischen Heimat erzählt hatte.
Als Heidi und Wolfgang vom Friedhof kamen, saß Louis Stillmark noch immer auf der Bank an der Giebelseite des alten Holzschuppens. Er zeigte sich zufrieden, dass Heidi nach Karolines Grab gesehen hatte. „Sie war eine herzensgute Frau“, sagte er. „Aber sie ist leider nur 59 Jahre alt geworden.“
„Ich werde auch mal nicht älter“, sagte August Stillmark, der vom Mähen auf Tante Annas Wiese kam.
Der frühe Tod seiner Mutter beschäftigte ihn sein Leben lang. Er war 26 Jahre alt, als sie gestorben war.
August Stillmark, die Sense in der Hand, fragte Wolfgang, ob er schon mal gemäht habe. „Gesichelt habe ich schon, aber noch nie gemäht.“
Das brachte August Stillmark auf die Idee, Wolfgang zu zeigen, wie gemäht wird.
Er suchte im Schuppen nach einer zweiten Sense, schärfte sie mit einem Wetzstein, der, wie er Wolfgang erklärte, nicht zu hart sein durfte, und drückte Wolfgang den Sensenstiel in die Hand.
„Jetzt kann’s losgehen“, sagte er, und Wolfgang folgte ihm auf das große Stück Wiese hinterm Haus.
Ein Mann müsse in der Reihe mähen können, sagte August Stillmark, und seine Kurzunterweisung geriet zu einem Fachvortrag. Aufrecht müsse man stehen und dürfe sich keinesfalls nach vorn beugen, wenn man zum Mähen aushole. Das Sensenblatt sollte so auf dem Gras aufliegen, dass die Sensenspitze sich nicht in der Erde festhaken könne. Auch dürfe der Halbkreis, den man mit der Sense beschreibe, nicht zu groß sein, und August Stillmark machte Wolfgang vor, wie mit einem gleichmäßigen Kraftaufwand und gleichmäßig großen Schwüngen das Gras gleichmäßig kurz abgemäht wurde.
Trotz der eingehenden Belehrung und des Vormachens kam bei Wolfgangs Mähversuchen nur wüstes Hacken heraus, und August Stillmark sah ein, dass Wolfgang ein Großstädter war, der wohl nie das Mähen lernen würde. Wolfgang solle die Sense zurück in den Schuppen hängen, sagte er. Während Wolfgang vom hinteren Grundstück aus auf das Haus zuschritt, die Sense wie Gevatter Tod geschultert, ließ August Stillmark sein scharfes Sensenblatt leicht durch das feuchte Gras gleiten. Mit dem Mähen hörte er erst auf, als die Dunkelheit hereinbrach und der bleiche Mond rund und hell über den nachtschwarzen Bergen aufstieg.
Am nächsten Morgen wartete August Stillmark auf Hartfried, seinen Schul- und Dackelfreund, mit dem er jeden Sonntag einen zweistündigen Spaziergang auf den nahegelegenen Kohlberg unternahm.
Punkt zehn stand Hartfried vorm Hoftor, um August Stillmark abzuholen, und jeder von ihnen hatte zwei Dackel dabei.
Als sie den Kohlberg erreicht hatten, genossen sie den herrlichen Blick in die Rhön, die sich in der Ferne bläulich abzeichnete, und wenig später tauchten sie, ihre Spazierstöcke schwenkend, in den Wald ein, der ihnen ausreichend Schatten bot.
Der Weg war schmal, und die Bäume waren hoch und August Stillmark und Hartfried atmeten die Waldluft tief ein und hatten Spaß, wenn ihre Dackel eine Wildspur aufnahmen und ihr kläffend folgten, und sie erzählten sich, was sie sonst keinem erzählten. Sie waren eben richtige Freunde seit ihrer Schulzeit, und nur für die Zeit, in der sie beim Militär gewesen waren, hatten sie Arnsbach kurzzeitig verlassen. August Stillmark hatte als Soldat in der 36. Kompanie in Dänemark gedient, und Hartfried, groß und stark, wie er gebaut war, war bei der Waffen-SS gewesen. Aber das hatte ihrer Freundschaft keinen Abbruch getan. Auf Hartfrieds Dritte-Reich-Vergangenheit kamen sie so gut wie nie zu sprechen, sie sparten bewusst aus, was ihre Verbundenheit hätte stören können. Und so drehten sich ihre vielen, endlos langen Sonntagsgespräche fast ausschließlich um Hunde, Familie und Beruf.
Hartfried lobte an diesem Tag seinen Schwiegersohn in den höchsten Tönen. Gleich nach dem Studium an der Ingenieurschule habe dieser eine Stelle in der Abteilung für Forschung und Entwicklung bekommen, sagte Hartfried, der mit seinem Bruder zusammen einen kleinen Metallbetrieb besaß, in dem Rändelräder für Uhren aller Art und Größe gefertigt wurden.