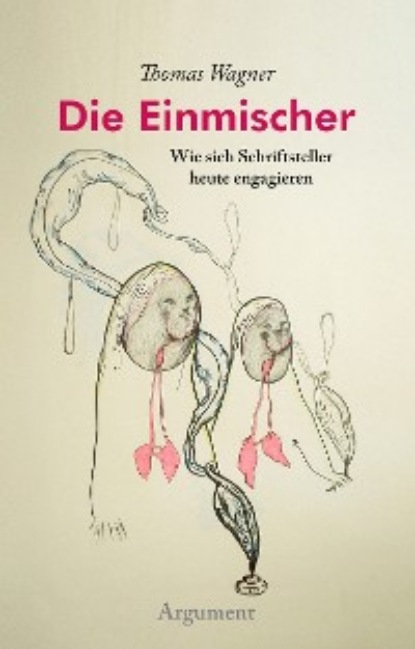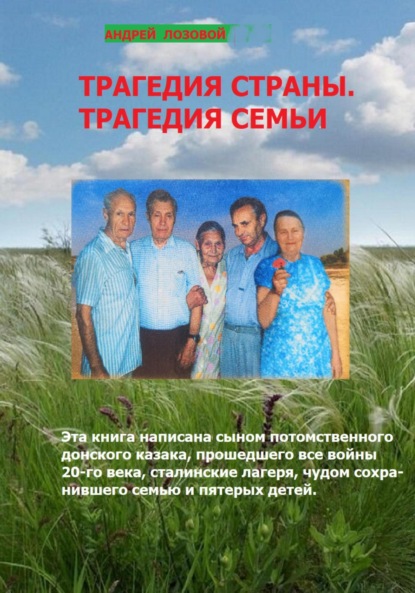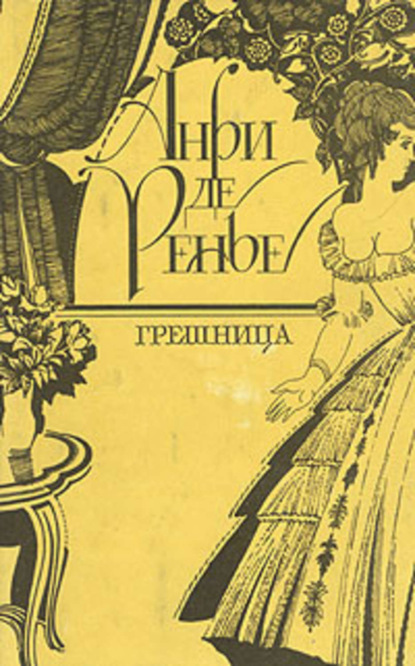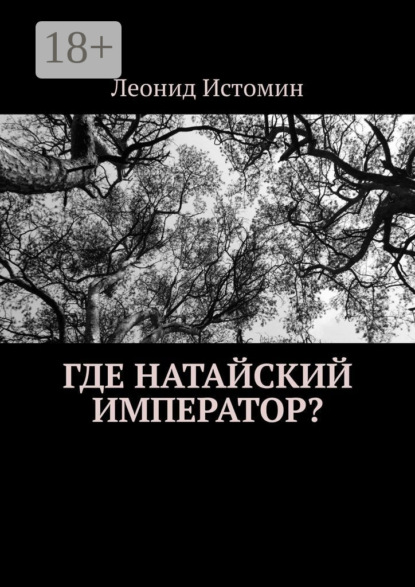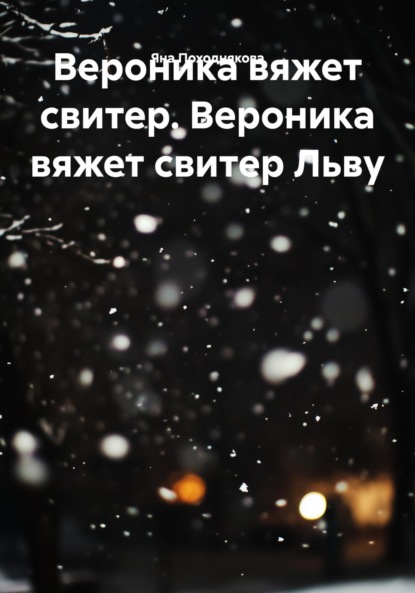- -
- 100%
- +
Als Ende 2008 Erasmus Schöfers Roman Winterdämmerung erschien, wollte in Deutschland zunächst kaum jemand Notiz davon nehmen. Nach wie vor gehört Schöfer zu den großen Unbekannten unter den Romanciers seines Landes. Die ersten Rezensionen erschienen in kleinen linken Zeitungen. Dabei handelt es sich beim abschließenden Teil des vierbändigen Romanzyklus Die Kinder des Sisyfos um ein bedeutendes Stück engagierter Literatur. Erfolgreiche jüngere Autoren wie Ilija Trojanow und Dietmar Dath sind begeisterte Leser der Tetralogie. Von einer Fortsetzung der Ästhetik des Widerstands (Peter Weiss) ist zuweilen die Rede. Das 2000 Seiten starke Epos erzählt die Geschichte der westdeutschen Linken von 1968 bis 1990 entlang ausgewählter Stationen und fiktiver Biografien. Dabei versucht er die Motive der aufbrechenden Menschen, ihre Impulse und moralische Empörung so festzuhalten, wie sie damals von ihnen empfunden wurden. Ein Reporter, ein Historiker, eine Schauspielerin und ein Werkzeugmacher sind die Hauptfiguren. Im Mittelpunkt von Winterdämmerung stehen die Massenproteste der Friedensbewegung gegen die atomare Aufrüstung, der Kampf für die 35-Stunden-Woche und der Widerstand gegen die Schließung der Rheinhausener Stahlhütte. Die realistische Darstellung der Arbeitswelt seiner Akteure ist Schöfer dabei ebenso wichtig wie die lebendige Schilderung ihrer politischen Auseinandersetzungen, ihrer erotischen Begegnungen und Freundschaften. Seinen Stoff hat Schöfer als Journalist, Künstler und als politischer Aktivist selbst mitgeformt. Seine Szenerien sind authentisch, die Diskussionen realitätsnah, die Konflikte glaubwürdig geschildert. Obwohl Schöfers Figuren scheitern, gelingt es ihnen, den utopischen Funken immer wieder neu zu entfachen, sich gegenseitig aufzurichten. Als der Staatssozialismus zusammenbricht, entdeckt der marxistische Historiker Bliss gemeinsam mit seiner Enkelin in der anarchistischen Kommune Kaufungen den realutopischen Vorschein einer solidarischen Gemeinschaftsform.
Neben anspruchsvollen politischen Romanen erlebt auch die Gattung der politischen Kampfschrift eine bemerkenswerte Renaissance. Neuere Texte von Dietmar Dath, Robert Menasse oder Raul Zelik zeigen eindrucksvoll, dass momentan inmitten der deutschsprachigen Literatur eine regelrechte Ideenwerkstatt für konkrete Utopien entsteht: sprachlich überzeugend, sachkundig und politisch vorwärtsweisend.
Den Anfang machten im Jahr 2006 Robert Menasses Frankfurter Poetikvorlesungen: Die Zerstörung der Welt als Wille und Vorstellung, eine fulminante Kampfansage an die neoliberale Ideologie und den Demokratieabbau im europäischen Einigungsprozess.31 Dem konformistischen Mainstream-Journalismus unserer Tage wirft Menasse ein Versagen auf der ganzen Linie vor, da er nicht zu analysieren vermöge, dass staatliche Sozialkürzungen nur deshalb notwendig erscheinen, weil das Kapital seinen Anteil am Gemeinwohl nicht mehr leisten wolle. Wo Konzerne von Steuern befreit, Sozialleistungen eingespart, Arbeitsdienste eingeführt, Freiheitsrechte eingeschränkt, durch das Feindbild islamischer Terrorismus gesellschaftliche Solidarität gestiftet, demokratische Errungenschaften der Nationalstaaten im Europa des Lissaboner Vertrags abgebaut und Rüstungsmaßnahmen legitimiert werden, erkennt Menasse eine Tendenz des neoliberalen Kapitalismus, die westlichen Gesellschaften auf eine neue Weise zu faschisieren. Mit dem Rückbau des Sozialstaats und der bürgerlichen Freiheiten sieht er heute Bedingungen kapitalistischer Herrschaft wiederhergestellt, für die Hitler lediglich die Antwort der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gewesen sei. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sieht Menasse alle zuvor bekannten Widersprüche des Westens in der totalitären Idee von »unserer Zivilisation« verschwinden, »die mit aller Gewalt verteidigt werden müsse«. Die Literatur habe dagegen die Aufgabe, sich für »die Befreiung von der Diktatur eines befreiten Kapitals« einzusetzen.
Juli Zeh und Ilija Trojanow gelang 2009 mit Angriff auf die Freiheit eine scharfe Polemik gegen den Abbau der Bürgerrechte im Zeichen des internationalen Antiterrorkampfes. Das Buch kletterte alsbald auf die vorderen Ränge der Spiegel-Bestsellerliste. Für das Autorengespann ist die einzige Gefahr, die vom Terrorismus ausgeht, die Art, wie unsere Gesellschaft auf ihn reagiert. In ihrem Buch beschreiben sie, wie sich demokratisch verfasste Gesellschaften seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beinahe widerstandslos von ihren Regierungen in immer lückenloser überwachte Kontrollgesellschaften haben umbauen lassen. Rasterfahndung, biometrischer Reisepass, Telefonüberwachung und Online-Durchsuchung sind dafür einige der wichtigsten Stichworte. Sie zeigen, wie die NATO nach dem Ende des Kalten Krieges ihr Feindbild auf amorphe, prinzipiell nicht fassbare Gegner umstellte. Dabei handle es sich nicht nur um »terroristische Netzwerke«, sondern auch um Einwanderer, Flüchtlinge, ölfördernde Eliten sowie hungrige junge Männer, die sich nach Ansicht der westlichen Strategen nicht mehr im Griff haben und aufständisch werden.
Knapp, aber fundiert kritisieren Trojanow und Zeh den Gebrauch politischer Sprache. Sie zeigen, wie von interessierter politischer Seite systematisch Angst erzeugt wird, um die Akzeptanz von immer neuen Gesetzesverschärfungen und Repressionen vorzubereiten. Ausdrücke wie »Terrorverdächtiger«, »Gefährder«, »islamistische Zelle«, »radikaler Islamismus« geben nicht die Realität wieder, sondern sind politische Behauptungen von ideologischer Durchschlagskraft. So hat die Verwendung des Begriffs »Terrorverdächtiger« seit den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center ungeheuer zugenommen.
Der Schutz vor willkürlicher Verhaftung ist nach diesem Datum in den USA praktisch widerstandslos aufgegeben worden. Aus Grundrechten wurden Sicherheitslücken. Am Beispiel einer britischen Umweltorganisation zeigen die Autoren, wie die von den Regierungen und Medien benutzten Mechanismen der Angstmacherei schon heute mühelos vom Bereich des sogenannten radikalen Islamismus auf friedliche Protestbewegungen übertragen werden. So werden Öko-Aktivisten als Terroristen eingestuft und Globalisierungskritiker in Terror-Datenbanken gelistet. In Deutschland geriet ein Stadtsoziologe unter Terrorverdacht, weil sich auch von ihm benutzte Fachbegriffe in den Schreiben einer mutmaßlich militanten Gruppe wiederfanden. In Großbritannien werden heute selbst Ordnungswidrigkeiten mit Hilfe von Ausnahmegesetzen verfolgt. Angriff auf die Freiheit ist ein politischer Gebrauchstext von schlichter Schönheit, ein Aufruf zur Verteidigung der Bürgerrechte.
Seit Dietmar Dath seine sozialistische Streitschrift Maschinenwinter (2008) veröffentlicht hat, begeistern sich gerade junge Leser für das schmale Buch. Der Schriftsteller, Übersetzer und Journalist ist womöglich der derzeit meistzitierte deutschsprachige Gegenwartsautor im hiesigen Blätterwald. Dabei nimmt der überzeugte Marxist kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Kritik des Kapitalismus in der Perspektive seiner Überwindung geht. Neben einer kaum noch überschaubaren Anzahl ambitionierter Science-Fiction-Romane hat der Suhrkamp-Autor eine Reihe von Sachbüchern über Mathematik oder Phänomene der Popkultur geschrieben. Mit Maschinenwinter gelang ihm eine politische Kampfschrift, die bei alten und jungen Linken viel Zuspruch fand. Schon jetzt ist sie ein wichtiger Bezugspunkt für Debatten quer durch alle Fraktionen der Linken. Dath klärt auf, wie unvernünftig eine Welt organisiert ist, die angesichts hochentwickelter Produktivkräfte nicht in der Lage ist, den kollektiv geschaffenen Reichtum gerecht zu verteilen. Der Sozialismus verlangt in seinen Augen keineswegs einen neuen Menschen. Vielmehr sieht Dath schon die heute lebenden Vertreter der Gattung als hinreichend vernunftbegabt und lernfähig an, um der Herrschaft des Kapitals selbst ein Ende zu setzen.
Dath geht es um die Entdeckung kollektiver Handlungsmächtigkeit in gemeinsamer Praxis, nicht um Glaubenssätze ideologischer Schulen. Wie man die Bewohner von Asylbewerberheimen schützt, militärische Propagandaschauen stört oder Konzerne beschämt, die ihre Gewinne durch moderne Sklavenarbeit erzielen, darauf könne man sich leicht verständigen. Um durchzuschlagen, dürfe revolutionäre Politik aber nicht auf pure Spontaneität bauen, sondern müsse sich so organisieren, wie es die heutige Situation erfordert. Unverzichtbar bleibe die Freistellung politisch Hauptamtlicher, denn die Besitzlosen müssten ihren Zustand zwar selbst demokratisch aufheben, könnten das bestehende System aber nicht irgendwann nach Feierabend sprengen.
Die künftige Internationale sieht er in der Pflicht, nicht nur von den Erfolgen, sondern auch von den Fehlern derjenigen zu lernen, die sich an die Lehrsätze der Klassiker gehalten haben. »Beim nächsten Versuch sollte man sich darauf verstehen, die Sogwirkung des Weltmarkts, die Unmöglichkeit der Autarkie und andere rein ökonomische Faktoren ebenso wenig zu missachten wie die Notwendigkeit, alles, was man unternimmt, schon in der Phase des Kampfes um demokratische Planung so demokratisch (und so geplant!) wie möglich anzugehen.«
Der Romancier und Übersetzer Raul Zelik hat sich dem Thema staatlicher Gewalt aus ganz verschiedenen Perspektiven genähert: als Romanautor, Verfasser von Reportagen und als Politikwissenschaftler. Einen Namen als Schriftsteller machte er sich mit den Romanen La Negra (2000) und Bastard. Die Geschichte der Journalistin Lee (2004). In seiner Reportage Made in Venezuela (2004) gibt er Innenansichten der bolivarianischen Revolution. Die Handlung seines Polit-Thrillers Der bewaffnete Freund (2007) spielt vor dem Hintergrund des baskischen Konflikts und ist zugleich eine Art literarisches Roadmovie durch den politischen Untergrund auf der Iberischen Halbinsel. Zeliks Protagonisten reflektieren über Freundschaft, emotionale Nähe, die Kontinuität des Faschismus in Spanien, Staatsterrorismus, aber auch über die Problematik einer militarisierten Gegengewalt. Der Roman untersucht den politischen Terror beider Seiten mit erzählerischen Mitteln und stellt den Nationalismus der baskischen Befreiungsbewegung, aber auch die radikale linke Identitätskritik in Frage. Auf diese Weise fügt er der verfahrenen Gewaltdiskussion selten gehörte Zwischentöne hinzu. »Man kann im Baskenland sehen, wie in Europa Ausnahmezustände etabliert sind. Man spricht dort davon, dass in den dreißig Jahren seit dem Beginn der Demokratisierung etwa 7000 Menschen gefoltert worden sind. Bei drei Millionen Einwohnern ist das eine wahnsinnig hohe Zahl. Das kann in Europa passieren, ohne dass darüber gesprochen wird.«32 Zeliks Reportagen und politische Analysen zeigen, dass der bürgerliche Staat kein verlässlicher Friedensgarant ist, sondern eine extreme Form organisierter Gewalt in sich birgt. Besonderes Augenmerk verdient ein Gesprächsbuch, das Zelik gemeinsam mit dem Ökonomen Elmar Altvater gemacht hat. Unter dem Titel Die Vermessung der Utopie haben sie im Herbst 2009 einen Gegenentwurf zur kapitalistischen Wachstumsgesellschaft entwickelt. Ihre wichtigste These lautet: Die gegenwärtige Finanzkrise, die globale Überproduktion, der Klimawandel und die wachsenden sozialen Gegensätze können nur durch eine radikale Transformation der Ökonomie bewältigt werden.
Was sie tun können
Eine der Erfolgsstrategien neoliberaler Ideologen bestand darin, Keile zwischen die Bewegungen zu treiben, die eine emanzipatorische Politik verfolgten. Waren Klassenkampf, Friedensfragen, Frauenbewegung, die Befreiung von Schwulen und Lesben, Bildung, die Solidarität mit den Ländern des Südens, sexuelle Emanzipation, fortschrittliche Erziehung, Kunst und später auch die Ökologie in linken Entwürfen mehr oder weniger eng miteinander verbunden gewesen, befinden sich diese Zusammenhänge heute im Zustand fortschreitender Auflösung. Die Themen werden von Organisationen besetzt, die weit auseinandergerückt sind, nebeneinander existieren und zum Teil sogar gegeneinander aufgestellt sind.
Die Literatur kann eine Menge dazu beitragen, diese Felder neu miteinander zu verknüpfen. Sie hat die Chance, über festgefahrene Gräben von Parteien, Organisationen und kleinen Politzirkeln hinweg, an die gemeinsamen Themen und Aufgaben linker Politik zu erinnern: die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und die Beendigung aller Verhältnisse, in denen er ein geknechtetes und verächtliches Wesen ist.
Die nun folgenden Interviews haben exemplarischen Charakter. Sie geben kein Gesamtbild, sind Momentaufnahmen.33 Dennoch ist die Zusammenstellung nicht zufällig. Mir kommt es darauf an, einen Eindruck zu vermitteln, wie vielfältig das heutige Engagement der Autoren ist und welche literarischen Gattungen daran beteiligt sind.
Thomas Wagner, im August 2010
Die Gegner schlafen auch mal
Dietmar Dath1

Dietmar Dath wurde 1970 in der Nähe von Freiburg im Breisgau geboren. Der Science-Fiction-, Horror- und Heavy-Metal-Fan hat nie einen Hehl aus seinen marxistischen Überzeugungen und seiner Bewunderung für das politische Denken Lenins gemacht. Er war Chefredakteur der Musikzeitschrift Spex (1998 – 2000) und Redakteur der FAZ (2001 – 2007). Sein Roman »Die Abschaffung der Arten« stand 2008 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis.
Ein Gespräch über Klassenkampf, Planwirtschaft, Lenin und Rosa Luxemburg.
Vielleicht sind Sie zurzeit der einzige Marxist unter den deutschen Schriftstellern. Welche Texte von Marx haben für Sie eine besondere Bedeutung?
Unverzichtbar finde ich die Feuerbachthesen, also dass es auf die Praxis ankommt. Am zweitwichtigsten ist die Klassengeschichte, also dass es eine Rolle spielt, wo ich im gesellschaftlichen Produktionsprozess stehe. Ich muss eine Praxis haben, und die spielt sich zwischen Gruppen ab, die in einem antagonistischen Widerspruch zueinander stehen, also Klassen. Im Vergleich dazu halte ich die Krisentheorie für verzichtbar. Die kann ich auch von einem bürgerlichen oder keynesianischen Standpunkt aus haben. Ich habe gerade ein Gespräch zwischen dem Schriftsteller H. G. Wells und Stalin über den New Deal gelesen. Wells hat im Juni 1934 eine ausgedehnte Welttournee hinter sich und erzählt, dass die Amerikaner sich ja jetzt auch langsam in Richtung Sozialismus bewegen. Stalin sagt: Alles gut und schön, aber sie werden niemals die Eigentumsverhältnisse ändern. Sie werden niemals etwas machen, was die Situation ändert, die das heraufbeschworen hat, was sie jetzt pflastern wollen. Insofern ist das so sinnlos wie Dem-eigenen-Schwanz-Hinterherrennen. Wells meint, dass doch alle etwas davon haben, wenn das marode System geflickt wird. An dieser Stelle bringt Stalin den Klassenstandpunkt rein und sagt: Einige hätten eben nichts davon, wenn das Ding grundlegend geändert wird, und das sind die, die am Steuer sitzen. Deshalb wird nichts passieren. Das hat damals gestimmt. Wäre ich noch bei der FAZ, hätte ich sicherlich eine schöne Glosse daraus machen können, wie H. G. Wells und Stalin sich über Obama unterhalten.
Keynes führt nicht weit genug. Aber ist zurzeit nicht eher zu wünschen, dass Obama überhaupt so weit kommt?
Keynes funktioniert am besten mit nacktem Imperialismus, mit Kriegswirtschaft. Deshalb wird mir jedes Mal mulmig, wenn Leute sagen, das sei die Lösung. Krankenhäuser-Bauen ist nur ein Teil dieses Ansatzes. Der viel effektivere Teil ist: Wir bauen Mordmaschinen. Die werden abgeschossen, und man baut mehr.
Was hat der Staat für Aufgaben im Kapitalismus? Im Grunde Polizeiaufgaben, und: die Märkte nach außen sichern. Er tritt als ideeller Gesamtknüppel auf. Wenn man diesem Staat sagt: Jetzt kannst du mal richtig in deine Rechte treten und eine gesamtgesellschaftliche Lösung anbieten, gibt es wahrscheinlich nicht mehr Schulen, sondern mehr Kloppe.
Sie treten für eine sozialistische Gesellschaft ein, in der die Wirtschaft demokratisch kontrolliert wird. Was sind die besten Argumente für die Planwirtschaft?
Das erste ist: Es wird schon geplant. Nur eben von ein paar Leuten, die aus Geld mehr Geld machen wollen. Die Vorstellung, dass einfach so drauflosproduziert wird, ist doch totaler Quatsch. Es gibt für alles, was man will, wenn man Planwirtschaft will, bereits Stummelformen. Die sind entlang von so etwas wie Marktforschung organisiert. Sie nennen das: die Märkte vorbereiten.
Wenn so ein Plan im Kapitalismus dann nicht funktioniert, wird sichergestellt, dass die Gearschten die Zeche zahlen. Nehmen wir die Privatisierung des öffentlichen Verkehrs. Ein Unternehmen plant die Schließung bestimmter Strecken oder Haltestellen, die sich nicht rentieren, weil da zu wenig Leute stehen. Diese Leute wollen aber irgendwohin. Jemand muss den Transport bezahlen. In diesem Fall: die Leute selber. Es wird für den Bahnbesitzer profitabler, aber gesamtgesellschaftlich gesehen kostet es nicht weniger.
Das zweite Argument ist die Entwicklung der Produktivkräfte. Ein Argument gegen die Planwirtschaft war lange ihre Schwerfälligkeit. Heute sind die Intervalle, in denen sich die Produktion umstellen lässt, sehr kurz. Selbst Autos werden on demand bestellt. Die schwersten Schwerprodukte können kurzfristig umgebaut und geliefert werden.
Hat die Planwirtschaft nicht gerade erst die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten ruiniert?
Es wird gerne gesagt: Im Ostblock gab es keine Südfrüchte, keine Glühbirnen – das war eine Misswirtschaft, in der alles schiefging. Da ist zu fragen: Unter welchen Bedingungen – Produktivkräfte, Verkehrswesen und so weiter – wurde diese Wirtschaft entwickelt? Wenn man sich die Jahre 1920 bis 1935 anschaut, ist diese Leistung enorm. Man kann sagen: Das ist mit der Knute erreicht worden. Aber wenn ich den Kapitalismus mit seiner ursprünglichen Akkumulation auf dem Kreuz hätte, die wirklich mit einer harten Knute durchgezogen wurde, wäre ich ganz vorsichtig mit der Einschätzung, was Modernisierung kostet. Das ist alles nicht schön. Mitdem-Finger-Zeigen ist verboten.
Der zweite Punkt ist: Unter den Bedingungen eines Weltmarktes mussten eine Planwirtschaft und eine chaotische Profitwirtschaft miteinander in Verkehr treten, weil es nicht alles überall gibt. Da frage ich: Wem geht schneller die Puste aus, dem Chaoten oder dem, der mit dem Chaoten zu handeln versucht? Außerdem kann der Chaot den von ihm Abhängigen jederzeit sagen: Wenn ihr nicht macht, was ich Chaotisches von euch will, verliert ihr eure Wohnung und so weiter. Das kann der verlässliche Aktenkoffermensch, der mit ihm verhandelt, nicht. Da gucken wir mal, wer wen fertigmacht.
Weil die DDR-Wirtschaft zu unproduktiv war, wollte Walter Ulbricht sie in den Sechzigern etwas kapitalistischer einrichten. Moskau hat sich das verbeten.
Ich glaube in der Tat, dass jede Sternstunde und jede Blamage der DDR damit zusammenhängt, wie viel Spielraum ihr von den Russen gelassen wurde. Unabhängig von der Qualität der einzelnen Initiativen Ulbrichts nötigt es mir Respekt ab, dass er völlig klar gesehen hat, dass sein Spielraum über Nacht zusammenschnurren kann. Ob das Honecker noch klar war, weiß ich nicht.
Wenn Stalin ein gutes Angebot bekommen hätte, den DDR-Kram zu verkaufen, hätte er es gemacht. Er hat kein gutes Angebot bekommen. Gorbatschow hat dann irgendwann das bekommen, was er für ein gutes Angebot hielt. Ob es das war, wird er wahrscheinlich heute noch nicht wissen. Aber seinen Kopf sollten wir uns auch nicht zerbrechen.
Ulbricht hat einfach gesagt: Wir haben jetzt die DDR; ich weiß nicht, ob wir sie behalten können, aber wir versuchen, es so gut wie möglich zu machen.
Der Wettstreit zwischen Plan- und Privatwirtschaft war mit Ulbrichts Absetzung entschieden.
Ich finde es idealistisch zu sagen: Das war ein Wettstreit zwischen Plan- und Marktwirtschaft. Es war ein Wettstreit zwischen vielen Dingen, zum Beispiel einem halbfeudalen Land, das plötzlich Industriestaat geworden war, und einem riesigen Inselkontinent, der niemals einen Weltkrieg auf eigenem Boden erlebt hatte. Wenn wir früher das Würfelspiel »Axis & Allies« gespielt haben, das den Zweiten Weltkrieg simuliert, wurde jedes Mal klar: Die Amerikaner brauchen wahnsinnig lange, bis sie überhaupt in den Krieg reinkommen. Sie müssen erst das ganze Material produzieren und über den Ozean schaffen. Das hat den Nachteil, dass sie sich erst spät einmischen können. Und den Vorteil, dass sie jetzt nur noch zu gewinnen brauchen, während alles andere schon komplett in Scherben liegt.
Ein Systemkrieg zwischen zwei real existierenden historischen Entitäten ist etwas ganz anderes, als zwei Ideen gegeneinander auszutesten. Historische Fragen sind historisch, programmatische sind programmatisch.
Wo sollte politische Agitation heute ansetzen?
Jetzt können sich noch ein paar Leute an die Bonbons aus den Tagen der Systemkonfrontation erinnern: die Schaufenster des Westens, das Sozialsystem. Das soll nicht mehr praktikabel sein. Man soll sich das nicht mehr leisten können. Einige verstehen das einfach nicht. Obwohl auf Vollgas gebrüllt wird, damit sie es verstehen. Solange sie es nicht tun, sind sie schlauer als die, die es ihnen erklären wollen. Wenn sie verstanden haben, haben wir Byzanz. Gläubige Menschen.
Dauernd schlagen einem heute Naturargumente entgegen. Für alle Annehmlichkeiten, die man noch aus dem alten Sozialstaat-Ding kennt, wird einem gesagt: Es sind jetzt aber nicht genug Höhlen da. Darauf ist zu sagen: Die Höhlen kann man graben. Das ist im Grunde der Wettkampf gegen die Thatcher-Idee »Es gibt keine Gesellschaft«. Wenn es aber doch eine gibt, kann sie überlegen, was sie für eine sein will.
Man muss die Leute daran erinnern: Was habt ihr alles nicht, und was steht dem im Weg, dass ihr es bekommt? Dann muss man Namen nennen; muss sagen, wer die Leute sind, die öffentliches Eigentum verscherbeln; wer die Leute sind, die es kaufen, und was das für Folgen hat.
Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der sagt: Ich bin digitale Bohème, ich bin frei – das wäre ja mal so ein ganz zäher Widerstand gegen diesen langweiligen Sozialismus. Dann würde ich sagen: Was machst du, wenn du krank bist? Er würde erwidern: Dann bin ich ja selber schuld. Dem würde ich entgegnen: Das glaube ich nicht, weil … und ihm davon erzählen, wann man die Idee der Krankenkasse hatte. Ich würde ihm erklären: Deine Freiheit, von der du glaubst, sie sei neu und kommt vom Laptop, die gab es immer. Früher hieß das halt Tagelöhner.
Es wird soundso viele geben, die das nicht überzeugt. Das sind mit ziemlicher Sicherheit diejenigen, deren Auftragslage gerade noch ganz okay ist. Aber es kann nicht die Auftragslage aller okay sein. Die alte Massenloyalität gegenüber dem Kapitalismus kommt doch von dem Gedanken: Wenn ich mich mit dem System hier nicht anlege, bin ich immer noch gut dabei. Der Übermut derer, die sich für die Gewinner halten, hat dazu geführt, dass dieses Argument ein bisschen schlechter sticht als vor zwanzig, dreißig Jahren.
Seitdem ist die Ausdifferenzierung oder Atomisierung der Gesellschaft weit vorangeschritten.
Ich sehe als Fluchtpunkt auch so eine Mittelaltersituation: Jeder feudal abhängige Bauer ist unzufrieden, aber daraus folgt halt nichts. Ich merke, dass ich wie ein Optimist klinge, wenn ich sage: Man muss, man sollte und ich finde, dass man … Aber die Alternative ist zu sagen: Das hat eh keinen Wert. Darüber lohnt es sich nicht zu reden. Dann haben wir ein Interview, das einen Satz lang ist.
Die Wahrscheinlichkeit der Revolution ist nicht sehr hoch, aber wenn sie klappt, ist alles gut oder jedenfalls interessant. Ich tue also so, als wären die Dinge sehr viel besser, als sie sind, weil es nichts Blöderes gibt, als hinterher festzustellen: Es sah viel besser aus, ist jetzt aber verschenkt. Ungerechtfertigter Pessimismus führt zu echter Reue. Da geht es einem wie vielleicht ein paar Überlebenden aus der KPdSU im Jahr 1994.
Ich finde, das wichtigste Argument für eine Systemänderung ist das bestehende System selbst. Im Grunde gibt es immer zwei Fragen: Ist es schlecht und ist etwas anderes überhaupt vorstellbar? Wenn sich das mit Ja beantworten lässt, ist der Rest kein Fahrplan, sondern ein Prozess. Dann fangen wir heute an, und alles andere wird sich im Verlauf des Kampfes herausstellen.