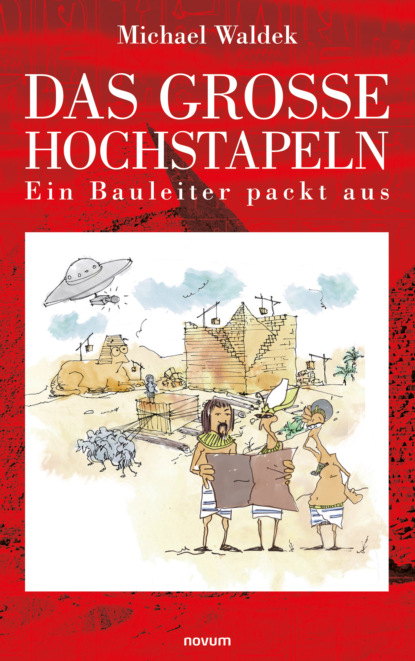- -
- 100%
- +
Ich widmete meine Aufmerksamkeit wieder dem kleinen schwangeren Vogel und übte mich in Körpersprache, so als würde Interesse an dem Kunstwerk bestehen. Übrigens unterschied sich die Körpersprache der meisten anderen Gäste nicht von der meinen. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich genau diese Szenerie. Es ist wie immer, genau so laufen die meisten Ausstellungseröffnungen ab. Die Gäste sind die eigentlichen Kunstwerke, der Rest ist Kulisse.
Tatsächlich kam die junge schöne Frau mit einer anderen Frau an der Hand nach kurzer Zeit auf mich zu. Wir machten uns flüchtig bekannt. Die andere Frau war die Kunstschaffende persönlich, die mir die Hand gab, sich erfreut über mein Kaufinteresse zeigte und den Preis nannte. Wupps, so kommentierte ich doch etwas erschrocken die Überdosis der genannten Höhe der Zahlungsmittel. Ich willigte aber schnell ein, da mein Interesse an dieser jungen schönen Helferin immer größer wurde. Außerdem wollte ich als „flüssig“ gelten. Ich bestand darauf, dass der Kauf der Brosche über Schi Tot in drei Tagen abgewickelt werden sollte. Den Namen kannte ich jetzt und fand ihn äußerst sympathisch. Auch erfuhr ich so, dass Schi Tot ebenfalls Künstlerin ist und ein paar Straßen weiter weg einen kleinen Kunsthandel betreibt. Drei Tage später hielt ich die rote Perlenblume in der Hand, drückte sie an mein Herz und spürte so die Wärme dieser herrlichen Frau. Das erste Mal in meinem Leben konnte ich mir eingestehen, dass ich verliebt bin. Denn nie zuvor bin ich mit einer Perlenblume ins Bett gegangen. Mein Gutenachtkuss auf das Perlenarrangement sagt einiges.
Seither habe ich eine Beziehung zu Schi Tot, die ich als unvollendet bezeichnen würde. Sie ist eine souveräne Künstlerpersönlichkeit, stark und unabhängig. Die Beanspruchung dieses Freiraumes ist ihr Credo. Ich muss und will mich dem fügen, denn allein der Zustand der innigen Freundschaft zwischen uns beiden macht mich glücklich. Die Hoffnung, dass aus der Freundschaft eine leidenschaftliche Liebe wird, treibt mich täglich an und ist der Kraftquell all meines Denkens und Handelns. Doch nun ist sie plötzlich abgereist, einfach abgereist. Das macht mir Kummer, verzweifelten Kummer.

Plötzlich flatterten in der Nähe ein paar Wildgänse aufgeregt krächzend in die Luft. Offensichtlich hat sich ein Nilpferd zum Landgang entschlossen. Sehen kann ich das nicht. Ich muss mich deshalb konzentrieren und aufpassen, dass es zu keiner Konfrontation mit diesem Koloss kommt. Die Tiere sind auch an Land unberechenbar und können aggressiv werden. Ich muss mich jetzt auf den Erhalt meiner Existenz konzentrieren. Die Schwermut der Gedanken an Schi Tot verfliegt. Der Cheopswürfel dringt in meinen Kopf. Ich schüttle mich und stelle fest, dass kein Nilpferd die Lichtung betreten hat. Ich kann mich nun gedanklich wichtigen beruflichen Angelegenheiten widmen.
Es war Echt-Natron, der mich überzeugt hat, dieses Projekt engagiert anzunehmen. Ich soll für die Ausführung zuständig sein, als Bauleiter vor Ort. Das ist einerseits eine große Ehre, andererseits kann es bei Misslingen über ein Urteil des Bauherrn zum Tode führen. Echt-Natron lächelte mich beim Nennen dieser beiden Optionen mit verschmitzten Augen an. So ist er, mein Chef. Nur so kenne ich ihn. In seiner unverwechselbaren Art nennt er das Eintreten der tödlichen Option als den perfekten Zustand von Ruhe für Körper und Geist. Meistens ist Echt-Natron ein richtig cooler Typ, der in sich ruht. Doch nicht immer. Wenn hausgemachte Probleme auftauchen und seine Geduld strapazieren, dann kann er plötzlich sehr aufbrausend agieren. Dann ist er – echt wie Natron. Das müssen seine Eltern bei der Namensgebung wohl geahnt haben.
Ich kenne diesen Baustellenfuchs seit vielen Jahren. Gemeinsam haben wir bei der Sanierung der Fundamente des Leuchtturms von Alexandria auf der Insel Pharos an der Küste im Norden Ägyptens die Bauleitung übernommen. Der Turm begann stetig zu kippen. Es wurde ein schiefer Turm, der nicht mehr richtig leuchten konnte. Umfangreiche und komplizierte Unterfahrungsmaßnahmen mussten zügig und verlässlich durchgeführt werden. Wir haben dabei prächtig harmoniert, uns gut kennengelernt und letztlich die Sanierung erfolgreich abgeschlossen. Auf ewig wird die Konstruktion des Turms allerdings nicht halten. Diesen Sachverhalt haben wir offen den Leuchtturmbetreibern mitgeteilt. Dennoch erhielten wir hohe Anerkennung.
Echt-Natron ist ein Bauleiter der alten Schule, eben von echtem Schrot und Korn. Er hasst Schriftverkehr zum ausschließlich rechtssichernden Zweck und bevorzugt den verlässlichen Handschlag. Das gegebene Wort muss für eine verbindliche Absprache reichen. Sein Bauchgefühl ersetzt schon mal den Statiker und andere Konstrukteure. Er setzt auf Psychologie und behauptet, dass 50 % seiner Fähigkeiten als Bauleiter auf dieser Lehre der Seele beruhen und fügt dann in der Regel schmunzelnd an, der Rest ist meine erotische Ausstrahlung. In der Baubranche in Unterägypten ist er anerkannt. Seine Methoden und seine Fähigkeiten der Baustellenleitung haben sich herumgesprochen. Nicht zuletzt deshalb hat ihn der Wesir für Städtebauangelegenheiten ohne nervige Stellenbewerbung zum Projektleiter erkoren. Seine Befugnisse sind weitreichend verabredet. Dass er sich damit einem erhöhten Erfolgszwang ausliefert, ist ihm voll bewusst. Eine seiner besonderen Fähigkeiten ist es, Verantwortung an seine Mitarbeiter zu delegieren. Genau dies konnte ich vor ein paar Tagen hautnah erfahren.
Ich erinnere mich jetzt, wie er mich zu einem lockeren Mitarbeitergespräch einlud, um mir die Übernahme des Bauleiterpostens für ein Großprojekt schmackhaft zu machen. Zunächst sprach er von unserer guten Zusammenarbeit in Alexandria bei der Sanierung des Leuchtturmes und zeigte mir die hellen und luxuriösen Büroräume seines neuen Dienstsitzes. Mir war damit sofort klar, dass etwas Großes bevorstehe. Ich lobte ihn ob seiner Wahl, Frau Notvertrete zur Chefsekretärin zu benennen. Eine bestechend attraktive Frau, die mit natürlicher Freundlichkeit die Gäste ihres Chefs in Empfang nimmt und als Willkommensgruß köstliche Plätzchen reicht. Zunächst lobte Echt-Natron mich in Bezug auf meine Fähigkeiten als Bauleiter, was mich stutzig machte, denn ein Lob ist in unserer Branche eher ungewöhnlich. Rote Teppiche für Preisverleihungsorgien, wie sie z. B. für Künstler und Personen des öffentlichen Lebens üblich geworden sind, werden für Bauleiter nicht vorgesehen. Irgendetwas steckte hinter der Schmeichelei von Echt-Natron. Es gelang mir nicht, es zu deuten. Das Mitarbeitergespräch verlief zunächst stockend und nicht präzise genug. Echt-Natron sagte grob, es gebe wohl Probleme mit der Kostenschätzung, der Terminplanung und mit der technologischen Umsetzung des Baues des Cheopswürfels. Naja, nicht grade „wenig“, aber normal für größere Bauprojekte, spielte er die Tragweite der Problemaufzählung herunter. Die Architekten hätten eine Heidenangst, ihre ersten groben Berechnungen zu den Kosten dem Cheops offen mitzuteilen. Vertraulich hätte der Architekt ihm gesteckt, dass die anvisierten gedeckelten Geldmittel wohl nur zu einem Drittel die tatsächlichen Baukosten abdecken würden. Die technische Umsetzung, egal ob für einen großen Würfel oder für einen kleineren Würfel, sei eher unklar. Für eine zusätzliche Geldbeschaffung durch eine gezielte kriegerische Handlung gegen irgendeinen reichen Nachbarn wäre die Zeit zur Vorbereitung und Ausführung zu knapp. Bei den leicht zu besiegenden Nachbarn, den Nubier, sei eh nichts mehr zu holen. Die sind uninteressant, da zu arm. Es fehle also Geld, beendete er seine Problemaufzählung. Pause.
Ich sortierte das Gehörte und fühlte eine starke Neigung zum sofortigen Abgang. Echt-Natron zuliebe blieb ich dennoch und stellte nun ein paar wesentliche Fragen. „Gibt es eine Grundstatik, und was sagt generell der Statiker zu den Tragwerkprinzipien des Bauvorhabens?“, war nach langem zögerlichem Überlegen meine erste Frage. „Es wurde keiner beauftragt“, antwortete Echt-Natrons achselzuckend. „Nicht mal für eine Projektberatung in der Planungsphase steht dem Architekten diese Fachkraft zur Verfügung, obwohl wir genau das empfohlen hatten.“ „Ist wohl dumm gelaufen“, erlaubte ich mir als Kommentar und stellte eine zweite Frage. „Ist beabsichtigt, eine Projektsteuerung zu beauftragen?“ „Ja, es sind die Herren der Hohen Priesterschaft am Hofe des Bauherrn mit Hoch-Hart-Muth an der Spitze, du weiß schon, die gleichen Herrn wie bei der Fundamentsanierung des Leuchtturms an der Küste“, antwortete Echt-Natron, nichts Gutes ahnend. Ich wurde sauer. Kein Statiker, aber eine Projektsteuerung. Echt-Natron verwies noch auf das klare und unerbittliche Nein von Bauherrenseite bei der Bitte zum Verzicht auf die Berufung einer Projektsteuerung. Diese Schaltstelle wäre zu wichtig, um darauf zu verzichten, so das Argument der Auftraggeber. Diesen gravierenden Irrtum konnte weder der Projektleiter noch der Architekt in diversen Besprechungen mit dem Bauherrn klären.
Nun die dritte wichtige Frage, nachdem Echt-Natron die zugestandene Bauzeit von nur 20 Zyklen genannt hatte. „Wird das Bauwerk Haustechnik erhalten?“ Der Projektleiter zögerte mit der Antwort, wohl wissend, welchen Einfluss Haustechnikgewerke auf einen Bauablauf nehmen können. „Es sollen wohl Licht in die Gänge und ein Falltürsystem installiert werden“, beantwortete Echt-Natron meine Frage. „Nach Voranfrage beim Bauamt wird eine Entrauchung der Fluchtwege und der Hohlräume verlangt, da die Architektenansichten nicht auf Fenster oder sonstige größere Fassadenöffnungen am Gebäude schließen lassen. „Wie das umgesetzt werden soll, ist noch zu klären“, beendet Echt-Natron seine Reaktion auf meine Haustechnikanfrage. Seine Darstellungen ließen mich erschaudern. In mir festigte sich wieder der dringende Wunsch, meine Mitarbeit am Projekt abzulehnen. Die immense Menge an Negativfaktoren wirkte nicht gerade stimulierend, den Job des Bauleiters anzunehmen.
Die befreiende Wirkung des Nein-Sagen-Könnens ist derzeit in Mode gekommen. Ein Heer von Wahrsagern und Schamanen, die es an jeder Ecke in Memphis gibt, beschwören die fast narkotische und berauschende Wirkung einer konsequenten Ablehnungshaltung sowie der damit verbundenen individuellen Autonomie. Ich musste daran denken und begann sorgfältig abzuwägen. Ein Nein bedeutet, raus aus diesem Geschäft. Echt-Natron wäre wohl enttäuscht, wenn ich meine Mitarbeit verweigern würde. Ein echtes Dilemma, dachte ich mir und versuchte positiv zu denken. Ein Ja wiederum verhieße unendlichen Ruhm und höchste Ehre. Ich stellte mir die lange Schlange von Autoren vor, die sich um die Rechte der Abfassung meiner Biografie bemühen. Ich stellte mir vor, wie berühmte Maler und Bildhauer sich drängen, ein Bildnis von mir in stolzer Pose zu inszenieren. Und ich stellte mir vor, wie ein auserwählter Monumentalkünstler aus einem großen Fels in der Nähe des Bauplatzes ein kolossales und Sphinx-gleiches Ebenbild des erfolgreichen Bauleiters meißelt. Für alle vorbeifahrenden Flussfahrer und für alle sonstigen Besucher des Cheops-Bauwerks würde ihr Blick auf einen Baulöwen mit einem klugen mächtigen Kopf fallen. Mein Ebenbild würde bis in die Ewigkeit als Kraftpaket aus Tier und Mensch auf diesem erhabenen Plateau thronen und Scharen von pilgernden Bauleuten und Heimwerkern anziehen. Mit diesen Bildern im Kopf verabschiedete ich mich schnell von meinem Zögern und ließ meine Abenteuerbereitschaft und meinen Pioniergeist siegen. Wohl auch, weil das Gehalt stimmte und Freibier auch für die Bauleitung in Aussicht gestellt wurde. Ich entschied mich für die Teilnahme am Projekt. Sarkastisch, auch um genauso cool wie Echt-Natron zu wirken, fragte ich ihn: „Falls ich die Bauleitung übernehme, was machen wir dann alle Nachmittags?“
Nun ist doch ein Nilpferd an Land gegangen. Ich werde abrupt aus meinen Gedanken an die Arbeitswelt gerissen. Auf meinem Lieblingsplatz am Nilufer steht ein riesiges Nilpferd und beansprucht in höchstem Maße meine Aufmerksamkeit. Es kaut geräuschvoll schmatzend das saftige Ufergrünzeug. Das tut es in bedrohlicher Nähe zu mir. Beim Kauen beobachtet es mich mit aggressiven Blicken voller Misstrauen. Jetzt öffnet das Nilpferd sein riesiges Maul und beeindruckt mich mit seinen imposanten riesigen Eckzähnen und seinen merkwürdig stoßzahnartigen Schneidezähnen. Da möchte ich keinesfalls dazwischengeraten. Voller Grauen schießt mir durch den Kopf, dass es sich bei dem Nilpferd um einen Bullen handeln könnte. Blitzschnell fallen mir die allgemein gültigen Regeln für die Begegnung mit wilden Tieren ein, die für alle unbewaffneten Ägypter gelten. Zunächst gilt es, Ruhe zu bewahren. Das ist leicht gesagt angesichts des monströsen Maules. Ich versuche es trotzdem und ergänze diese Regel mit dem Versuch einer beruhigenden Kontaktaufnahme zwischen Mensch und Tier. Dabei versuche ich meine Angst zu verbergen und unterrichte den Koloss, dass der Verzehr meiner Person für den pünktlichen Beginn der Realisierung eines staatstragenden Bauwerkes außerordentlich behindernd sein würde. Offensichtlich hat das wilde Tiere nicht verstanden und bewegt sich unhöflich weiter auf mich zu. Mir bleibt nur noch die Flucht, die in den Regeln für die unheimliche Begegnung der furchtbaren Art die letzte Option darstellt. Knapp und laut schreiend gelingt die Flucht.
3. Kapitel
Das Projekt aus Sicht des Bauherrn nach einer entspannenden Runde persischer Golf
Pharao Cheops ist mit der Familie, seinem Hofstaat und ein paar Journalisten der überregionalen Presse auf seine Sommerresidenz nach Kuwait gereist. Das ist ein kleiner Ort an einem großen Meer nicht weit vom legendären Babylon entfernt. Es ist ein anziehend magischer Ort im fernen Mesopotamien. Der Wind weht angenehm kühlend vom Meer auf die Küstenregion. Überdurchschnittlich viele Regenfälle machen das Land fruchtbar und klimatisch erträglich. Das sind die Orte, an denen sich die Eliten in den Ferien gern aufhalten. Immergrüne Wälder und paradiesische Gärten mit allerlei exotischem Getier machen Wanderungen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Clevere Eingeborene haben mit Führungen durch diese Traumlandschaften das Geschäftsfeld des Fremdenverkehrs erschlossen. Auch die Ansiedlung von Hotelketten und Gastronomie im Gefolge haben die Grundlage geschaffen, dass sich eine beachtliche Mittelschicht mit gehobenem Wohlstand hier entwickeln konnte.
Der hiesige Gouverneur hat gezielt mit dem Instrument niedriger Steuern wichtige Investoren in die Region gelockt. Der Plan ist aufgegangen, es entstehen hier im Osten tatsächlich blühende Landschaften. Nicht zuletzt auch deshalb hat sich Cheops entschlossen, seine Sommerresidenz genau an diesem Ort errichten zu lassen. Durch die ausgezeichneten diplomatischen Kontakte zum hiesigen Verwaltungsdistrikt bis nach Babylon sind Fördermittel der örtlichen Finanzoberdirektion in die Kassen des Pharao gespült worden. Man respektiert und unterstützt sich halt gegenseitig. Die lange Geschichte der Völker des vereinten ägyptischen Reiches und des mesopotamisch-assyrischen Staatenbundes ist geprägt von faszinierenden kulturellen Umbrüchen und großartigen zivilisatorischen Leistungen. Besonders intensiv beschäftigt sich Cheops mit den überlieferten Geschichten rund um den Turmbau zu Babel, wie in vergangenen Zeiten das heutige Babylon bezeichnet wurde. Er ist fasziniert vom Bestreben des Bauherrn, bis hoch an den Himmel, bis in Gottes Nähe bauen zu wollen. Dass im Ergebnis der Bau eingestellt und die Sprache der am Bau beteiligten Werktätigen verwirrt wurde, stellt für Cheops kein besonderes Problem dar. Wichtig für ihn war vielmehr die sofortige praktische Reaktion des damaligen Herrschers. Der hatte nicht lange rumgeheult, sondern umgehend angewiesen, an den Schulen Fremdsprachenunterricht einzuführen. So wurde die Sprachverwirrung Gottes zum Initial einer neuen progressiven Kulturepoche, das erste zarte Pflänzchen einer Globalisierung. Cheops bewundert diese Pionierleistung der strategischen Staatsführung bis heute.
Cheops und seine Entourage beziehen ihre Luxussuiten und versammelten sich wenig später in Turnsachen auf einer kurzgeschnittenen gepflegten Grasfläche hinter dem Anwesen. Persischer Golf heißt die Sportart, die Cheops über alles liebt. Man spielt einen kleinen weißen Ball durch eine durchdachte Lochanordnung mit Hindernissen aus Wasser oder Sand. Das Ziel ist es, nicht die Löcher zu umgehen, nein, man versucht sie mit möglichst wenigen Schlägen zu treffen. Gelingt das, ist der Jubel groß. Wer mit der geringsten Anzahl an Versuchen alle Löcher des Spielplatzes getroffen hat, bekommt als Sieger eine Belohnung.
Der Sport entstand durch einen Zufall. Unterirdische Tiere hatten, ihren Instinkten folgend, in der Gartenanlage eines Einfamilienhauses im Süden von Kuwait den gepflegten Rasen lochtechnisch unregelmäßig unterbrochen. Der Besitzer des Grundstückes war verärgert und wollte gleich das Lochproblem, den Tierschutz gänzlich missachtend, rabiat beseitigen. Da bemerkte er, wie seine beiden kleinen Kinder mit höchster Freude versuchten, ihre kleinen bunten Spielmurmeln in den Löchern unterzubringen. Bei Erfolg war das freudige Gejauchze der kleinen Jugendlichen nicht zu überhören. Der Grundstücksbesitzer hielt inne, beobachtete noch eine Weile die ausgelassene Stimmung seiner Nachkommen und begann zu grübeln. Er fragte seine Kinder, ob er mitspielen dürfte. Er wollte selbst erfahren, weshalb bei dieser eigentlich sinnlosen Beschäftigung derartige kindliche Freude entstehen kann. Doch er bekam gleich am Anfang Probleme mit seinem rechten Knie, welches das Kriechen auf dem Rasen bald satt hatte und aus Rache zu schmerzen begann. Er ging in seinen Gartengeräteschuppen und kam mit einem Spaten wieder heraus, mit dem er jetzt im Stehen die Murmeln einlochen konnte. Er bemerkte eine gewisse Befriedigung, wenn ihm das gelang. Ihn packte der Ehrgeiz, und er schlug Schlag auf Schlag, seine Kinder vergessend, bis die Sonne unterging. In der folgenden schlaflosen Nacht begann er eine strukturierte Spielidee zu entwickeln. Der entscheidende Durchbruch gelang ihm in den frühen Morgenstunden. Man müsse die Löcher künstlich anlegen, überlegte er sich, allein schon deshalb, um von den zufälligen Grabaktivitäten der Wühlsäuger unabhängig zu sein. Gleich nach dem Frühstück begann er selbst, zur Probe Löcher in seinen gepflegten Gartenrasen zu graben. Das dritte Loch war ihm wohl etwas zu tief geraten, denn eine schmierige, stinkende, dunkle und zähe Flüssigkeit trat hervor. Nach dem ersten Schreck verwischte er sofort die Spuren dieser Peinlichkeit. Das durfte keinesfalls bekannt werden, denn sein Grundstück sollte nicht durch diese ölige Masse im Boden an Wert verlieren. So ließ er für tausende von Jahren Gras über die Sache wachsen. Jedenfalls erfreute sich der Sport im Laufe der Jahre immer größerer Beliebtheit und etablierte sich speziell in den höheren Kreisen. Schnell galt es als schick, in den extra für diese Sportart entwickelten Turnsachen auf dem Spielgelände herumzulaufen. Man schlürfte meist im Anschluss an die Körperertüchtigung noch lässig einen Cocktail und fädelte manch geschäftliche Beziehung ein. Die Elite war unter sich und hatte keine Belästigungen durch gewöhnliche Artgenossen zu befürchten. Auch deshalb schätzte Cheops dieses Freizeitvergnügen und entwickelte einen stetig steigenden Ehrgeiz, sein Handicap zu verbessern.

Heute hat Cheops gute Laune, denn es gelang ihm, seine Spielpartner zu besiegen. Nach einer erfrischenden Dusche und einem kleinem Schläfchen in seinen Privatgemächern ruft er seine Vertrauten und seine Getreuen zu einer kleineren Dienstberatung in den Salon der Residenz. Sein Leibkoch hat ein kleines Dinner vorbereitet. Cheops schätzt die Kreativität dieses Mannes. Heute gibt es eine Sternchensuppe aus erlesenen Eierteigwaren mit zartem Hühnerfleisch. Diese Speise wird vom Chef der Küchencrew besonders liebevoll zubereitet, denn wenn dem Pharao das Gericht mundet, erhält er für ein paar Tage den Rang eines Sternekochs. Jeder Gast erhält auf seinem Teller die Suppe so aufgetragen, dass verschiedene bekannte Sternenbilder des ägyptischen Nachthimmels auf dem Teller erscheinen und dann in geselliger Runde von den Teilnehmern des Dinners erraten werden. Beim Erkennen des Sternbildes kann der Gast dann laut in die Hände klatschen und den Namen des Sternbildes auf seinem Teller in die heitere Runde rufen. Dieses Spiel ist am Hof sehr beliebt und fördert das allgemeine Bildungsniveau im engsten Zirkel der Vertrauten um Cheops.
Die Laune von Cheops wird immer besser. Seine Erfolge bei der Verbesserung des Handicaps und eine köstliche Sternchensuppe versetzen ihn in Stimmung. Das Risiko des Nennens eines falschen Sternbildes auf dem Teller und das Risiko, dafür bestraft zu werden, gehen gegen Null. Heute muss niemand, der daneben tippt, damit rechnen, das gesamte Geschirr und die Töpfe der Zubereitung in der Spülküche aufzuwaschen. Diese Demütigung der Verlierer bereitet Cheops üblicherweise immer einen Heidenspaß.
Nachdem Cheops die Schönheit des Tages und den Geschmack der Speisen gelobt hat, beginnt er den Stand der Dinge um seinen Wüstenwürfel der Speisegesellschaft zu schildern. Ihm widerstrebt es, den sich langsam durchzusetzenden Begriff des „Cheopswürfel“ anzuerkennen. Dazu hält er sich für zu bescheiden. Nie hätte der Pharao für sich Ebenbilder als Relief oder in Stein von überhöhender Größe meißeln lassen. Die Größe, etwa die einer Schachfigur, hielt er für angemessen, denn die Nachwelt soll sich an keinen größenwahnsinnigen Pharao erinnern. Personenkult komme für ihn nicht in Frage, die Pyramide muss reichen. Das hat er von seinem Vorgänger Pharao Snofru übernommen, einem Idealbild eines gerechten Königs. Der gilt als der große Beschützer des ägyptischen Volkes. Er unternahm Expeditionen nach Nubien, Libyen sowie in den Libanon und ließ dort Grenzfestungen zum Schutze des Landes bauen. Die relativ ruhige Regentschaft verdankt Cheops also seinem Vater. Auch die guten und festen diplomatischen Beziehungen zu den Nachbarstaaten übernahm Cheops als Erbe und weiß das zu schätzen. Deshalb ließ er im ganzen Lande verbreiten, dass sein Vater Snofru in seiner gottgleichen Herrlichkeit kaum zu übertreffen ist. Es gibt aber eine Ausnahme. Nicht weit von Memphis entfernt, stehen drei misslungene Steinhaufen in der Wüste, die Zeugnis ablegen, dass selbst einem so weisen Pharao wie seinem Vater, dem ersten Pharao der 4. Dynastie, nicht alles gelingt. Kaum hatte Cheops den Nachfolgerthron bestiegen, reiste er erst nach Meidum zu der zusammengebrochenen Stufenpyramide und dann nach Dahschur zur Knickpyramide sowie zur Roten Pyramide, einem flachen hässlichen Gebilde. Er war entsetzt, als er die Trümmerlandschaften sah. Beim Anblick dieser Zeugnisse doch arg begrenzter Baukunst erinnerte sich Cheops an das Versprechen am Totenbett seines Vaters. Er versprach, immense Anstrengungen zu unternehmen, das Werk der Schaffung von kolossalen Erinnerungsmonumenten der vierten Pharaodynastie erfolgreich weiter zu entwickeln. In Cheops wuchs wenig später der Ehrgeiz, seinen Vater mit einem nie da gewesenen Riesenbauwerk zu übertreffen.
Als geladener Ehrengast an den Bezirksmeisterschaften für Knobelspiele entging dem Pharao nicht, welche Faszination von den Spielgeräten ausging. Diese dreidimensionalen Polyeder, als Hexaeder mit 6 gleichen Flächen als Würfel ausgebildet, haben es Cheops sofort angetan. Nach intensiven Gesprächen mit seinen Beratern wurde schließlich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Ein bekannter und erfahrener Architekt, mit dem Namen San-Rah, wurde zu dieser Studie beauftragt. Darin riet der Architekt, von der perfekten Würfelform abzusehen und mit einer geringeren Höhe als die der Grundflächenseiten zu planen. Dies wäre statisch und wirtschaftlich betrachtet sinnvoll und würde mit einer Höhe von 280 Königsellen alle bisherigen Bauwerke bei weitem übertreffen, fasste der bekannte Planer seine Machbarkeitsempfehlungen zusammen. Cheops ließ die Aussagen prüfen und konnte konstatieren, dass das bisher höchste Bauwerk in Ägypten, die rote Pyramide mit 208 Königsellen Höhe, bei weitem übertroffen werden würde. So entschloss sich der Pharao, die Planungen durch San-Rah mit der Grundlagenermittlung beginnen zu lassen.
Cheops lässt den Papyrus mit dem Schnitt durch den Wüstenwürfel an einer Tafel befestigen, die extra für diese Besprechung herangeschafft wurde. Der Architekt hatte diese Pläne reich mit Ornamentik ausgeschmückt, damit sie sich auch für Repräsentationszwecke eignen. Die Wirkung ist enorm. Zunächst schweigen alle sichtlich beeindruckt. Cheops kostet nun die Ungeheuerlichkeit seiner Baupläne weidlich aus. Seine Vertrauten beginnen nun demütig, Worte von Göttlichkeit und Sonnengleichheit zu stammeln. Dann zeigt er mit einem Stift, den ihm ein Kuli reicht, auf mehrere Hohlräume und Verbindungsgänge im Inneren des Kolosses. Sie sind merkwürdig angeordnet und nach Aussage des Architekten vom unterirdischen Nestbau des gemeinen ägyptischen Feldhamsters inspiriert. Cheops ist von diesem System innerer Hohlräume und deren Verbindungsgänge angetan, auch wenn er sich zur Funktion noch nicht festlegen will. Derzeit läuft am Hofe ein Ideenwettbewerb. Die beste Idee zur Nutzung und zum Sinn der Anordnung der Hohlräume soll prämiert werden. Der Architekt selbst gibt sich bedeckt und verlangt zunächst von Cheops die Entscheidung, ob die Hohlräume der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen oder nicht. Dies wäre der primäre Entscheidungsansatz, so San-Rah. Falls eine öffentliche Nutzung in Erwägung gezogen wird, müsse man weiterführende Überlegungen zum Ausbau der Hohlräume anstellen. Nach den Bauvorschriften für öffentliche Gebäude beim Hochbauamt von Gizeh wären dann Damen- und Herrentoiletten und deren Entlüftung erforderlich. Die Wege im Würfelmonument müssten beleuchtet und entraucht werden können. Eine Fluchtwegebeschilderung ist dann Pflicht. Weiterhin wären die bürokratischen Aufwendungen für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, den Sicherheitseinrichtungen für die Nutzung und die energetischen Nachweise für das nachhaltige Bauen in einer beachtlichen Dimension erforderlich. Für Cheops ist das ein Alptraum. Deshalb zögert er noch mit seiner Entscheidung zur Nutzung und befindet sich hierzu gegenwärtig in intensiven Gesprächen mit seiner Projektsteuerung.